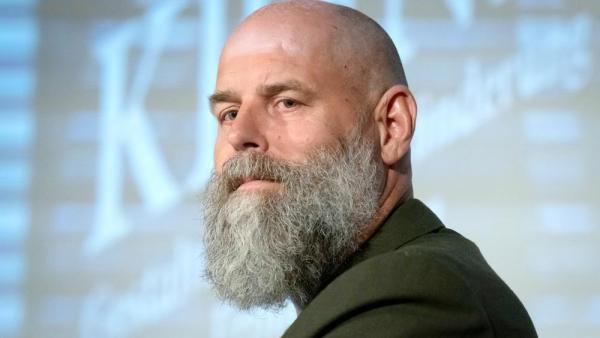Der Ausgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Ende April hat selbst die politischen Experten vor Ort überrascht. Als eine Woche vor der Abstimmung Meinungsumfragen der DVU plötzlich 5% gaben, gestand Ministerpräsident Reinhard Höppner, damit "überhaupt nicht gerechnet" zu haben. Am Ende bekam die rechtsradikale Partei fast das Dreifache: 12,9%. Besonders alarmierend ist die Dominanz der Rechtsradikalen in der Jugend: Von den 18-24jährigen Männern wählten 38% DVU - mehr als CDU (14), SPD (16) und Bündnisgrüne (7) zusammengenommen. 1) Dabei hätte man es wissen können. Schon seit einem Jahr hatten Behörden und Sozialwissenschaftler mit empirisch gut fundiertem Material auf entsprechende Entwicklungen verwiesen. Bereits im Mai 1997 stellte eine Studie der Universität Potsdam fest: "Ostdeutsche Jugendliche unterscheiden sich in ihren politischen Ansichten signifikant von westdeutschen Jugendlichen gleichen Alters. Rechtsextremismus und Antisemitismus sind erheblich weiter verbreitet.
Rund ein Drittel aller Jugendlichen vertreten die Position: Deutschland braucht wieder einen Führer." Diese Erkenntnis korreliert mit der Entwicklung der Straftaten, insbesondere der Gewaltstraftaten von rechts. 2) Bezogen auf tausend Einwohner werden in der alten DDR dreimal soviele rassistische Straftaten offiziell registriert wie in der ehemaligen BRD. Da der Ausländeranteil im Westen mehr als fünfmal so hoch ist, könnte man auch sagen: Ein Fremder in Guben ist fünfzehn mal so gefährdet wie in Gießen. Besonders brisant wird dieser Trend, weil er sich in bestimmten Regionen konzentriert: Zwanzig "national befreite Zonen" haben die Rechtsradikalen in den neuen Bundesländern errichtet. Das berichtete die Bundesausländerbeauftragte Cornelia Schmaltz-Jacobsen auf ihrer Pressekonferenz im Dezember 1997. (In der schriftlichen Fassung ihres Jahresberichtes fehlt diese Information.) Allein für Brandenburg machte die Landesregierung folgende Angaben: "Nach Erkenntnissen des (Innen-)Ministeriums gibt es etwa 80 Orte, an denen gewaltbereite Jugendgruppen existieren, 40 Orte werden dem rechtsextremen Lager zugerechnet." ("Berliner Zeitung", 15.1.1998)
Die rechte Lifestyle-Guerilla
In der rechtsradikalen Diskussion taucht das Projekt "Befreite Zone" vermutlich zum ersten Mal in einem Artikel mit gleichlautender Überschrift auf, der in der Zeitung "Vorderste Front", dem Organ des Nationaldemokratischen Hochbundes (NHB) erschienen ist. (Der Artikel zirkuliert bis heute im Thule-Netz). Dort wird als Ziel politischer Arbeit die Schaffung von Freiräumen angegeben, "in denen wir faktisch die Macht ausüben, in denen wir sanktionsfähig sind, d.h. wir bestrafen Abweichler und Feinde, wir unterstützen Kampfgefährtinnen und -gefährten, wir helfen unterdrückten, ausgegrenzten und verfolgten Mitbürgern." Es wird "automatisch vorausgesetzt, daß diese Zonen in erster Linie in Mitteldeutschland zu schaffen sind." Die soziale Realität in diesen "national befreiten Zonen" hat Ende letzten Jahres Burkhard Schröder in seinem Buch "Im Griff der rechten Szene - Ostdeutsche Städte in Angst" nachgezeichnet 3): "Wird der Osten Deutschlands braun? Eins ist unstrittig: Die ultrarechte Szene ist anders als im Westen - sie ist zu einer sozialen Bewegung geworden. Eine der wichtigsten Entwicklungen ist, daß die rechte Subkultur ... als soziale Bewegung alle Bereiche der Alltagskultur dominiert. Sie ist ein Konglomerat aus Musik, Mode, Treffpunkten, gemeinsamen überregionalen Aktionen sowie Ideologiefragmenten." Schröder führte seine Fallstudien an vier Klein- und Mittelstädten durch, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich sind: In der Oderstadt Schwedt regiert die SPD, im sächsischen Wurzen die CDU, Fürstenwalde hat einen FDP-Bürgermeister, in Quedlinburg kommt er vom "Bürgerforum".
Schröder entdeckt unter dieser unterschiedlichen Oberfläche jeweils denselben subkulturellen Untergrund: Überall führen die rechten Kader einen Kleinkrieg um die Kontrolle von Schulen und Jugendclubs, der von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird. Das Verbot der meisten Nazi-Organisationen hat die Ausbreitung der Bewegung nicht verhindert. Motor sind jetzt dezentrale Kameradschaften, die ihre Namen und Treffpunkte ständig wechseln - eine diffuse "Lifestyle-Guerilla", die es geschafft hat, in den von Schröder untersuchten Städten ihre Hegemonie in der Jugendszene durchzusetzen. Es ist ein Kulturkampf um Frisuren, Mode und Musik: Alles vermeintlich Undeutsche wie Rastalocken, Kapuzenpullis, italienisches Essen oder englische Musik muß verschwinden, und wer das nicht kapiert, wird bedroht und geschlagen. Insbesondere die von den braunen Kameraden propagierte "Aktion Notenschlüssel" hat Erfolg: Bands wie Störkraft und Noie Werte oder der Barde Frank Rennicke bringen trotz Verbots im Osten mehr CDs und Musik-Cassetten unters Jungvolk als Michael Jackson oder Take That. Wo Punks und Linke den Aufbau eigener Treffpunkte versuchten, setzten die Rechten ihr Kulturmonopol rabiat durch und zerstörten die alternativen Einrichtungen. Die Kommunalverwaltungen griffen nicht ein oder stellten den Rechten sogar städtische Räumlichkeiten zur Verfügung, wie in Schwedt und Wurzen geschehen. Die Folge: Punker, Rastas, Skater und Antifas wanderten nach Berlin und Leipzig ab, emigrierten sozusagen. Schröder bilanziert: "In einigen Städten kommt es deshalb nicht mehr zu öffentlich sichtbaren Gewalttaten, weil den Neonazis die Gegner ausgegangen sind."
Die Korrelation zwischen rechter Subkultur und DVU-Erfolg läßt sich anhand des Magdeburger Stadtteils Neu-Olvenstedt verdeutlichen, dem Wahlkreis von Ministerpräsident Reinhard Höppner (SPD). 200 der 600 "gewaltbereiten Skinheads" des Bundeslandes kommen laut Verfassungsschutz aus Magdeburg, fast alle aus diesem Stadtteil. Bei 30 000 Einwohnern ist das nur ein ganz kleiner Teil, aber das diffuse Sympathisanten-Umfeld muß beträchtlich sein. "Nach 18 Uhr gehen wir nicht mehr vor die Tür", erklärt eine Passantin. Die etwa vierzigjährige Deutsche lebt mit ihrem pakistanischen Ehemann und dessen Bruder seit knapp zwei Jahren in einem der Hochhäuser. Wenn das Ehepaar abends von der Arbeit komme, lümmelten die Jugendlichen auf dem Rasen. "Am Anfang haben wir gegrüßt, aber die haben ausgespuckt." Die Kids pöbelten im Treppenhaus, würfen mit Kieseln gegen die Scheiben, stopften Dreck in den Briefkasten. Der Psychoterror hat Erfolg: Von den vietnamesischen Vertragsarbeitern, die bis vor ein paar Jahren in zwei Hochhäusern wohnten, lebt keiner mehr hier. An Neu-Olvenstedt blamiert sich die These, daß die "soziale Kälte, die in Bonn gemacht wurde" für den DVU-Erfolg verantwortdich sei (wie etwa PDS-Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch in der Bonner Runde nach der Wahl in Sachsen-Anhalt behauptete). Damit soll nicht bestritten werden, daß in den neuen Bundesländern Verarmungsprozesse ablaufen; wären sie allerdings allein ausschlaggebend für die Rechtswende, so müßten sich vor allem Frauen entsprechend artikulieren, denn sie haben durch die Wiedervereinigung die größten Einkommens- und Statusverluste erlitten. Die Wahlanalyse zeigt aber das Umgekehrte: Fast zwei Drittel der DVUWähler in Sachsen-Anhalt waren Männer.
Wer die Plattenbauten samt dem darin zu findenden Elend als Treibhaus für Neonazis sieht, bekommt von Thomas Heinrich, dem evangelischen Vikar des Stadtteils, kräftig Contra: "In der DDR war es noch ein Privileg, in Olvenstedt zu wohnen. Die Siedlung hat viele Grünflächen, und in den letzten Jahren hat der Stadtrat soviel Strukturhilfe rübergeschoben, daß man andernorts schon neidisch ist." Für Heinrich sind die Rechten nicht wegen "sozialer Kälte", sondern wegen sozialer Wärme stark geworden, vor allem wegen der "akzeptierenden Jugendarbeit", wie er sie im Fachjargon nennt. Tatsächlich sind rechte Kids die "wichtigste Zielgruppe" des Jugendzentrums Brunnenhof - so steht es jedenfalls in einem Konzeptionspapier des Magdeburger Sozialministeriums. Für diese Klientel werden "erlebnispädagogische Maßnahmen wie Sportveranstaltungen mit wöchentlichem Training, Gestaltung der Ferienfreizeiten einschließlich Reiseveranstaltungen" durchgeführt. Besonders problematisch: Skinhead-Musiker wie die vom Verfassungsschutz als "rechtsextremishsch" eingestufte Band "Elbsturm" dürfen in dem städtischen Jugendzentrum proben, obwohl deren Konzerte regelmäßig wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit aufgelöst werden müssen "Die Kommunen werden künftig gebeten, keine Räumlichkeiten für das Auftreten dieser Musikgruppen bereitzustellen", hatte die Landesregierung Ende 1996 gebeten. Dies hinderte sie allerdings nicht daran, die Subventionierung des "Brunnenhof" im Jahr 1997 weiter aufzustocken: Aus der Landeskasse flossen 119 000 Mark, aus dem Stadtsäckel kam noch einmal derselbe Betrag. "Man will die Skins von Gewalt abhalten, indem man sie verwöhnt. Wie prima das klappt, hat sich jetzt wieder erwiesen", kommentiert Heinrich mit Verweis auf die nicht abreißende Kette von Übergriffen auf Punks, Linke und "Undeutsche".
Ganz anders wird das in der "Bürgerinitiative Neu-Olvenstedt" gesehen. Die 20 Aktivisten der Gruppe sind großteils sozial oder links engagiert. Nach einem wiederholten Mordversuch Olvenstedter Skinheads im Januar 1998 bekundeten sie "Abscheu vor dem brutalen Anschlag rechter Schläger", diskutieren aber gleichzeitig, ob nicht ein weiterer Treffpunkt für die rechten Kids eingerichtet werden müsse, "damit wir nicht den Kontakt zu ihnen verlieren". Das wurde schließlich dem zuständigen Polizeihauptkommissar Peter Bullert, der als Gast an dem Treffen teilnahm, zu bunt: "Die Bürgerinitiative kann doch keine Organisationsstrukturen für die Rechten aufbauen wollen." Nein, so ist es natürlich nicht gemeint, bekunden alle. In der verabschiedeten Resolution heißt es dann: "Nur Begegnung und das zielgerichtete Gespräch, das Vertrauen setzt, schafft den geistigen Nährboden, um Gewalt abzubauen." Das Wahlergebnis weist darauf hin, daß diese Art von Verständnis den Linksparteien nichts gebracht hat: In Neu-Olvenstedt waren die Verluste der CDU relativ zum Landesdurchschnitt niedrig (minus 6,5%), die der PDS jedoch ungewöhnlich hoch (minus 6,3%). Die DVU sahnte ab - mit 13,7% sogar noch etwas besser als anderswo.
Sozialarbeit und der braune "Aufbau Ost"
Ähnliche Beispiele für die Förderung des braunen "Aufschwung Ost" durch staatlich betriebene oder unterstützte Sozialarbeit finden sich in den neuen Bundesländern reichlich. Ein Musterfall ist Schwedt an der Oder, das bereits 1993 von der "Zeit" als "die erste nationalsozialistische Stadt Deutschlands" bezeichnet wurde. "Richtig los ging es in Schwedt, als 1992 mit Mitteln des AgAGProgramms die ersten Jugendtreffs gegründet wurden", berichtet Schröder. 4) Die Stadtverwaltung stellte den Rechten einen Kellerraum im Freizeittreff "Hit" zur Verfügung, das Jugendamt schickte mit städtischem Briefkopf ein Schreiben an die "Nationalistische Jugend Schwedt", eine Filiale der mittlerweile verbotenen Nazi-Gruppe "Nationalistische Front" (NF). Birgit K., Sozialarbeiterin des Jugendamtes und dort auch "Mutti der Rechten" genannt, lud einen der Totschläger zum Essen ein und vernichtete ein Amateurvideo, das einen rechten Überfall dokumentierte. Originalton Birgit K.: "Wir stellen uns ganz bewußt an die Seite derer, die im Volksmund die Bösen sind, denn so böse sind sie nämlich gar nicht." Frau K. wurde wegen "Förderung faschistischer Organisationen" aus der PDS ausgeschlossen, über Konsequenzen seitens ihres Arbeitsgebers ist nichts bekannt. Im sächsischen Wurzen gilt Katharina K. als "Glatzenmutter". Sie war Kreistagsmitglied der CDU und Dezernentin für Bildung, Jugend und Sport und lange Zeit Leiterin eines Behindertenwohnheims. Dort durften Faschos und Skinheads Feten feiern und, das ist aktenkundig, Diebesgut verstecken. Der größte Erfolg ihres Resozialisierungsprogrammes war ein Hilfstransport, der Kleidung und Lebensmittel nach Rumänien brachte, und für den Frau K. die Rechten als Helfer engagierte. Die örtliche Presse war begeistert, das sächsische Kultusministerium gab einen Zuschuß von 14 000 Mark. Zufällig war die Reisegruppe auch am 20. April, "Führers Geburtstag", am Zielort. Die Skins zogen grölend durch das Dorf, dem sie angeblich helfen sollten, und bedauerten, daß sie keine Waffen dabeihatten.
Es geht längst nicht mehr um Einzelfälle. Geradezu massenhaft haben im Osten Deutschlands wohlmeinende Nachsicht und falsches Verständnis für die Problemlagen der Jugendlichen zur Stärkung der rechten Szene geführt. Bernd Wagner, der 1990/91 den Verfassungsschutz der neuen Bundesländer geleitet und danach im Bonner AgAG-Programm mitgearbeitet hat, stellt weniger das Konzept der "akzeptierenden Jugendarbeit" an sich in Frage, kritisiert aber die mangelnde politische und/oder pädagogische Qualifikation der Akteure vor Ort. Oft beschränke sich deren Leistung darauf, "außer für Getränke und ein wenig Ordnung vor allem dafür zu sorgen, daß die rechten Jugendlichen sich in Interviews mit Journalisten nicht um Kopf und Kragen redeten." Wagners Resümee: "Das AgAG-Programm hinterläßt Ruinen, die wenigen festen Stellen im Bereich der offenen Jugend- und Kulturarbeit sind aber ein Sockel, auf dem es sich aufzubauen lohnt." Denn "national befreiten Zonen" gelte es "demokratisch befreite Zonen" entgegenzusetzen. 5) Die liebevolle sozialarbeiterische Fürsorge wird vielerorts durch eine laxe polizeiliche Prävention und Repression ergänzt. Noch die besten Ergebnisse zeigt die Soko Rex im CDU-regierten Sachsen mit einer Aufklärungsquote von 80%. Sie wird von den Rechten wegen ihrer rüden Methoden gefürchtet: Wenn bei Razzien nichts Prozeßverwertbares gefunden wird, werden auch mal die Springerstiefel der Anwesenden einkassiert. In Brandenburg und MecklenburgVorpommern wurden die Sokos im vergangenen Jahr aufgelöst. Nach den alarmierenden Meldungen im Januar 1998 beeilte sich Stolpes Innenminister Alwin Ziel, den Fehler durch die Schnellgründung einer neuen Sondereinheit ("Mega") wieder gutzumachen. Im rotgrünen Sachsen-Anhalt gibt es eine vergleichbare Truppe, die KEG - Koordinierungsgruppe Extremismus und Gewalt, von der jedoch Kenner der Szene nicht viel halten. Wie blind die Beamten zuweilen sind, demonstriert die offizielle Polizeistatistik. Dort ist im Jahr 1997 der Mord eines Neu-Olvenstedter Skinheads an einem Punk nicht als "Straftat mit rechtsextremistischer Motivation" aufgeführt wurde. Die Begründung des Magdeburger Innenministeriums: Rechtsextremismus sei eine "Bestrebung zur Systembeseitigung", diese sei bei dem Mörder nicht erkennbar gewesen.
Nationalrevolutionäres Image
Bernd Wagner, der schon seit 1987 (damals noch für das DDR-Innenministerium) die rechte Jugendszene im Osten beobachtet, wird nicht müde zu betonen, daß die braunen Gewächse ihre Wurzeln auch im "Arbeiter- und Bauernstaat" haben, und daß die Rechten in ihrem Selbstverständnis nicht Gefolgsleute, sondern Gegner des kapitalistischen Systems sind. "Es sind im Wortsinne Nationalsozialisten. Sie wollen, etwa im Verhältnis von 60:40, die guten Seiten sowohl des 3. Reiches wie der DDR bewahren." Schon Ende der 70er Jahre formierten sich die braunen Kameraden in der DDR. Ihnen gefiel das autoritäre Strukturprinzip des "Arbeiter- und Bauernstaates", der minimale Anteil an nicht-deutscher Bevölkerung, die Stigmatisierung dissidenten Verhaltens. Kennzeichnend für die im Osten hegemoniale Variante des Rechtsradikalismus ist eine sozialistische Phraseologie, die an die NSDAP erinnert. Dem flüchtigen Beobachter erschließen sich die Faschisierungsprozesse in der Ost-Jugend oft deswegen nicht, weil sich die meisten Kader der dezentralen Kameradschaften vom Hitlerismus absetzen und sich auf den nationalrevolutionären Flügel der NSDAP, also insbesondere die Gebrüder Strasser, beziehen. Einen repräsentativen Typus dieses Prolet-Ariertums verkörpert Kay Diesner, der im Februar 1997 zunächst einen PDS-Buchhändler zusammenschoß und zwei Tage später einen Polizisten ermordete.
Diesners Prozeßerklärungen lesen sich teilweise wie Plagiate von RAF-Kommuniques: Er bezeichnete sich als Kämpfer "gegen den imperialistischen und faschistischen Staat der BRD für die Freiheit des deutschen Volkes" und bezog sich positiv auf ETA und IRA. Einen ähnlichen Ideologiemix scheint es auch im legalen Umfeld der Rechtsterroristen zu geben. So heißt es in einem Solidaritätsschreiben: "Wir hoffen, daß Du dir da im Knast einigermaßen gut durchschlägst. Haltet die Ohren steif und laßt Dich nicht unterkriegen! Kampf dem Bullenstaat! Destroy the System! Mit revolutionären Kampfesgrüßen aus den Niederlanden, Aktivisten Groningen - Feuer und Flamme für diesen Staat!" Sehr aufschlußreich sind auch einige von der Diesner-Biographin Laura Benedict gesammelte Texte des rechtsradikalen Barden Frank Rennicke, so zum Beispiel das Lied "Rote Jugend", das "zum unumstrittenen Kultsong" (Benedict) der rechten Kids geworden ist. Es stellt einen Aufruf zum Zusammengehen von rechten und linken Jugendlichen gegen das System dar, man habe schließlich dieselben Feinde und dieselben Ziele. Kostprobe: "Es schröpfen Konzerne, es herrschen die Banken, es sterben die Völker der Welt! Wir kämpfen dagegen, wir wolln nicht erkranken... Und daß wir - wie ihr - gegen Ausbeutung sind und Atomenergie selbst verdammen... He oho, laßt euch nicht länger verkohlen..." . Buchautor Schröder hat in Quedlinburg beobachtet, wie der örtliche Nationalrevolutionär Steffen Hupka (seit kurzem NPD-Bundesvorständler) mit solchen Argumenten an der PDS-Basis punktete. So erklärt sich, warum die Wahlerfolge der PDS, trotz der fleißigen Antifa-Arbeit der PDS-Jugend, der wachsenden Faschisierung in den neuen Bundesländern nicht zuwiderlaufen. "Lummer und Gysi sind gut" - mit diesem Zitat eines Gesprächspartners übertitelte tazReporter Eberhard Seidel-Pielen 1997 ein Interview mit Kids in der rechten Hochburg Fürstenwalde. Daß das keine isolierten Stimmen sind, zeigte sich ebenfalls bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt: Da die DVU keine Direktkandidaten aufgestellt hat, mußten ihre Wähler sich bei der Erststimme für eine andere Partei entscheiden. 23% der DVU-Wähler gaben ihre Erststimme einem PDS-Kandidaten - mehr als jeder anderen Partei.