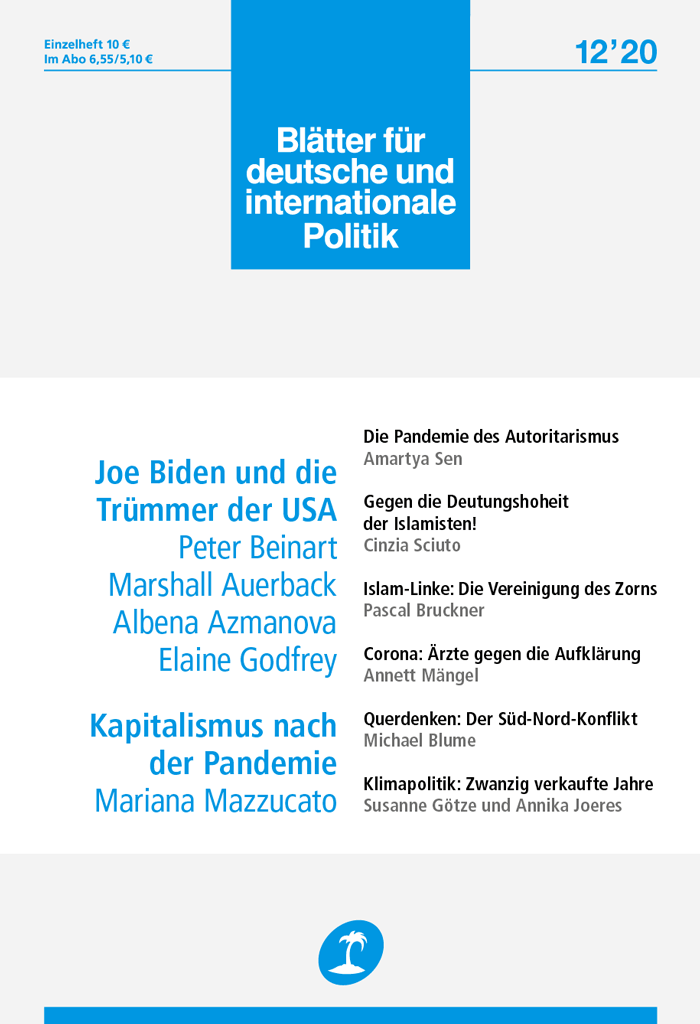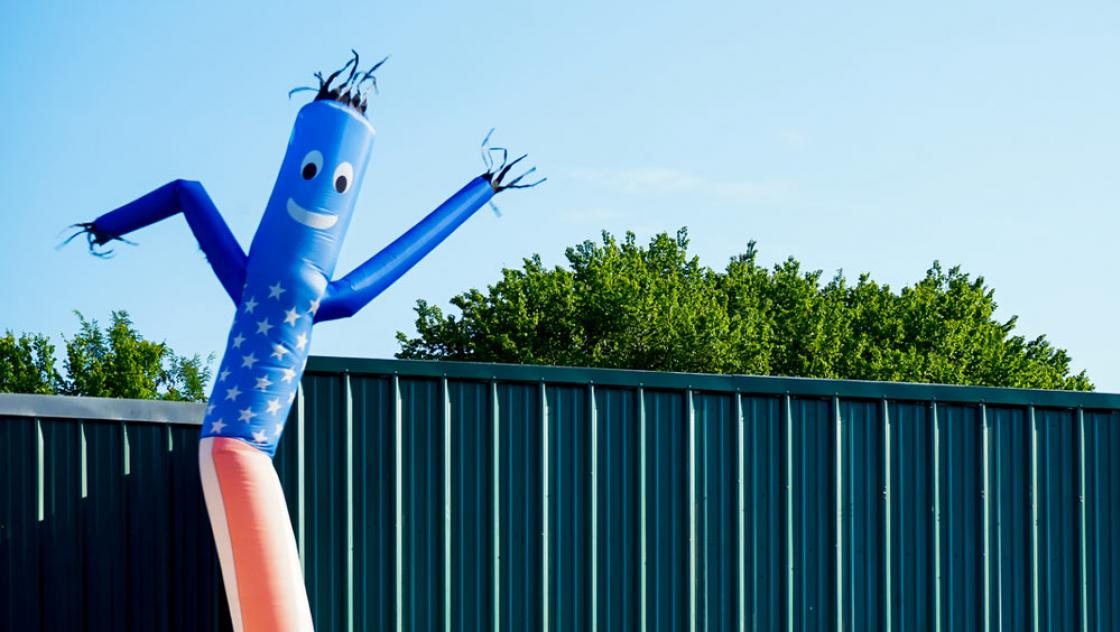
Bild: William Pittman / photocase.de
Nach der Finanzkrise von 2008 schossen die Staaten weltweit mehr als drei Billionen US-Dollar in das Finanzsystem ein. Auf diese Weise wollten sie die Kreditmärkte wieder flüssig und die Weltwirtschaft wieder funktionsfähig machen. Doch statt der Realwirtschaft zu helfen – also den Sektoren, in denen tatsächlich Güter erzeugt und Dienstleistungen bereitgestellt werden –, landete der Löwenanteil der Gelder in der Finanzindustrie. Die Staaten retteten die großen Investmentbanken, die unmittelbar zu der Krise beigetragen hatten, und als die Wirtschaft wieder in Gang kam, ernteten ebendiese Unternehmen die Früchte des Aufschwungs. Die Steuerzahler hingegen fanden sich in einer Weltwirtschaft wieder, die genauso kaputt, ungerecht und umweltschädlich war wie zuvor. „Eine ordentliche Krise sollte man“, einer beliebten Maxime der Politik zufolge, „keinesfalls ungenutzt verstreichen lassen“. Doch die Chance wurde vertan.
Angesichts der Corona-Pandemie und der Lockdowns, unter deren wirtschaftlichen und sozialen Folgen sie wanken, sollten die Staaten den gleichen Fehler nicht noch einmal machen. In den ersten Monaten nach dem Auftreten des Virus griffen die Regierungen ein, um den damit einhergehenden Krisen zu begegnen: Sie beschlossen Maßnahmen zum Schutz von Wirtschaft und Arbeitsplätzen, Regeln, um die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen, und investierten in Forschung und Entwicklung von Behandlungsmethoden und Impfstoffen. Diese Rettungsmaßnahmen sind notwendig. Es kann aber nicht sein Bewenden damit haben, dass immer dann, wenn Märkte versagen oder Krisen ausbrechen, der Staat als finanzieller Nothelfer der letzten Instanz in Erscheinung tritt. Vielmehr sollte er Märkte aktiv derart gestalten, dass diese dauerhaft Ergebnisse liefern, die allen zugute kommen.
In der Krise von 2008 hat die Welt diese Gelegenheit verpasst, aber heute bietet sich ihr eine zweite Chance. Wenn die Staaten sich aus der gegenwärtigen Krise herausarbeiten, können sie mehr tun, als das Wirtschaftswachstum zu stimulieren. Sie können dieses Wachstum dahingehend steuern, dass eine bessere Volkswirtschaft entsteht. Statt Unternehmen bedingungslos unter die Arme zu greifen, können sie ihre Rettungsmaßnahmen so konditionieren, dass diese dem öffentlichen Interesse und der Lösung gesellschaftlicher Probleme dienen. Sie können verlangen, dass mit öffentlicher Unterstützung entwickelte Impfstoffe allgemein zugänglich gemacht werden. Und sie können sich weigern, Unternehmen zu retten, die ihre CO2-Emissionen nicht drosseln oder fortfahren, ihre Gewinne in Steueroasen zu verstecken.
Zu lange schon sozialisieren die Staaten Risiken und Verluste, während Gewinne privatisiert werden: Die Öffentlichkeit zahlte den Preis, wenn es galt, Schäden zu beheben, aber das Ergebnis kam überwiegend Privatunternehmen und deren Anteilseignern zugute. In Zeiten der Not zögern viele Unternehmen nicht, nach staatlicher Unterstützung zu rufen, in guten Zeiten aber soll der Staat sich heraushalten. Die Coronakrise eröffnet die Chance, dieses Ungleichgewicht durch einen neuen Stil des Deal-Making zu korrigieren: Mit Staatsmitteln gerettete Unternehmen sollten verpflichtet werden, das öffentliche Interesse stärker zu berücksichtigen, und die Steuerzahler sollten an den Erfolgen teilhaben, die herkömmlicher Weise allein der Privatwirtschaft zugute kommen. Wenn die Staaten sich jedoch nur auf die Beendigung der gegenwärtigen Schwierigkeiten konzentrieren, ohne die Spielregeln neu zu fassen, wird das auf die Krise folgende Wirtschaftswachstum weder inklusiv noch nachhaltig sein. Und Geschäftszweigen, die an langfristigen Wachstumschancen interessiert sind, wird es ebenso wenig nutzen. Das staatliche Eingreifen wird sich als Vergeudung erweisen und die verpasste Gelegenheit lediglich der nächsten Krise den Weg bereiten.
Woran das System krankt
Fortgeschrittene Volkswirtschaften litten schon lange vor Covid-19 unter erheblichen strukturellen Mängeln. Das Finanzwesen etwa – um nur ein Kernproblem zu benennen – finanziert sich selbst und untergräbt so die Grundlagen langfristigen Wachstums. Der Löwenanteil der dort erzielten Profite fließt in Banken, Versicherungsgesellschaften und Immobilien zurück, statt für produktive Zwecke, etwa Infrastruktur oder Innovationen, genutzt zu werden. So unterstützen beispielsweise nur zehn Prozent aller britischen Bankkredite Firmen außerhalb des Finanzsektors, während der „Rest“ in Immobilien und Kapitalanlagen fließt. In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften machten Immobilienkredite 1970 rund 35 Prozent der gesamten Kreditvergabe aus. Bis 2007 war ihr Anteil auf etwa 60 Prozent angewachsen. Die derzeitige Finanzstruktur führt so zu einer Verschuldungswirtschaft und Spekulationsblasen, die, wenn sie platzen, Banken und andere Akteure veranlassen, um staatliche Rettungsmaßnahmen zu betteln.
Ein weiteres Problem erwächst daraus, dass viele große Unternehmen langfristige Investitionen im Interesse kurzfristiger Erfolge vernachlässigen. Die Obsession mit Quartalserträgen und Aktienpreisen veranlasst CEOs und Konzernvorstände, Anteilseigner durch Aktienrückkäufe zu erfreuen, die den Wert der verbleibenden Anteile steigern. Gleichzeitig steigt natürlich auch der Wert der Aktienoptionen, die Bestandteil der meisten Vorstandsbezüge sind. Die unter den Global 500 des Wirtschaftsmagazins „Fortune“ gelisteten Firmen haben im vergangenen Jahrzehnt eigene Aktien im Wert von über drei Billionen US-Dollar zurückgekauft. Diese Rückkäufe gehen zu Lasten der Investitionen in Löhne und Qualifizierungsmaßnahmen, aber auch von Forschung und Entwicklung.
Zu den schwerwiegenden Fehlentwicklungen zählt des weiteren die Aushöhlung der staatlichen Leistungsfähigkeit. Für gewöhnlich greifen die Staaten nur in Fällen unübersehbaren Marktversagens ein, und was sie dann tun, ist oft zu wenig und kommt zu spät. Wenn der Staat nicht als Wertschöpfungspartner, sondern bloß als Reparaturbetrieb aufgefasst wird, werden öffentlich finanzierte Einrichtungen ausgehungert. Sozialprogramme, das Bildungs- und das Gesundheitswesen – sie alle leiden dann unter Mittelverknappung.
In der Summe haben diese Fehlleistungen zu Mega-Krisen geführt. Das gilt für die Wirtschaft wie auch für den ganzen Planeten. Die Finanzkrise wurde weitgehend durch exzessive Kreditströme in den Immobilien- und den Finanzsektor verursacht, die zu Wertpapierblasen und zur Überschuldung privater Haushalte führten, statt die Realwirtschaft und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Der Mangel an langfristigen Investitionen in grüne Energie hat unterdessen die Erderwärmung so weit beschleunigt, dass der Weltklimarat Alarm schlug: Die Welt habe nur noch zehn Jahre Zeit, irreversible Auswirkungen zu verhüten. Nichtsdestotrotz subventioniert der US-amerikanische Staat alljährlich fossile Treib- und Brennstofferzeugung in einer Größenordnung von um die 20 Mrd. Dollar, im wesentlichen durch steuerliche Vorzugsbehandlung. Die EU-Subventionen belaufen sich sogar auf insgesamt rund 65 Mrd. Dollar. Bei dem Versuch, den Klimawandel zu bewältigen, denken Politiker vor allem an Anreize wie CO2-Besteuerung und amtliche Auflistungen jener Investitionen, die als grün gelten. Vor den verbindlichen Regulierungsmaßnahmen, derer es bedarf, um die 2030 drohende Katastrophe zu verhüten, schrecken die Verantwortlichen jedoch zurück.
Das Risiko tragen die Steuerzahler
Die Coronakrise hat all diese Probleme nur noch verschärft. Im Augenblick konzentriert die Welt sich darauf, die aktuelle Krise des Gesundheitswesens zu überleben, nicht aber auf die Verhütung der kommenden Klimakrise oder der nächsten Finanzkrise. Die Lockdowns zerstören die Existenzgrundlagen von Menschen, die in der unsicheren Gig Economy arbeiten, sich mit Minijobs durchschlagen, darunter viele Künstler, Freiberufler und Scheinselbstständige. Vielen von ihnen fehlen sowohl eigene Rücklagen als auch Arbeitgeberleistungen wie Krankenversicherung und Lohnfortzahlung, mit denen sie den Sturm überstehen könnten. Die Unternehmensverschuldung, die zu den wesentlichen Gründen der letzten Finanzkrise zählt, wächst nur noch weiter an, wenn Firmen jetzt beträchtliche Neukredite aufnehmen, um den Kollaps der Nachfrage zu kompensieren. Und aufgrund ihrer Obsession, kurzfristige Interessen ihrer Aktionäre zu befriedigen, stehen viele Unternehmen ohne eine langfristige Strategie da, die sie über die Krise hinwegretten könnte.
Die Pandemie offenbarte auch das Ausmaß des Ungleichgewichts, das sich im Verhältnis zwischen öffentlichem und privatem Sektor herausgebildet hat. In den USA gibt die Nationale Gesundheitsbehörde (NIH) jährlich an die 40 Mrd. Dollar für medizinische Forschung aus. Sie zählt zu den wichtigsten Geldgebern der Forschung und Entwicklung in Sachen Covid-19, von Behandlungsmethoden und Impfstoffen. Die Pharmakonzerne sind jedoch nicht verpflichtet, die so geförderten Produkte für die Bürgerinnen und Bürger, deren Steuergelder sie in erster Linie finanzieren, erschwinglich zu machen. Die in Kalifornien beheimatete Firma Gilead erhielt für die Entwicklung ihres Covid-19-Mittels Remdesivir Bundeszuschüsse in Höhe von 70,5 Mio. US-Dollar. Im vergangenen Juni kündigte das Unternehmen an, was Amerikaner für eine Anwendung des Mittels zahlen sollen: 3120 Dollar!
Das ist typisch für Big Pharma. Eine Studie über die 210 von der U.S. Food and Drug Administration zwischen 2010 und 2016 anerkannten Medikamente ergab, dass „jedes einzelne von der NIH finanziell unterstützt“ worden war.[1] Trotzdem haben Medikamente in den USA die weltweit höchsten Preise. Auch durch Missbrauch des Patentverfahrens verstoßen Pharmafirmen gegen das öffentliche Interesse. Um sich dem Wettbewerb zu entziehen, melden sie extrem weit gefasste Patentansprüche an. Manche beziehen sich auf derart frühe Stadien des Entwicklungsprozesses, dass die betreffenden Unternehmen nicht nur die Forschungsergebnisse, sondern sogar die Verfahren und Instrumente, mit denen diese erzielt wurden, privatisieren können. Ebenso schlechte „Deals“ wurden mit Big Tech abgeschlossen. Silicon Valley ist in vieler Hinsicht ein Produkt der staatlichen Investitionen Amerikas in die geschäftlich riskante Entwicklung revolutionärer Technologien. Die Forschungsmittel für Googles Suchalgorithmus stammten von der National Science Foundation, vom Staat also. Im Fall der GPS-Technologie, von der beispielsweise Uber lebt, war die U.S. Navy der Geldgeber. Die zum Pentagon gehörige Defense Advanced Research Projects Agency schließlich unterstützte die Entwicklung des Internet, der Touchscreen-Technologie, von Siri und jeder anderen Schlüsselkomponente des iPhones.
Das Risiko dieser staatlichen Investitionen trugen die Steuerzahler, aber die meisten der Hightech-Unternehmen, die davon profitierten, bleiben einen angemessenen Beitrag zum Steueraufkommen schuldig. Obendrein scheuen sie sich nicht, Regulierungsmaßnahmen zu bekämpfen, die die Privatsphäre der Menschen schützen sollen. Und obwohl viel von der Macht die Rede ist, die im Silicon Valley entwickelte KI-Produkte und andere Technologien den dortigen Konzernen verschaffen, hört man wenig davon, dass auch in diesen Fällen staatliche Investitionen die Fundamente legten. Wenn der Staat nichts dagegen unternimmt, könnten die Erträge auch dieser Investitionen wieder großenteils in private Hände fließen. Mit öffentlichen Mitteln finanzierte Technologien bedürfen stärkerer Regulierung durch den Staat – und gehören in manchen Fällen in staatliche Hand –, um zu gewährleisten, dass die Öffentlichkeit von den eigenen Investitionen profitiert. Wie die massenhaften Schulschließungen infolge der Pandemie offenbaren, haben nur manche Schüler Zugang zu der für Home-Schooling erforderlichen Technologie, ein Missverhältnis, dass die soziale Ungerechtigkeit nur noch steigert. Der Zugang zum Internet sollte ein Recht aller und kein Privileg sein.
Alles Gesagte spricht dafür, dass das Verhältnis zwischen öffentlichem und privatem Sektor kaputt ist. Seine Reparatur setzt voraus, dass wir uns mit einem tieferreichenden Problem befassen: dem falschen Verständnis des Wertbegriffs. Moderne Ökonomen halten Wert und Preis für austauschbare Kategorien. Frühere Theoretiker wie Francois Quesnay, Adam Smith und Karl Marx wäre diese Auffassung ein Gräuel gewesen. Sie maßen Produkten einen mit der Dynamik des Produktionsprozesses verbundenen intrinsischen Wert bei: Ihr Preis entsprach nicht notwendigerweise ihrem Wert.
Wir müssen den Wertbegriff überdenken
Der heutige Wertbegriff beinhaltet für die Art und Weise, in der Volkswirtschaften strukturiert sind, enorme Implikationen. Er wirkt sich darauf aus, wie Organisationen betrieben und Aktivitäten abgerechnet werden, welchen Sektoren Priorität eingeräumt, wie Regierung und Staatstätigkeit gesehen und das Volksvermögen gemessen wird. So findet beispielsweise der Wert, den das öffentliche Bildungswesen erzeugt, wenn dieses gebührenfrei ist, im Bruttoinlandsprodukt eines Landes keinen Niederschlag – wohl aber die Kosten der Lehrergehälter. Da ist es ganz natürlich, dass so viel von öffentlichen „Ausgaben“ die Rede ist, wo es sich um öffentliche Investitionen handelt. Diese Logik erklärt auch, warum der damalige CEO von Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, 2009 – gerade mal ein Jahr, nachdem seine Firma zehn Mrd. US-Dollar staatlicher Rettungsgelder erhalten hatte – behaupten konnte, ihre Beschäftigten zählten „zu den produktivsten der Welt“. Schließlich müssen, wenn Wert gleich Preis ist und das Einkommen von Goldman Sachs pro Beschäftigtem zu den höchsten weltweit gehört, diese zu den produktivsten der Welt zählen. Um den Status quo zu verändern, bedarf es einer neuen Antwort auf die Frage „Was ist Wert?“. Dabei kommt es entscheidend darauf an, zu erkennen, wie viel und welches Maß an Kreativität eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure überall in der Wirtschaft in diese investieren – nicht nur Unternehmen, sondern auch Beschäftigte und öffentliche Einrichtungen. Allzu lange ist man wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass es der Privatsektor sei, der vor allem für Innovation und Wertschöpfung sorgt – und deshalb auch die resultierenden Profite für sich beanspruchen könne.
Doch das stimmt nicht. Medikamente, Internet, Nanotechnologie, Atomkraft, erneuerbare Energien: Sie alle wurden mit enormen öffentlichen Investitionen und Risikoübernahme auf dem Rücken zahlloser Arbeiterinnen und Arbeiter entwickelt – und Dank öffentlicher Infrastruktur und Institutionen. Den gewaltigen Beitrag dieser kollektiven Anstrengung anzuerkennen würde es erleichtern, alle Leistungen angemessen zu vergüten und Innovationsgewinne gerechter zu verteilen. Der Weg zu einer symbiotischeren Partnerschaft zwischen öffentlichen und privaten Institutionen beginnt mit der Anerkennung der Tatsache, dass Wertschöpfung eine Kollektivleistung ist.
Abgesehen von der Notwendigkeit, den Wert-Begriff zu überdenken, müssen die Gesellschaften den langfristigen Stakeholder-Interessen Vorrang vor den kurzfristigen Interessen von Shareholdern, also Aktionären, einräumen. In der gegenwärtigen Krise sollte das bedeuten, eine Art „Volksimpfstoff“ gegen Sars-Cov-2 zu entwickeln, der allen Menschen weltweit zugänglich ist. Die Entwicklung neuer Medikamente wäre so zu regulieren, dass die Zusammenarbeit und Solidarität zwischen Ländern und Völkern gefördert wird – sowohl während der Forschungs- und Entwicklungsphase als auch wenn die Zeit reif ist, den Impfstoff auszuteilen. Patente sollten zwischen Universitäten, staatlichen Forschungseinrichtungen und Privatunternehmen derart gepoolt werden, dass Erkenntnisse, Daten und Technologie frei rund um den Globus fließen können. Ohne all dies besteht die Gefahr, dass ein Monopol den Corona-Impfstoff produziert und teuer verkauft – als eine Art Luxusartikel, den sich nur die reichsten Länder und Individuen leisten können.
Die Rettungsaktionen greifen zu kurz
Allgemeiner gesehen sollten die Staaten öffentliche Investitionen auch weniger wie Zuteilungen handhaben, sondern mehr als Versuche, den Markt im Sinne des Gemeinwohls zu gestalten, Staatshilfen also an Bedingungen knüpfen. Während der Pandemie sollten diese Auflagen vor allem drei Zielen dienen: Erstens der Erhaltung von Arbeitsplätzen, um die Produktivität der Wirtschaft und die Einkommenssicherheit der Haushalte zu schützen; zweitens der Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch die Gewährleistung von Sicherheit, anständigen Löhnen, hinreichender Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und mehr Mitsprache bei der Entscheidungsfindung; drittens sollten sie Fortschritte bei der Lösung langfristiger Aufgaben anstreben, etwa bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und bei der Nutzbarmachung der Digitalisierung im öffentlichen Dienstleistungssektor, vom Gesundheitswesen bis zu Personen- und Güterverkehr. Die Reaktion der Vereinigten Staaten auf Sars-Cov-2 – hauptsächlich das im März vom Kongress beschlossene CARES-Gesetz (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) – läuft unter jedem der genannten Gesichtspunkte auf das genaue Gegenteil hinaus. Statt wie in den meisten fortgeschrittenen Ländern wirksame Lohnfortzahlungsmaßnahmen zu ergreifen, bot CARES lediglich befristete Arbeitslosenhilfen. Diese Entscheidung bewirkte die Entlassung von mehr als dreißig Millionen Beschäftigten und bescherte den USA so eine der höchsten Pandemie-bedingten Arbeitslosenraten in der entwickelten Welt. Dass der Staat großen Konzernen Billionen Dollar sowohl an direkter als auch an indirekter Unterstützung zukommen ließ, ohne sie mit sinnvollen Auflagen zu verknüpfen, verleitete viele Unternehmen zu Entscheidungen, die zur Ausbreitung des Virus beitragen konnten, etwa indem sie ihren Beschäftigten Lohnfortzahlung im Krankheitsfall verweigerten oder die Sicherheit am Arbeitsplatz vernachlässigten.
Zwar führte das CARES-Gesetz auch ein Paycheck Protection Program ein. Dieses gewährt Unternehmen Kredite, die sie, wenn sie auf Entlassungen verzichten, nicht zurückzahlen müssen. Doch in der Praxis erwies das PPP sich eher als massive Finanzspritze für Firmenschatullen denn als effektive Methode der Arbeitsplatzsicherung. Jeder kleine Arbeitgeber – und nicht nur Hilfebedürftige – konnte einen solchen Kredit erhalten, und der Kongress lockerte alsbald die Auflagen, wie viel davon eine Firma für Lohnzahlungen verwenden muss, um das Geld nicht zurückzahlen zu müssen. Im Ergebnis bewirkte das Programm nicht mehr als eine erbärmlich kleine Delle in der Arbeitslosenstatistik. Ein MIT-Team kam zu dem Schluss, dass unter dem PPP 500 Mrd. an Krediten vergeben, aber nur 2,3 Mio. Arbeitsplätze für rund sechs Monate gerettet wurden. Unter der Annahme, dass die meisten dieser Kredite letztendlich erlassen werden, belaufen die Kosten des Programms sich auf grob geschätzt 500 000 US-Dollar pro Job und Jahr. Im Sommer liefen sowohl das PPP als auch die Arbeitslosenhilfen aus, während die Arbeitslosigkeitsrate immer noch die Zehnprozentmarke überstieg.
Der Kongress hat bislang über drei Billionen US-Dollar für die Bekämpfung der Pandemie bewilligt, und die Fed, die US-Notenbank, pumpte weitere vier Billionen in die Wirtschaft. Zusammengerechnet handelt es sich da um über 30 Prozent des US-BIP. Doch diese ungeheuren Aufwendungen haben buchstäblich nichts zur Auseinandersetzung mit dringlichen Langzeitproblemen beigetragen, vom Klimawandel bis zur sozialen Ungerechtigkeit. Als Senatorin Elizabeth Warren, Demokratin aus Massachusetts, vorschlug, die Rettungsmaßnahmen mit Auflagen zu verknüpfen – um höhere Löhne und mehr Entscheidungsmacht für Lohnabhängige einerseits, Einschränkungen bei Dividenden, Aktienrückkäufen und Manager-Bonussen andererseits zu erreichen – konnte sie dafür keine Mehrheit gewinnen.
Die Staatsintervention zielte im wesentlichen darauf, einen Zusammenbruch des Arbeitsmarkts zu verhindern und Unternehmen als produktive Akteure zu erhalten – im Kern also, die Rolle einer Katastrophenschutz-Versicherung zu übernehmen. Es kann jedoch nicht zugelassen werden, dass der Staat dadurch verarmt, und ebenso wenig, dass die öffentlichen Gelder zur Finanzierung destruktiver Unternehmensstrategien missbraucht werden. Wo es zu Insolvenzen kommt, könnte der Staat erwägen, Anteile an den Unternehmen, die er rettet, einzufordern. So geschah es 2008, als das US-Schatzamt Anteile an General Motors und anderen gefährdeten Firmen übernahm. Und wenn der Staat Unternehmen rettet, sollte er dies mit Auflagen verbinden, die üble Praktiken aller Art verbieten: unzeitgemäße Bonus-Auszahlungen, exzessive Dividenden, Aktienrückkäufe, überflüssige Kreditaufnahme, Gewinnauslagerung in Steuerparadiese ebenso wie politische Lobbying-Aktivitäten zweifelhafter Natur. Außerdem sollte Schluss damit sein, dass Unternehmen Preiswucher betreiben, insbesondere im Fall der Corona-Impfstoffe und Behandlungsmethoden bei Covid-19.
Andere Länder demonstrieren, wie eine angemessene Reaktion auf die Krise aussehen sollte. Als Dänemark zu Beginn der Pandemie anbot, Lohnkosten zu 75 Prozent zu übernehmen, tat es dies unter der Bedingung, dass die begünstigten Firmen keine betriebsbedingten Entlassungen vornehmen dürften. Die dänische Regierung weigerte sich auch, solche Unternehmen zu retten, die in Steuerparadiesen registriert sind, und verbot es, staatliche Rettungsmittel für Dividenden und Aktienrückkäufe zu verwenden. In Österreich und Frankreich wurden Fluggesellschaften unter der Bedingung gerettet, dass sie ihren CO2-„Fußabdruck“ reduzieren.
Die britische Regierung hingegen verschaffte der Firma easyJet im vergangenen April Zugriff auf Liquidität in der Größenordnung von über 750 Mio. US-Dollar, obwohl diese Fluggesellschaft nur einen Monat davor 230 Mio. als Dividenden an ihre Aktionäre ausgeschüttet hatte. London berief sich zur Begründung dafür, warum es seine Rettungsmaßnahmen für easyJet und andere Unternehmen an keinerlei Bedingungen knüpfte, auf das Prinzip der „Marktneutralität“, demzufolge es nicht Aufgabe des Staates ist, Privatunternehmen vorzuschreiben, wofür sie ihr Geld ausgeben. Aber eine Rettungsaktion kann niemals neutral sein: Ein „Bailout“ impliziert per definitionem, dass der Staat dieser einen Firma – und keiner anderen – eine Katastrophe erspart. Ohne Auflagen läuft staatliche Hilfe Gefahr, schlechte Geschäftspraktiken zu subventionieren, von ökologisch nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen bis zur Kapitalflucht in Steuerparadiese. Die britische Beurlaubungsregelung, nach der der Staat für bis zu 80 Prozent der Löhne und Gehälter zwangsbeurlaubter Beschäftigter aufkommt, hätte allermindestens mit der Bedingung verknüpft werden sollen, dass die Beschäftigten nicht entlassen werden dürfen, sobald das Programm ausläuft. Doch nichts dergleichen geschah.
Wir müssen weg von der risikokapitalistischen Mentalität
Der Staat kann nicht einfach nur investieren. Er muss einen Deal aushandeln, der stimmt. Um das zu können, muss er anfangen, unternehmerisch zu denken – wie ein Akteur, den ich als „entrepreneurial state“ bezeichne, und der, wenn er investiert, zugleich sicherstellt, dass er nicht nur die Risiken privatwirtschaftlicher Aktivitäten abfedert oder übernimmt, sondern auch seinen Anteil am Erfolg bekommt. Eine Möglichkeit dazu besteht darin, wenn er Deals aushandelt, dabei selbst auch Geschäftsanteile zu übernehmen. Nehmen wir den Fall der Solarfirma Solyndra, der das U.S. Department of Energy (DOE) einen 553 Mio. Dollar-Kredit garantierte, bevor diese 2011 Pleite ging und im konservativen Diskurs zum Schlüsselbeispiel für die Unfähigkeit des Staates avancierte, in „winners“ zu investieren. Um dieselbe Zeit übernahm eben dieses Energieministerium eine Kreditbürgschaft über 465 Mio. US-Dollar für Tesla, dessen Wachstumsraten weiterhin explodierten. Die Steuerzahlerinnen und -zahler kamen also für das Scheitern von Solyndra auf, wurden aber nie für ihren Anteil an Teslas Erfolgen belohnt. Jedem Risikokapitalisten würde die pure Selbstachtung es verbieten, Investitionen so zu strukturieren. Schlimmer noch: Das DOE strukturierte den Tesla-Kredit so, dass ihm, sollte Tesla den Kredit nicht zurückzahlen können, drei Mio. Aktien des Unternehmens zukämen. Auf diese Weise sollte dafür gesorgt werden, dass die Steuerzahler nicht am Ende mit leeren Händen daständen. Doch warum sollte der Staat an einem scheiternden Unternehmen beteiligt sein wollen? Eine klügere Strategie wäre umgekehrt verfahren und hätte von Tesla verlangt, im Erfolgsfall – sobald die Firma den Kredit zurückzahlen könne – den Staat mit drei Mio. Aktien geschäftlich zu beteiligen. Hätte der Staat das getan, würde er Dutzende von Mio. Dollars verdient haben, als der Aktienkurs der Firma während der Laufzeit des Kredits durch die Decke ging. Dieses Geld hätte die Kosten des Solyndra-Scheiterns decken können, und es wäre noch viel für die nächste Investitionsrunde übriggeblieben. Dabei geht es gar nicht in erster Linie darum, sich über den monetären Ertrag öffentlicher Investitionen Gedanken zu machen. Es geht vielmehr auch darum, dass der Staat, wenn er ins Wirtschaftsgeschehen eingreift, seine Interventionen an strenge Bedingungen knüpfen sollte, um sicherzustellen, dass sie dem öffentlichen Interesse dienen. Bei Medikamenten, die mit staatlicher Unterstützung entwickelt werden, sollte diese Investition bei der Preisgestaltung berücksichtigt werden. Die Patente, die der Staat erteilt, sollten klar umrissen und leicht zu erlangen sein, um auf diese Weise Innovationen und Unternehmergeist zu fördern, statt Anreize zu setzen, Renteneinkommen zu suchen.
Staatliche Entscheider sollten auch in Betracht ziehen, wie die Erträge ihrer Investitionen zur Förderung einer gerechteren Einkommensverteilung eingesetzt werden können. Hier geht es nicht um Sozialismus, sondern darum zu begreifen, worin die Quelle kapitalistischer Profite besteht. Die gegenwärtige Krise hat neuerliche Diskussionen über ein allgemeines Grundeinkommen ausgelöst, wonach alle Bürger vom Staat regelmäßig eine für alle gleiche Summe ausbezahlt bekommen, unabhängig davon ob sie erwerbstätig sind oder nicht. Die zugrundeliegende Idee ist gut, aber das skizzierte Narrativ wirft Probleme auf. Da das allgemeine Grundeinkommen als „handout“, als Zuwendung gilt, verewigt es die irrige Vorstellung, allein der Privatsektor schaffe wirtschaftlichen Reichtum, statt ihn als einen – unter anderen – der am Wertschöpfungsprozess Beteiligten wahrzunehmen. Der öffentliche Sektor respektive der Staat gilt in dieser Sicht als bloßer Steuereintreiber, der Gewinne abschöpft, um sie in Gestalt sozialer Wohltaten umzuverteilen.
Eine bessere Alternative ist eine Bürger-Dividende. Bei diesem Verfahren transferiert der Staat einen bestimmten Prozentsatz des durch staatliche Investitionen geschaffenen Reichtums in einen Fonds, um die Erträge dann mit dem Volk zu teilen. Die Idee besteht darin, die Bürger unmittelbar an dem von ihnen geschaffenen Reichtum zu beteiligen. So hat beispielsweise Alaska seit 1982 durch seinen Permanent Fund seinen Einwohnern eine jährliche Dividende aus dessen Öleinkünften gezahlt. Auch Norwegen verfährt mit seinem Staatlichen Pensionsfonds so. Kalifornien könnte als Sitz einiger der reichsten Unternehmen der Welt Ähnliches erwägen. Als Apple, dessen Hauptsitz das kalifornische Cupertino ist, in Reno (Nevada) eine Filiale eröffnete, um davon zu profitieren, dass dieser Bundesstaat keine Körperschaftssteuern erhebt, entgingen Kalifornien fortan enorme Steuereinnahmen. Abgesehen davon, dass derartige Steuervermeidungstricks unterbunden werden sollten, könnte Kalifornien sich auch durch die Schaffung eines Staatsfonds der beschriebenen Art wehren. So könnte es, neben der Besteuerung der dort groß gewordenen Unternehmen, auch einen Teil des durch diese und ihre staatlich geförderten Technologien erzeugten Reichtums unmittelbar abschöpfen. Eine Bürgerdividende gestattet es, in der Kooperation von öffentlichen und privaten Akteuren geschaffenen Reichtum mit der ganzen Gesellschaft zu teilen – sei es, dass dieser Reichtum natürlichen Ressourcen entspringt, die Teil der Allmende sind, oder einem Prozess, der kollektive Anstrengungen involviert, etwa in Form staatlicher Investitionen in pharmakologische Forschung oder Digitaltechnologien. Diese Art Dividende soll den Staat nicht etwa von der Aufgabe entbinden, das Steuersystem so in Ordnung zu bringen, dass es richtig funktioniert. Und schon gar nicht sollte er das Nichtvorhandensein solcher Mittel als Entschuldigung dafür anführen, dass er zentrale öffentliche Aufgaben und Einrichtungen nicht finanziert. Ein Staatsfonds kann – als ausdrückliche Würdigung des öffentlichen Anteils an wirtschaftlicher Wertschöpfung – einen Wandel jenes Narrativs bewirken, das im politischen Machtspiel der gesellschaftlichen Akteure eine Schlüsselrolle spielt.
Hin zu einer aufgabenorientierten Wirtschaftsweise
Wenn der öffentliche und der Privatsektor zusammenfinden, um ein gemeinsames Vorhaben zu realisieren, können sie Außerordentliches leisten. So etwa das Apollo-Programm der Vereinigten Staaten, das der Mondflug im Jahre 1969 krönte: Acht Jahre lang hatten die NASA und Privatunternehmen so unterschiedlicher Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Textil und Elektronik kooperiert, gemeinsam investiert und innoviert. Durch ihre Kühnheit und Experimentierfreude bestanden sie „das gewagteste, gefährlichste und größte Abenteuer, zu dem die Menschheit je auszog“, wie Präsident John F. Kennedy formulierte. Worauf es ankam, war nicht die Kommerzialisierung bestimmter Technologien oder gar, das Wirtschaftswachstum zu stimulieren. Es ging darum, etwas gemeinschaftlich zustande zu bringen. Mehr als fünfzig Jahre danach hat die Welt, mitten in einer globalen Pandemie, die Chance, einen noch ambitionierteren „Mondflug“ zu wagen: nämlich eine bessere Wirtschaftsweise zu schaffen. Diese wäre zugleich inklusiver und nachhaltiger. Sie würde weniger CO2 emittieren, weniger Ungleichheit erzeugen, moderne Verkehrssysteme schaffen, jeder und jedem Zugang zur digitalen Welt ermöglichen und ein Gesundheitswesen bereitstellen, das für alle gleichermaßen da ist. Auf kürzere Sicht würde sie einen Corona-Impfstoff jedermann verfügbar machen. Eine derartige Wirtschaftsweise zu entwickeln, erfordert einen Typus öffentlich-privater Zusammenarbeit, den wir seit Jahrzehnten nicht mehr kennen. Wenn es um die Erholung von der Pandemie geht, sprechen manche von einer Rückkehr zur Normalität. Das klingt gut, ist aber das falsche Ziel. „Normal“ funktioniert nicht mehr. Das Ziel sollte vielmehr, wie viele fordern, „build back better“ lauten: es künftig besser zu machen. Vor nunmehr zwölf Jahren eröffnete die Finanzkrise unverhofft die Chance, den Kapitalismus grundlegend zu verändern, doch sie wurde vertan. Jetzt bietet eine andere Krise wiederum die Chance der Erneuerung. Diesmal kann die Welt es sich nicht leisten, sie zu vergeuden.
Deutsche Erstveröffentlichung eines in der „Foreign Affairs“, 11-12/2020, erschienenen Textes. Die Übersetzung stammt von Karl D. Bredthauer.
[1] Vgl. Mariana Mazzucato, High cost of new drugs, www.bmj.com, 27.7.2016.