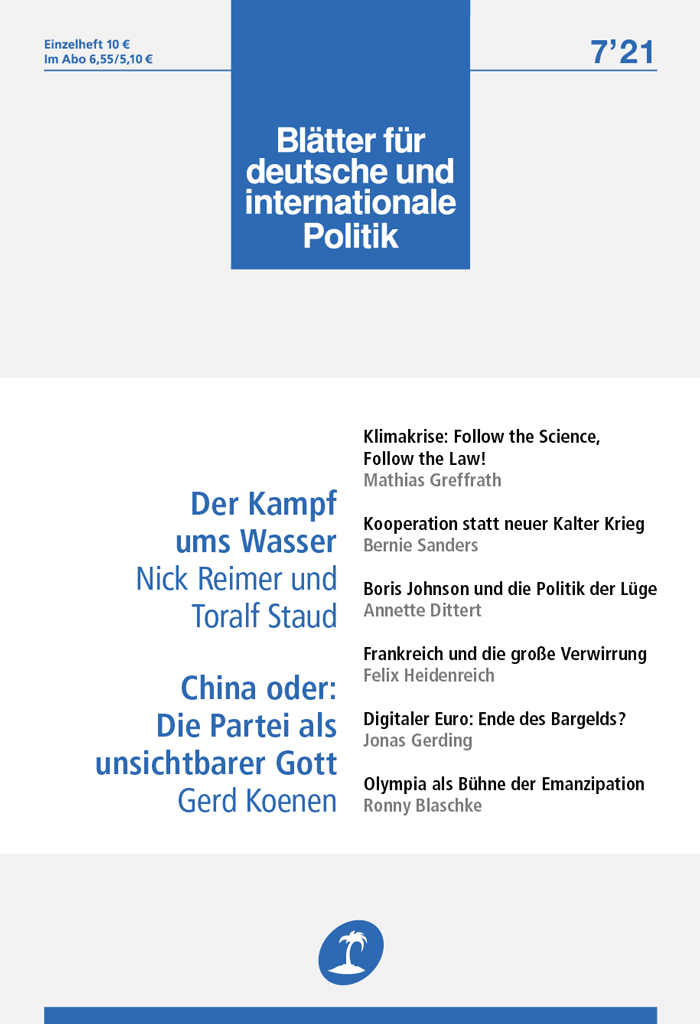Die Klimakrise und die Zukunft des Staates

Bild: Extinction-Rebellion-Aktivisten protestieren außerhalb Strafgericht in Dublin/Irland, um auf die Untätigkeit des Staates angesichts der Klimakrise aufmerksam zu machen, 25.5.2021 (IMAGO / NurPhoto)
Nichts wird danach so sein, wie es vorher war.“ „Die Krise ist eine Chance.“ „Der Staat ist zurück.“ Drei Sätze, die aufkamen, kaum dass im letzten Frühjahr die ersten Corona-Toten gemeldet wurden.
Im ersten großen Schock, angesichts der Bilder aus Bergamo und New York, griffen nicht nur die üblichen feuilletonistischen Epochendeuter zum ganz großen Begriffsbesteck: Eine „weltgeschichtliche Zäsur“ hin zu einer solidarischen Weltgesellschaft sah der Soziologe Heinz Bude und schrieb vom „Ende der neoliberalen Epoche“ – weil die Räder des Kapitalismus seuchenbedingt global stillstanden. Und manche sahen bereits voraus, dass der Kampf gegen die Coronakrise ein mögliches Vorbild für die Bewältigung der noch weit größeren Klimakrise sein könnte.
Auf der anderen Seite erkannte Friedrich Merz die Chance, nach dem Ende der erzwungenen Produktionspause endlich volldigitales superdynamisches Turbowachstum mit mehr Entlassungen und Steuererleichterungen und weniger Sozialausgaben und Genehmigungsverfahren zu entfachen.
Heute wissen wir: Die radikalen Fantasien blieben Wunschdenken. Keine Chance für große Wenden. Dabei wäre Corona wirklich eine Chance gewesen für politische Vorstöße. Gesellschaft und Staat könnten sich in der Coronakrise warmlaufen für die Energiewende und die Transformation zur postfossilen Weltgesellschaft, so hoffte ein Physiker und Mitglied der Leopoldina. So hofften viele.
Und tatsächlich: Ausgangs- und Versammlungsverbote, Stilllegung der wirtschaftlichen Aktivitäten bei Sicherung der Einkommen, Bazooka statt Schuldenbremse, Impfzentren aus dem Boden gestampft, Pop-up-Radwege. Es geht doch, war der Tenor vieler Kommentare, aber eigentlich müsste man über das Staunen staunen. Denn die Einschränkungen waren mitnichten eine „demokratische Zumutung“, wie Angela Merkel sagte, kein Ausnahmezustand, sondern die Behörden agierten ganz legal aufgrund der Paragraphen 28, Absatz 1 und 32 des Infektionsschutzgesetzes, so gut sie es konnten.
Und das allerdings war beileibe nicht immer gut. Die Mängelliste wurde im Laufe des Jahres immer länger: die Sparmaßnahmen in den Gesundheitsämtern, wo sie noch im Fax-Zeitalter lebten, die Entlohnung in den Pflegeheimen, von denen schon 20 Prozent internationalen Investorenfonds Profit zuführen, Tendenz steigend. Die kaputtgesparten Statistikabteilungen bei Bund, Ländern und Kommunen, die dazu führten, dass die Politik weniger über die Bedürfnisse und die soziale Lage der Bürger weiß als Facebook; vom Phantasiemangel so vieler Schulverwaltungen ganz zu schweigen. Kurzum, plötzlich entstand der Eindruck, der Staat – als die Agentur des Allgemeinwohls – ist nicht zurück, der Staat ist am Ende.
Keine starke Lobby für das Gemeinwohl
„Der Staat ist tot“: 1971, schon vor einem halben Jahrhundert und neun Jahre nachdem Rachel Carson ihr Buch „Silent Spring“ über den drohenden Öko-Kollaps geschrieben hatte, erschien in Deutschland ein Buch des konservativen Staatsrechtlers Ernst Forsthoff. „Es ist an der Zeit“, so schrieb Forsthoff, „das überkommene Verständnis des Staates zu verabschieden.“ Forsthoff zieht damit die Konsequenz aus der Abhängigkeit, in die der „Staat der Industriegesellschaft“ von den organisierten Wirtschaftsinteressen geraten ist. „Nach demokratischen Grundsätzen“, schreibt er, „erscheint die Annahme als zwingend, dass die Realisierungschance eines Interesses umso größer ist, je zahlreicher diejenigen sind, die an diesem Interesse Anteil haben, und dass ein Interesse Aller die sicherste Gewähr alsbaldiger Verwirklichung haben muss. Diese Annahme wird von der Wirklichkeit widerlegt.“
Forsthoff analysiert das Paradox, dass gerade das Gemeinwohl in einer pluralistischen Demokratie keine starke Lobby hat; er zählt die Gefährdungen von Natur und Mensch durch die Industriegesellschaft auf – von der Verschmutzung der Atmosphäre und der Meere bis hin zur gentechnischen Veränderung des Menschen selbst, und er schließt: „Dass die Industriegesellschaft sich […] Schranken selbst auferlegen werde, ist mit den Funktionsgesetzen der Industriegesellschaft“ – also mit dem Wachstumszwang – „unvereinbar und utopisch. [...] Das Verhängnis könnte nur durch eine organisierte Instanz abgewendet werden, die stark genug ist, der industriellen Expansion notwendige Schranken zu setzen […] welche die Erfordernisse eines geordneten menschlichen Zusammenlebens gebieten.“ Die Instanz also, die wir in Europa 400 Jahre lang „Staat“ genannt haben.
Ernst Forsthoffs konservativer Hilferuf ist in den Jahrzehnten der großen Beschleunigung immer aktueller geworden. Eine die Welt umspannende neue, intensive Form der Arbeitsteilung, die Globalisierung von Kommunikation und Konsummustern haben die Souveränität der Nationalstaaten unterspült. Die Liberalisierung des Handels durch die Welthandelsorganisation und die Befreiung der Finanzmärkte von nationalen Schranken hat die Weltordnung jenem „wirtschaftsfördernden Weltstaat“ nähergebracht, von dem die Ultraliberalen schon immer geträumt haben – einem globalen Marktstaat, in dem die Nationalstaaten nur noch die Aufgabe haben, die Verwertungsbedingungen des Kapitals regional zu sichern und die Folgen – Arbeitslosigkeit, soziale Unruhen, Ungleichgewichte – zu bearbeiten.
Mit Computer, Handy, Internet und Automatisierung begann ein weiterer großer Zyklus der Weltwirtschaft, nach Dampfmaschine, Automobil, Elektromotor und Chemie. Und mit dieser Beschleunigung zugleich gerieten ihre Grenzen in Sicht.
Das Pariser Abkommen als welthistorischer Durchbruch
Vor über 30 Jahren, 1990, als George Bush die neue Weltordnung ausgerufen hatte, erschien der erste Sachstandsbericht des Weltklimarates IPCC zur Erwärmung der Atmosphäre, eine Enquete-Kommission des Bundestages zum Schutz der Erdatmosphäre hatte schon 1988 die Arbeit aufgenommen. Drei Jahrzehnte lang wurden dann die Warnungen der Ökologen, die Erkenntnisse der Klimaforschung von den großen CO2-Verursachern verleugnet, mit Gegengutachten und Propagandakampagnen, bezahlten Experten und politischer Erpressung neutralisiert.
Erst nach einem Vierteljahrhundert brach der Widerstand zusammen. Als sich am 12. Dezember 2015 in Paris 195 Staaten der Weltgemeinschaft verpflichteten, die Kohlenstoff-Emissionen bis 2050 auf null zu bringen, um die 1,5-Grad-Grenze nicht zu überschreiten. Nur so – das ist die physikalisch berechenbare Konsequenz, die nicht mehr bestreitbar ist –, nur so kann eine Erwärmung der Erde um drei bis sechs Grad vermieden werden, und das würde – so der letzte Bericht des IPCC – zu unvorstellbarem Elend führen, wenn auch nicht gleichmäßig verteilt über den Globus.
Dieses Pariser Abkommen von 2015 war ein welthistorischer Durchbruch. Die Tränen der Verhandler kamen aus der Erkenntnis, dass hier etwas Grundsätzliches erreicht worden war: eine Verpflichtung aller Regierungen der Welt auf global koordiniertes Handeln. Die Formulierung einer Herkulesarbeit: die politische Gestaltung eines Epochenbruchs. Wie hieß das bei Marx: „Mit der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen wälzt sich der ganze ungeheure Überbau (von Politik und Recht und Denkweisen) langsamer oder rascher um.“
Mochten frühere Epochenbrüche dieser Logik gefolgt sein – erst die Basis, dann der Überbau – die Klimakrise zwingt uns, dieses Verhältnis auf den Kopf zu stellen: Die Denkweisen und die Politik und das Recht müssen vorangehen und die ungeheure Basis, die ökonomischen Produktionsbedingungen umwälzen. Und diesmal haben die Gesellschaften nicht 200 Jahre Zeit wie am Anfang der Neuzeit, um eine neue Epoche einzuleiten. It’s not economy, it‘s the law, stupid. Für die Durchsetzung des Rechts aber sind, bis auf weiteres, nur die Nationalstaaten ausgerüstet.
Vier Jahre brauchte der Bundestag nach dem Pariser Beschluss und seinem Alarmruf, bis er ein Gesetz verabschiedete, getrieben von einem Jahr Schülerstreik und weltweiten, millionenstarken Demonstrationen. Es war das Jahr des gewaltfreien Bürgerkriegs der Argumente, der Lobbyarbeit, bis am 19. September 2019 allein am Brandenburger Tor 200 000 Menschen demonstrierten, einen Abend danach verabschiedete das Parlament hastig ein Klimaschutzgesetz, das selbst die industrienahen Wirtschaftsinstitute für „lasch“ erklärten.
Schwerfällig ist der parlamentarische Prozess, wenn es darum geht, langfristig wirkende Maßnahmen zu beschließen, und noch schwerfälliger, wenn es um allgemeine Interessen geht. Schwerfällig. Das Wort steht in einem 160 Seiten langen Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. April 2021, mit dem das Gericht in diesem Frühjahr das Klimagesetz als ungenügend zurückverweist.
Nullemissionen bis 2050 oder Klimakatastrophe
Schwerfällig der Prozess und unentschlossen seine Akteure: So schaffte es Angela Merkel in den bald 16 Jahren ihrer Amtszeit wieder und wieder, in einem Atemzug die Dramatik der Welterhitzung zu bestätigen und zugleich auf einen angeblichen Mechanismus der Demokratie zu verweisen – demzufolge man alle Menschen mitnehmen müsse, auch die Konservativen, die keine Windräder wollen, und auch die Zweifler, die immer noch glauben, die atmosphärische Aufheizung komme von der Sonne.
Merkels Schutzbehauptung verdient es, sehr wörtlich und sehr ernst genommen zu werden. In ihr offenbart sich ein verkürztes, um nicht zu sagen pervertiertes Verständnis von repräsentativer Demokratie und vom Staat. Denn das Parlament soll gerade nicht das Parallelogramm der gesellschaftlichen Kräfte abbilden, soll nicht Aufträge von Interessengruppen erfüllen, sondern das Wohl des gesamten Volkes ermitteln und die Regierung beauftragen, das Notwendige durchzusetzen. So weit die klassische Demokratietheorie – die immer noch in den Schulen gelehrt wird und die zwangsläufig zu Enttäuschungen und Abwendung führen muss.
„Politiker“, so schreibt es der Staatsrechtler Christoph Möllers, müssen „die Freiheit haben, der Gemeinschaft, die sie repräsentieren, entgegenzutreten, um ihr zu widersprechen, sie zu belehren, sie ‚normativ zu fordern‘ oder im Rahmen ihres Mandats gegen ihren vermeintlichen oder wirklichen Willen zu entscheiden. Die Verachtung gegenüber Politik ist vielleicht auch durch einen Mangel an solchem politischen Freiheitsbewusstsein verursacht, aus der Servilität gegenüber dem vermeintlichen Volkswillen, der diesem noch nicht einmal gefällt.“ Nicht gefällt, so könnte man Möllers hinzufügen, in dem Maße, in dem das Volk, die Bürger, die Wähler mehrheitlich darüber aufgeklärt sind, was tatsächlich notwendig ist. Und in unserer Zeit ist das: Nullemissionen bis 2050 oder Klimakatastrophe.
Ja, es gibt ökologische Kipppunkte, jenseits derer das natürliche System wegrutscht. Gibt es aber auch politische Kipppunkte, die ein epochales Gesellschaftssystem kippen lassen?
Vielleicht erleben wir gerade so etwas. „Follow the Science“, das war die Parole von Greta Thunberg, als die damals 15jährige sich 2018 zum Streik vor das schwedische Parlament setzte und eine Politik forderte, die sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert. Das führte zur Gründung von Fridays for Future. Deren Demonstrationen am Rande des Schulrechts beschleunigten die Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes in Deutschland, konnten aber nicht verhindern, dass dieses Gesetz weit hinter dem zurückblieb, was Wissenschaftler, ja was die eigenen Umweltagenturen der Regierung für notwendig hielten. Und nun heißt die Devise: „Follow the Law“.
Ein großer Moment in der Rechtsgeschichte
Sophie Backsen, 21jährige Agrarstudentin und Bauerstochter auf der von Überflutung bedrohten Nordseeinsel Pellworm, ging vors Verfassungsgericht – mit hunderten anderer Kläger, aus Deutschland, aus Bangladesh. Und sie bekam recht – gegen die fossile Wachstumswirtschaft und deren Aufsichtsorgan, die deutsche Regierung.
Das deutsche Bundesverfassungsgericht erklärte das Klimaschutzgesetz für ungenügend und verpflichtete das Parlament zu einer präziseren Planung der Zukunft. Staatliche Handlungen oder Unterlassungen, deren Folgen erst in 20 Jahren oder noch später eintreten werden, dürfen die „intertemporalen Freiheitsrechte“ der Bürger nicht beschränken, so das Gericht.
Das Urteil war ein großer Moment in der Rechtsgeschichte. Man könnte fast sagen: Die Erdatmosphäre ist auf dem Weg, rechtsmündig zu werden. Wenn sich genug Bürger finden, die ihre Repräsentanten zur Verantwortung ziehen – für Handlungen, aber eben auch für Unterlassungen. Nicht nur auf den Plätzen und in Resolutionen, sondern in den Institutionen, für die in Europa 400 Jahre lang auf die Straße gegangen wurde – und in demokratischen Revolutionen Blut vergossen. Für die Herrschaft des Rechts.
Die Konsequenzen dieser Erweiterung von subjektiven Rechtsansprüchen sind noch nicht abzusehen. Wird der peruanische Bauer, der vor dem Oberlandesgericht Hamm gegen RWE klagt, weil sein Dorf von einem schmelzenden Gletscher bedroht ist, eine Entschädigung erhalten? Die Richter fahren immerhin demnächst zum Lokaltermin nach Peru.
Wenn der Jubel über das Klima-Urteil des Verfassungsgerichts verflogen ist, beginnt also die Arbeit – für Aktivisten, für Techniker, für Unternehmer und wiederum für Juristen. Vor allem die Juristen in den Parlamenten und Ministerien. Denn: In einer Gesellschaft, die sich nicht deindustrialisieren will, kann Klimaschutz nur durch den Aufbau einer postfossilen Energieversorgung erreicht werden.
Vor einigen Wochen stellten der Forschungsverband AgoraEnergiewende und der Mannheimer Ökonom Tom Krebs ein Szenario zur Dekarbonisierung des Industrielandes Deutschland vor, in dem Wasserstoffwirtschaft eine zentrale Rolle spielt – ohne Wasserstoff kann es keinen grünen Stahl, keine grüne Chemie und keine grüne Zementindustrie geben. Darüber herrscht Konsens. Um in Europa grünen Wasserstoff in hinreichender Menge zu produzieren, muss man Solarstrom aus Südeuropa und Nordafrika importieren. Sonst reicht es nicht. Das Ganze ist ein faszinierendes Projekt, technisch wie ökonomisch komplex, innen- wie außenpolitisch kompliziert.
Die Umrisse eines Zukunftsstaates
Es stellt die Politik vor die Wahl, die Klimaziele aufzugeben oder zum Initiator des Wasserstoffprojekts zu werden: als Finanzier der Anfänge, etwa über die Umrüstung der Bahn auf Wasserstoffzüge, und als Initiator der europäischen Wasserstoffautobahnen. Es ist eine ungleich größere Aufgabe als die Reparatur von Brücken und Dämmung von Häusern – und ein gigantisches Programm für Beschäftigung und Wachstum.
Es wäre eine zivile Mondmission – sinnvoller als der Wettlauf zum Mars, in den die Epochengestalten aus dem Silicon Valley, Elon Musk und Jeff Bezos, die Medici und Fuggers unserer Tage, ihre Milliarden stecken. Und es träte, am Beginn einer neuen Produktionsweise, in den historischen Wettbewerb mit Infrastruktur-Projekten, die am Anfang der industriekapitalistischen Epoche standen: etwa den Bau des Canal du Midi im Süden Frankreichs – 240 Kilometer in 14 Jahren mit 12 000 gut bezahlten Arbeitern, eine gigantische Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
Was Staat und Gesellschaft damals möglich war – in kürzester Zeit eine fortschrittliche Infrastruktur zu bauen – warum sollten wir es nicht können mit den so viel mächtigeren Maschinen? Mit erweiterten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und mit der Möglichkeit, die Bremser des Fortschritts mit dem sanften Zwang des Rechts zu entwaffnen. Noch einmal Marx: „Mit der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen wälzt sich der ganze ungeheure Überbau (von Politik und Recht und Denkweisen) langsamer oder rascher um.“
Die vergangene Epoche, die auf fossiler Energie beruhende, kapitalgetriebene Industriegesellschaft, beruhte auf der Verfügung der Staaten über die Infrastruktur, auf Unternehmensformen wie der Aktiengesellschaft, die große Kapitalmengen bewegen konnten, auf der Ausweitung der Eigentumsformen, etwa auf Patente und geistige Produkte, auf der Liberalisierung des Handels, auf der Bildung der Bevölkerung.
Die globale Aufgabe einer solaren Weltwirtschaft, die Bewahrung oder Wiederherstellung von intakter Natur und Artenvielfalt, ein Wohlstandsausgleich zwischen Nord und Süd, eine Industriepolitik, die es a tempo den armen Ländern ermöglicht, das Kohle- und Atomzeitalter zu überspringen und eine solare Infrastruktur aufzubauen, die Verhinderung der Spaltung fortgeschrittener Gesellschaften in Spezialkräfte und funktionale Analphabeten – alles das wird auch diese Rechtsformen nicht unverändert lassen können.
Aber die Rechtswissenschaft beginnt erst, die Umrisse eines Zukunftsstaates zu skizzieren. Umweltrecht, das nur die negativen Folgen des Kapitalismus sanktioniert, ist noch das Recht der alten Epoche; das ökologische Gesetzbuch, das Wirtschaft und Gesellschaft für die solare Welt regelt, das bleibt noch zu schreiben, und die Fristen, die das IPCC setzt, werden in ihm eine große Rolle spielen.
„Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet“, so steht es im Artikel 14 unseres Grundgesetzes, und weiter: „Der Gebrauch des Eigentums soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Und in Absatz 1, Satz 2 heißt es – man liest leicht darüber hinweg: „Inhalt und Schranken [des Eigentums] werden durch die Gesetze bestimmt.“ Und das heißt: Die Schranken des Eigentums sind politische Verhandlungssache; und sein Inhalt ist historisch bestimmt und deshalb veränderbar.
Etwas vergröbert könnte man sagen: Gemeineigentum, feudales Lehen, Kirchenbesitz mit ihren sozialen Verpflichtungen sind in den Revolutionen des Bürgertums vom subjektiven Recht des Eigentums überlagert worden. Das hat die Wettbewerbs- und Wachstumswelt der Industriegesellschaft befördert, den Kapitalismus befeuert. Das Recht der solaren Weltgesellschaft wird neue Formen des Eigentums kodifizieren müssen.
Neue Formen des Eigentums
„Damit das Eigentum nicht wegschmilzt“, sagt der Rechtsprofessor Jens Kersten, der mit seinem „Anthropozän-Konzept“ noch viel weiter geht und „juristische Waffengleichheit“ für die Natur vorschlägt und Tiere und Pflanzen als juristische Personen anerkennen will. Damit deren Rechte besser geschützt werden können etwa gegen das Recht der Aktiengesellschaften, die ja juristische Personen sind. Warum soll die Natur schlechter gestellt sein? Ein subjektives Recht der Bäume und Meere, das klingt noch utopisch, aber es wäre – auf ungleich, wenn nicht höherem, so doch anderem Niveau – eine Wiederkehr des Naturrechts, „welches“, so hieß es noch im 18. Jahrhundert, „einem jeden Menschen und einem jeden Dinge vermöge der Einrichtung seiner Natur oder seiner allgemeinen Beschaffenheit zukommt“.
Die bewusste Gestaltung des Übergangs zu einer weltweiten solaren Gesellschaft, das ist eine faszinierende und begeisternde Idee, so groß, dass man sie eigentlich eher auf den Stapel mit Denkschriftprosa legen möchte oder auf das Regalbrett mit den Science-Fiction-Phantasien.
Dort liegt seit einiger Zeit der dicke Roman „Das Ministerium für die Zukunft“ des amerikanischen Autors Kim Stanley Robinson, der schon eine Trilogie über die Besiedelung des Mars geschrieben und damit vielleicht Elon Musk und Jeff Bezos zu ihrem Männerwettlauf inspiriert hat; auch ein paar Klimaphantasien hat er geschrieben, in denen New York unter Wasser steht.
Hier geht es nun sehr konkret in 108 Kapiteln um die Erreichung der Klimaziele von Paris. Um eine UN-Exekutivbehörde, geleitet von einer Beamtin, die Ähnlichkeit mit zwei Diplomatinnen hat, die das Pariser Abkommen vorbereitet haben. Dieses „Ministerium für die Zukunft“ handelt mit einem Mandat der Ungeborenen – das geht schon etwas weiter als unser Verfassungsgericht.
Mit viel Technik, mit Gesetzen, mit Geheimdiplomatie, vor allem mit Zentralbankentscheidungen und einer neuen Weltwährungsordnung fördert es die Einlagerung von Kohlenstoff in die Erdkruste, und etwa um das Jahr 2050 beginnt der CO2-Gehalt der Atmosphäre tatsächlich zu sinken, nach Jahrzehnten von Hitzekatastrophen, Ökoterrorismus und fehlschlagenden Experimenten. Neue Formen von Landwirtschaft und solidarischem Zusammenleben entwickeln sich, sogar eine Wiederkehr von Wildnis, ganz ohne antikapitalistische Reform.
Die Herrschaft des Gesetzes und die Notwendigkeit der Parteipolitik
Das Faszinierende an Robinsons Buch, bei dessen Lektüre man nebenbei einiges über Technik, über moderne Geldtheorie, über Körperreaktionen auf 50-Grad-Temperaturen, über Physik und Blockchain-Technik lernt, das Faszinierende ist die Koexistenz von Technik, Politik und Moral. Alle Elemente dieser Antidystopie existieren bereits: Drohnen, die Bäume säen, wo Menschen nicht hinkommen; Zentralbanker, die Milliardenkredite an Klimaschutz binden, Genossenschaften, in denen nachhaltige Landwirtschaft und solidarische Umgangsformen zusammenkommen.
Vor allem aber, und erstaunlich in einer Science-Fiction-Phantasie: Das ganze Arrangement wird zusammengehalten durch ein starkes Vertrauen und Bekenntnis zur alten Institution des Rechts, zur Rule of Law, zur Herrschaft des Gesetzes. Robinson nimmt das Pariser Abkommen wirklich ernst und fordert dazu auf, es zum Zentrum des Denkens und des Engagements für die Zukunft zu machen.
Seine Heldin sagt: „Am Ende läuft es alles auf Gesetzgebung hinaus, wenn es darum geht, eine neue Ordnung zu schaffen, die gerecht, nachhaltig und sicher ist.“ Gesetze, das soziale Werkzeug der Menschheit, so alt wie der Pflug. „Sonst haben wir nichts in der Hand.“ – Hier ist die Hauptfront.
Und was folgt daraus für die ökologisch engagierten Mittelschichten? In den Worten des Verfassungsrechtlers Christoph Möllers: „Wer Demokratie und Freiheit für Lebensformen hält, wird sie nicht an das System delegieren und sich über dieses beklagen dürfen. […] Wer die Ordnung, so wie sie ist, für schützenswert hält, wird sich ihren politischen Formen anvertrauen müssen – und das bedeutet vor allem anderen, in politische Parteien einzutreten und einen relevanten Teil seiner Zeit in diesen zu verbringen.“ Mit anderen Worten: „Der Freiheit echter, rechter, letzter Sieg wird trocken sein.“ So schrieb es Gottfried Keller nach der Revolution von 1848. Er war im Hauptberuf Kommunalbeamter.
Dieser Text entstand für den Auftakt einer Trilogie des Autors für die Deutschlandfunk-Sendung „Essay und Diskurs“. Hör- und Schriftfassungen aller drei Sendungen sind unter dem Titel „Inventur und Neustart“ auf www.dlf.de abrufbar.