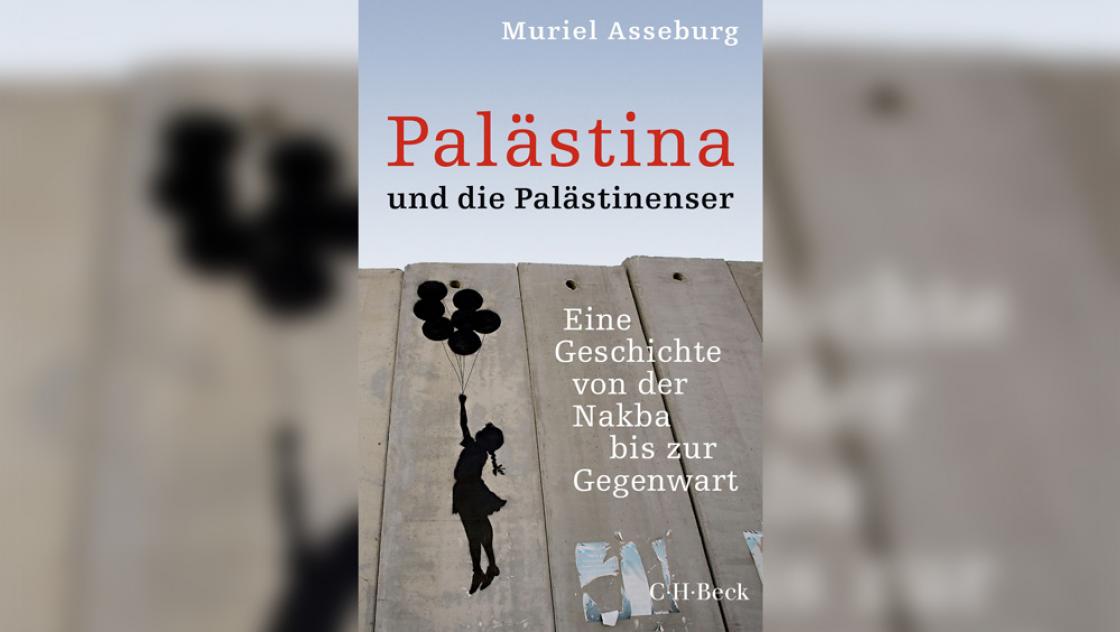
Bild: Muriel Asseburg: Palästina und die Palästinenser
Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina.“ In diesen Worten wird das ganze Problem deutlich: Ein britischer Außenminister verspricht einem britischen Zionisten den Aufbau eines Staates in einem Gebiet, in dem zu über 90 Prozent Nichtjuden leben. Die Balfour-Deklaration von 1917 bildet auch für Muriel Asseburg einen zentralen Ausgangspunkt ihrer Analyse des inzwischen über 100jährigen Streits um das Land zwischen Mittelmeer und Jordan, die nun unter dem Titel „Palästina und die Palästinenser“ vorliegt. Denn mit dem Untergang des Osmanischen Reiches am Ende des Ersten Weltkriegs übernahm, allen Reden vom Selbstbestimmungsrecht der Völker zum Trotz, nicht die lokale Bevölkerung das Sagen in Palästina, sondern die vom Völkerbund eingesetzte britische Mandatsmacht. Und diese fühlte sich der Balfour-Deklaration verpflichtet, auch wenn es ihr weniger um die Ziele der Zionisten als vielmehr um eigene Interessen ging. Palästina war für die Briten vor allem ein strategisch wichtiger Posten auf dem Handelsweg zwischen dem Vereinigten Königreich und der Kronkolonie Indien.
Die arabische Bevölkerung vor Ort fühlte sich übergangen. Zwischen 1919 und 1928 organisierte ein Zusammenschluss muslimisch-christlicher Gesellschaften sieben arabisch-palästinensische Kongresse. Dessen Forderungen waren klar: eine unabhängige Regierung auf Basis der Bevölkerungsmehrheit sowie das Ende jüdischer Immigration und Landkäufe. Kurzum: Nein zu Balfour! Doch die Eingaben bei der Pariser Friedenskonferenz 1919, die Petitionen an die Mandatsmacht und die Appelle an den Völkerbund blieben erfolglos.
Der jüdisch-arabische oder israelisch-palästinensische Konflikt, der im Zentrum von Asseburgs Buch steht, litt von Anfang an unter einer Asymmetrie: Auf der einen Seite stand eine hoch motivierte und organisierte Bewegung, mit guten diplomatischen Beziehungen auf internationaler Ebene, deren Ziel ein souveräner Nationalstaat nach europäischem Vorbild war; auf der anderen eine lokale Bevölkerung, die sich überhaupt erst in Abgrenzung zum zionistischen Projekt als Nation zu verstehen begann.
Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber für das Verständnis des Konflikts unverzichtbar. Neu allerdings sind einige Details, auf die Asseburg hinweist, beispielsweise die Plünderungen während des israelischen Unabhängigkeitskrieges zwischen 1947 und 1949, in dessen Verlauf rund 750 000 Araber vertrieben wurden. An diesen Plünderungen, so die Autorin, „waren nicht nur jüdische Guerillakämpfer und Soldaten, sondern auch ein erheblicher Teil der jüdischen Zivilbevölkerung“ beteiligt. Kleidung und Schmuck wurden genauso geraubt wie Vieh und landwirtschaftliche Geräte, letztlich alles, was die geflüchteten Araber zurückgelassen hatten, da sie davon ausgingen, nach Ende der Kampfhandlungen in ihre Häuser und Orte zurückzukehren. Dabei sei den Plündernden ihr unmoralisches Handeln sehr wohl bewusst gewesen. „Oftmals kannten sie die Besitzer der betreffenden Häuser und es war allgemein bekannt, dass die palästinensische Bevölkerung sich großenteils nicht aktiv an den Kämpfen beteiligt hatte.“
Dass sich die arabischen Nachbarstaaten mit Ausnahme Jordaniens weigerten – und dies bis heute tun –, die Flüchtlinge zu Staatsbürgern zu machen und ihnen damit eine Perspektive für eine neue Heimat zu bieten, ist aus Asseburgs Sicht legitim. Eine Integration der Palästinenser beispielsweise im Libanon hätte zu deutlichen Verschiebungen in der Bevölkerungszusammensetzung geführt und damit das fragile Gleichgewicht in Frage gestellt, auf denen das friedliche Zusammenleben zwischen den verschiedenen ethnischen und konfessionellen Gruppen im Zedernstaat basiert. Dieses Argument ist insofern aufschlussreich, als Israel sich aus dem gleichen Grund so vehement gegen das für die Palästinenser zentrale Recht auf Rückkehr wendet: Um jüdisch und demokratisch zu sein, darf sich die Demographie im jüdischen Staat nicht zu sehr zugunsten der arabischen Minderheit verschieben.
Die PLO in der Zwickmühle
Die Sicherung und Ausweitung des jüdischen Staates auf Kosten der Palästinenser sowie der palästinensische Widerstand dagegen, das sind die beiden Erzählstränge, die das Buch durchziehen, egal ob es um die Gründung der PLO, den Sechstagekrieg 1967, der mit der israelischen Besetzung des Westjordanlandes endete, die erste Intifada oder das Oslo-Abkommen geht. Dabei stellte die israelisch-palästinensische Prinzipienerklärung von September 1993 eine Zäsur da: Zum ersten Mal erkannten beide Konfliktparteien die legitimen nationalen Ansprüche der Gegenseite an – doch leider nur „im Prinzip“. Dass auch in den Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern das israelische Sicherheitsbedürfnis über dem palästinensischen Wunsch nach einem souveränen Staat stand, wurde nicht nur im Westen lange ausgeblendet. Israel zog sich zwar aus den palästinensischen Städten zurück, aber die jüdischen Siedlungen im Westjordanland wuchsen weiter – und die Sicherung dieses Status quo war plötzlich auch Aufgabe der Palästinensischen Autonomiebehörde.
Asseburg zeigt auf, zu welchen Spannungen das führte: Zum einen traten in der PLO die Widersprüche zwischen der Rhetorik des Befreiungskampfes und den Anforderungen konkreter Regierungsführung immer klarer zu Tage, zum anderen wurde unübersehbar, was sich in der ersten Intifada schon angedeutet hatte: Während sich die alte Garde der PLO im Exil befand, hatte sich im Westjordanland und dem Gazastreifen eine neue Führung herausgebildet, die vor Ort oft höheres Ansehen besaß. Die Exilelite um Jassir Arafat dominierte zwar die Selbstverwaltungsinstitutionen, doch als integer galten andere: die Hamas oder die zahlreichen zivilgesellschaftlichen Gruppen.
Die Hoffnungen auf einen eigenen Staat konnten sie alle jedoch nicht erfüllen. So verschwanden zwar die israelischen Soldaten aus dem Alltag vieler Palästinenser, doch zugleich verfestigte sich auch die israelisch-palästinensische Sicherheitszusammenarbeit. Die Autonomiebehörde erschien in den Augen der Bevölkerung „immer stärker als Handlangerin der Besatzungsherrschaft statt als Befreierin von derselben“, so Asseburg. Die enttäuschten Hoffnungen entluden sich im Jahr 2000 in der zweiten Intifada, in der nicht mehr nur Steine geworfen, sondern Bomben gezündet wurden. Dutzende Selbstmordattentate konnten zwar die massive militärische Überlegenheit Israels nicht gefährden, aber sie hinterließen tiefe Spuren: „Auf jeden Fall war die Botschaft, die bei den Israelis ankam, dass sie auch in den Grenzen von 1967 nicht sicher waren,“ konstatiert die Autorin, denn „es wurden insgesamt mehr Israelis in Israel als in den palästinensischen Gebieten und mehr als doppelt so viele israelische Zivilisten wie Sicherheitskräfte getötet.“
Das ist eine der wenigen Stellen, an denen die israelisch-jüdische Perspektive im Buch eine wichtige Rolle spielt. Und das ist das große Manko dieses gut recherchierten und faktenreichen Werks. Es beschränkt sich weitgehend auf das dominante palästinensische Narrativ: Israel als siedlungskolonialistisches Projekt, gegen das Widerstand legitim ist. Das ist nicht falsch, aber einseitig. Es entlässt die Palästinenser aus der Verantwortung, statt auch kritische Fragen zu stellen, etwa nach antisemitischen Stereotypen in palästinensischen Schulbüchern. Aber auch: Wo endet legitimer Widerstand und wo beginnen Hass und Gewalt, die nicht zu rechtfertigen sind? Vor allem jedoch übersieht das palästinensische Narrativ, dass der jüdische Staat mehr ist als ein Kolonialstaat. Er ist auch Rückkehr- und Zufluchtsort am Ende einer langen Geschichte, vor allem einer Verfolgungsgeschichte, für deren furchtbaren Tiefpunkt nicht die Palästinenser, sondern wir Deutschen verantwortlich sind. Ohne den ergänzenden Blick, der den unbedingten Kampfes- und Überlebenswillen der jüdischen Seite miteinbezieht, wird es keine Perspektive für eine gemeinsame Zukunft beider Völker zwischen Mittelmeer und Jordan geben – egal ob als Ein- oder Zweistaatenlösung. Doch zugleich darf dieser ergänzende Blick Israels Verantwortung als Besatzungsmacht nicht verleugnen.
Muriel Asseburg: Palästina und die Palästinenser. Eine Geschichte von der Nakba bis zur Gegenwart, C.H. Beck, München 2021, 365 S., 16,95 Euro.










