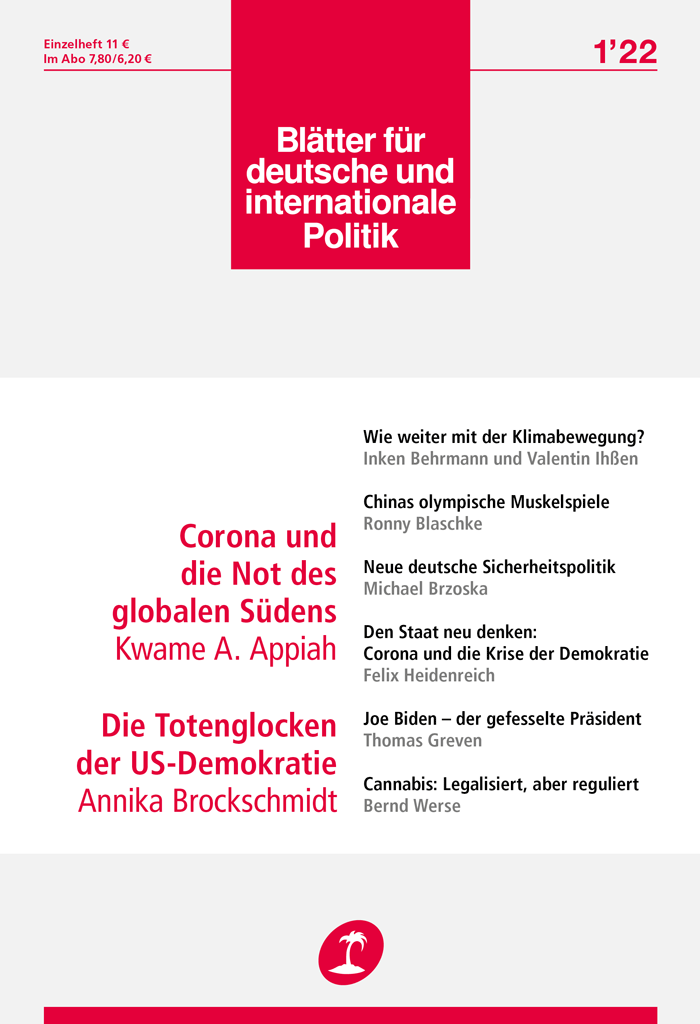Corona und die Not des globalen Südens

Bild: Mitarbeiter der Epidemieprävention während eines Sandsturms in Walvis Bay, Namibia, 18.7.2020 (IMAGO / Xinhua)
In den vergangenen zwei Jahren hatten Menschen überall in der Welt unter einer Pandemie zu leiden – allerdings nicht zwangsläufig unter derselben. In der reichen Welt wurde eine Atemwegserkrankung, Covid-19, plötzlich zu einer der maßgeblichen Todesursachen. In großen Teilen der Entwicklungsländer hingegen war nicht diese Krankheit die verheerendste Zerstörungskraft, sondern deren Sekundärfolgen: nämlich die ganz unterschiedlichen Maßnahmen, mit denen die beiden Welten jeweils auf das Coronavirus reagierten. Reichere und ärmere Nationen sind, wie sich einmal mehr zeigte, auf unterschiedliche Weise verwundbar.
Wenn ich mich mit Mitgliedern meiner Familie in Ghana, Nigeria und Namibia unterhalte, wird mir immer wieder klar, dass ein globales Ereignis zugleich zutiefst lokale Formen annehmen kann. In den genannten Ländern sind Lebensumstände und Einkommensverhältnisse auf gänzlich andere Weise berührt als in Europa oder den Vereinigten Staaten. Das gilt für Wirtschaft und Bildungswesen, aber auch für den Gesundheitssektor. Und in all diesen Bereichen geht es dabei oft um Leben oder Tod.
Das Medianalter in den drei Ländern liegt zwischen 18 und 22 Jahren, und es hängt stark vom Alter ab, wie schwer Covid-19 sich auswirkt. Wenn die Pandemie tödlich wirkt, dann nicht zuletzt dadurch, dass sie die Behandlung anderer Krankheiten wie AIDS, Malaria und Tuberkulose beeinträchtigt. Allein in Afrika leben 26 Millionen Menschen mit HIV, von denen pro Jahr Hunderttausende daran sterben. Und die für Kinder und Babys besonders gefährliche Malaria fordert alljährlich fast 400 000 Menschenleben.
Das sind große Zahlen, und doch waren sie lange Zeit noch viel größer – nur durch einen enormen gesundheitspolitischen Kraftakt war es gelungen, sie deutlich zu senken. Unter den Bedingungen der Pandemie aber gingen viele Leute nicht mehr ins Krankenhaus, teils, weil es schwerer zu erreichen war, und teils, weil die Bewegungsfreiheit der dort Beschäftigten eingeschränkt wurde. Einer Untersuchung des in Genf ansässigen Global Fund zufolge, die sich auf 32 Länder in Afrika und Asien erstreckte, gingen dort die pränatalen Vorsorgeuntersuchungen von April bis September 2020 um zwei Drittel zurück. Die Zahl der Arztbesuche von Kindern unter fünf Jahren sank um drei Viertel.
Die Schattenpandemie im globalen Süden
Gesundheitsexperten zufolge wird eine der indirekten Folgen der Covid-Pandemie darin bestehen, dass die Zahl der Menschen, die an Malaria sterben könnten, sich weltweit verdoppelt. In den kommenden Jahren könnten 400 000 Menschenleben zusätzlich der Tuberkulose zum Opfer fallen und eine halbe Million zusätzlich an HIV sterben. So hat die Reaktion auf das Coronavirus in weiten Teilen der Welt – kurz gesagt – eine Schattenpandemie ausgelöst. Wer also das tatsächliche Ausmaß der Opfer, die das Coronavirus fordert, berechnen will, darf nicht nur die an Covid-19 Gestorbenen zählen. Er muss vielmehr auch die Anzahl der Malaria-, Tbc-, HIV- und Diabetestoten sowie alle weiteren Opfer einbeziehen, die unter anderen Umständen hätten gerettet werden können.[1]
Die Geschichte dieser Schattenpandemie handelt nicht schlicht und einfach von einer Krankheit – sie handelt von Armut, Hunger, vorenthaltener Bildung und verkümmertem Leben. Ein Vergleich mit der Klimakrise drängt sich geradezu auf. In der reichen Welt denken manche beim Stichwort „Klimakatastrophe“ womöglich an einen Ausfall ihrer Klimaanlage, im globalen Süden geht es dagegen schon heute um Flut-, Dürre- und Hungerkatastrophen.
Diese Disparitäten zwischen globalem Norden und globalem Süden dürften zu den Wesensmerkmalen künftiger Krisen zählen. Die Geschichte zweier Pandemien ist somit die Geschichte von zweierlei Weltordnung. Die postpandemische Aufgabe wiederum besteht also darin, die Rede von „internationaler Gemeinschaft“ ernst zu nehmen und aus den zwei Welten eine zu machen.
Natürlich hat die Pandemie auch reiche Nationen wirtschaftlich erschüttert. Doch konnten diese enorme Summen aufbringen, um die finanziellen Folgen von Lockdowns und Social Distancing abzumildern.[2] Ärmere Länder verfügen nicht über solche Mittel. Kredite kommen sie teuer zu stehen, und ihr offizielles Steueraufkommen bietet nur eine allzu schmale Handlungsgrundlage. Land für Land und Dorf für Dorf – nirgends gibt es viel, was die Wucht der Krise dämpfen könnte. Eine Forschergruppe hat kürzlich anhand von Haushaltsstatistiken aus neun Entwicklungsländern in Afrika, Lateinamerika und Asien den Einfluss der Pandemie auf die dortigen Lebensstandards untersucht. Sie fand heraus, dass Covid in diesen relativ jungen Gesellschaften weniger gesundheitliche Auswirkungen zeitigte als in reicheren (und ausnahmslos älteren) Gesellschaften, wohingegen ihre ökonomische Vulnerabilität entschieden größer war. Die Haushaltseinkommen waren in der Regel gesunken, die Menschen verloren Jobs oder konnten ihre Waren nicht mehr absetzen. Die Hälfte der ländlichen Haushalte in Kenia sah sich, wie die Forscher herausfanden, gezwungen, ihre Mahlzeiten einzuschränken oder ausfallen zu lassen. In Sierra Leone traf dies sogar für fast 90 Prozent solcher Haushalte zu.[3] Als die Pandemie Indien erfasste, standen 140 Millionen Wanderarbeiter plötzlich vor dem Nichts. Viele wurden einfach in ihre Heimatdörfer zurückgeschickt, was sie und ihre Familien in große Not stürzte. Für Menschen, „die von der Hand in den Mund leben, bedeutet Lockdown“, wie der angesehene in Indien lebende Ökonom Jean Drèze feststellte, „fast ein Todesurteil“.[4] Die Anzahl der Menschen, die weltweit in extremer Armut leben, ist erstmals seit 1997 gestiegen, und Experten rechnen nicht mit einer raschen Erholung nach dem Abklingen der Gesundheitskrise. Afrika hatte für das Jahr 2020 ein Wirtschaftswachstum von 3,2 Prozent erwartet. Jetzt aber schätzt man die Rate auf bloße 0,8 Prozent. Bei einem Bevölkerungswachstum in der Größenordnung von 2,5 Prozent bedeutet das, dass viele Menschen weniger zu essen haben und manche an krasser Unterernährung leiden werden. In reichen Ländern bestanden die medizinischen Folgen von Covid darin, dass ältere Menschen starben. In Entwicklungsländern töteten die ökonomischen Folgen Arme.
Welkende Blumen, verfaulender Kakao – die Geschichten gleichen sich
Taleni Ngoshi, eine 32jährige Geschäftsfrau in Namibia, beschrieb mir die dortige Situation so: „Die Kluft zwischen Reichen und Armen ist hier sehr tief, wobei die Grenzlinie zwischen der Mittelschicht und den Armen sehr durchlässig ist.“ Ngoshi gehört dem Volk der Ovambo aus dem Norden Namibias an, wo sie in einem Städtchen ohne Elektrizität geboren wurde, später in einer Baumschule Arbeit fand und dort ihren „grünen Daumen“ entdeckte. Schließlich gründete sie in Windhoek, der Hauptstadt des Landes, einen kleinen Gärtnereibetrieb. Geschichten wie die ihre erklären, warum die Weltbank Namibia vor einem guten Jahrzehnt neu einstufte: von einem Land mit „mittlerem Einkommen im unteren Bereich“ (lower-middle-income economy) in die nächsthöhere Kategorie (upper-middle-income economy).
Doch mit der Pandemie kam das Geschäftsleben zum Stillstand, auch für Ngoshi. Die meisten Stammkunden kündigten, aus Furcht vor Besuchern jeglicher Art, ihre Verträge. Wenn sie sich umschaut, sieht sie ringsum Menschen, die ihre Jobs und gleichzeitig ihre Häuser und Autos verlieren. Ihr Mann verdient als kleiner Staatsbediensteter nicht viel, sorgt aber wenigstens dafür, dass Essen auf den Tisch kommt. Ihre Hauptsorge gilt deshalb ihren drei Teilzeitbeschäftigten – und den sechs oder sieben Angehörigen, die von jedem dieser Drei abhängen.
Die Geschichte unterscheidet sich von Ort zu Ort und bleibt doch stets die gleiche. Mosambik beispielsweise – ein Land mit geringem Einkommen – hat sich mit milliardenschweren Extremwetterschäden im Jahr 2019 als das durch den Klimawandel am stärksten betroffene Land Afrikas erwiesen. Seine Wirtschaft schrumpfte infolge der Pandemie, weil die Absatzmärkte seiner Produkte sowie der Tourismus litten. Bei Kenia wiederum handelt es sich um ein Middle-Income-Land. Hier sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erstmals nach fast dreißig Jahren, und Millionen Familien, die am Rande des Existenzminimums leben, gerieten in Not. Frauen traf es besonders hart, teilweise deshalb, weil ihnen in Einzelhandel, Gastgewerbe und Tourismus eine wichtige Rolle zukommt.[5]
Um sich eine Vorstellung davon zu machen, wie stark die Pandemie ein Land wie Kenia erschüttert, muss man wissen, dass eines der wichtigsten Exportgüter des Landes Schnittblumen sind – Lilien, Nelken, Schleierkraut und Rosen. So ist Kenia in den vergangenen Jahren zum Hauptlieferanten der EU für Schnittrosen aufgestiegen, mit einem Marktanteil von fast vierzig Prozent. Im Schnittblumenanbau sind – direkt oder indirekt – an die zwei Millionen Kenianerinnen und Kenianer beschäftigt. Rund um den Naivashasee, der etwa eine Autostunde nordwestlich von Nairobi 1800 Meter hoch über dem Meeresspiegel liegt, finden sich dutzende ausgedehnter Anbaubetriebe. Dort ist es sonnig und es gibt reichlich Wasser für die Blumenfelder. Trotz der Transporterfordernisse macht der CO2-Fußabdruck pro Stiel einen Bruchteil desjenigen aus, den der Anbau in beheizten niederländischen Treibhäusern hinterlässt.
Während der zurückliegenden Monate welkte der Blumenabsatz wenig überraschend dahin. Social Distancing bedeutete, dass es weniger Zusammenkünfte – wie Hochzeiten, Bestattungen, Feierlichkeiten jeglicher Art – gab, und das wiederum hieß: weniger Blumennachfrage. Als die meisten Bestellungen storniert wurden, mussten Millionen von Rosenstielen entsorgt werden. Beschäftige wurden entlassen oder erlitten Lohneinbußen. Mit der Ausbreitung der Pandemie brach jeglicher Absatz ein.
In Westafrika – besonders in Ghana und der Elfenbeinküste – handelt die Geschichte nicht von Rosen, sondern von Schokolade. Kakaobäume sind wählerisch, was Temperatur, Feuchtigkeit und Boden betrifft, und weite Flächen dieser westafrikanischen Länder eignen sich ideal für ihren Anbau. Die beiden Länder decken zusammengenommen zwei Drittel des weltweiten Kakaobedarfs. Für die Elfenbeinküste ist Kakao ihr größtes Ausfuhrgut. In Ghana liegt der Geldwert der Gold- und Ölexporte höher, aber deren Bedeutung ist für das Land geringer, weil sie nicht so viele Menschen beschäftigen und weniger öffentliche Einnahmen generieren. Wirtschaftswissenschaftler schätzen, dass nicht weniger als ein Drittel der Erwerbsbevölkerung Ghanas direkt oder indirekt vom Kakao abhängt.
Während der Pandemie sank jedoch der Schokoladenverbrauch. Weniger vielleicht der individuelle Konsum, dafür umso mehr die verkaufte Menge Schokolade im Einzelhandel und an Automaten. Es handelt sich um Geschenke, um Mitbringsel vom Flughafen oder um spontane Käufe. Man denke auch an all die Schokolade, die für Zusammenkünfte zu Weihnachten, Ostern oder Halloween gekauft – oder eben nicht gekauft wird, wenn all diese Festlichkeiten ausfallen.
Ghana und die Elfenbeinküste hatten für 2020 große Pläne. In beiden Ländern gibt es Staatsagenturen, die für den An- und Verkauf der Kakaoernte zuständig sind, und beide waren übereingekommen, einen Preisaufschlag für Kakaoexporte in Höhe von 400 US-Dollar pro Tonne einzuführen. Das als „living income differential“ (LID) bezeichnete Vorhaben sollte den Bauern zugutekommen. Schokolade – das ist eine Industrie, die pro Jahr weltweit 130 Mrd. US-Dollar umsetzt, aber nur wenige Prozentpunkte davon gehen an die Millionen westafrikanischer Kleinbauern, die den Kakao produzieren. Dabei haben diese es schwer genug: im Durchschnitt kultiviert jeder von ihnen etwa 3,5 Hektar und hat ein halbes Dutzend oder mehr Familienmitglieder zu versorgen. Die Arbeit ist hart. Die Bäume sind sonnenbrandanfällig und die Kakaobohnen wachsen in Fruchtkapseln, die etwas kleiner als Rugbybälle sind. Die Reifung dauert Monate, und während dieser Zeit können verschiedene Seuchen und Krankheiten die Früchte befallen, etwa die Black-pod-Krankheit. Gerade in den vergangenen fünf Jahren zwang das Cacao-Swollen-Shoot-Virus (CSSV) die Bauern dazu, auf hunderttausende von Hektar großen Flächen sämtliche Kakaopflanzen zu vernichten.
Für viele Kakaobauern reicht ihr Verdienst kaum zum Leben. 2018 veranschlagte ein Unicef-Bericht das durchschnittliche Tageseinkommen eines westafrikanischen Kakaofarmers auf zwischen 0,50 und 1,25 US-Dollar. (Als mein Vater in den 1960er Jahren dem ghanaischen Parlament angehörte, wusste er allerhand davon zu berichten, wie die Regierungsbehörde Bauern, deren Preise sie festsetzte, über den Tisch zog.) Die meisten Kakaobauern sind heute mittleren Alters. Da ihre Kinder sehen, wie schlecht es ihnen geht, versuchen sie, ihren Lebensunterhalt auf andere Weise zu verdienen. Als 2019 das Living-income-differential-Programm angekündigt wurde, hofften die Bauern auf bessere Konditionen und steigerten ihre Produktion.
Doch dann mussten sie feststellen, dass ihre Lagerkapazitäten nicht ausreichten, solche Mengen an Kakaobohnen zu verwahren. Und als Covid den Schokoladenmarkt einbrechen ließ, stornierten westliche Abnehmer ihre Bestellungen. Hinzu kam, dass lokale Zwischenhändler, die sogenannten pisteurs, den Bauern für die Bereitschaft, ihre Bohnen abzunehmen, enorme Rabatte aufzwangen.
Die Sehnsucht nach Auskoppelung aus einer ungerechten Ordnung
Welkende Blumen, verfaulender Kakao – bei all den Geschichten darüber, wie schlecht der globale Süden unter den gegebenen Welthandelsbedingungen immer wieder bedient worden ist, verwundert es nicht, dass manche auf einen Rückzug aus dem bestehenden Handelssystem drängen. Unter afrikanischen und asiatischen Wissenschaftlern lebt mancherorts das Interesse an den Argumenten des großen Samir Amin wieder auf. Dieser hatte für eine „déconnexion“ plädiert – für die Auskoppelung aus einer ungerechten Ordnung, in der Entwicklung und Unterentwicklung nur zwei Seiten ein und derselben Medaille seien.
Amin, ein ägyptischer Wirtschaftswissenschaftler, der lange Zeit im Senegal tätig war, verlangte, dass Entwicklung „national und volksbezogen“ sein und größere Autonomie anstreben müsse. Er sprach von einer „Souveränität im Dienst der Völker“ und forderte eine Strategie des Sich-auf-sich-selbst-Verlassens. Echte politische Unabhängigkeit setzt seiner Ansicht nach wirtschaftliche Unabhängigkeit voraus. Auch wenn er bestritt, dass seine Vorstellungen auf „Autarkie“ hinausliefen – auf eine vollkommene Selbstversorgung als Ziel –, so bestand er doch darauf, dass die „Außenbeziehungen“ eines Landes den Erfordernissen seiner inneren Entwicklung nachzuordnen seien. Nun wirken allerdings die Erfahrungen mit jenen postkolonialen Regimes in Afrika, die so etwas umzusetzen versuchten – etwa Guinea unter Sékou Touré –, leider wenig ermutigend. Die Entstehungsgeschichte der globalen Interdependenz ist eben, wie sich zeigen sollte, auch eine Geschichte zunehmender Gleichheit zwischen den Ländern. Im Verlauf der zurückliegenden zwei Jahrzehnte sind, wenn man den offiziellen Weltbank-Zuschreibungen folgt, mehr als dreißig Länder aus der Lower-income- in die Middle-income-Kategorie aufgestiegen. Zweifellos hat auch Ghana, das Land meiner Kindheit, im 21. Jahrhundert enorme Fortschritte erlebt. Das Pro-Kopf-BIP verfünffachte sich zwischen 2002 und 2016. In den vergangenen Jahren fanden sich sogar die meisten der weltweit am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Afrika. Und viele der mit der Pandemie einhergehenden ökonomischen Erschütterungen sind kurzfristiger Natur: die Märkte für Blumen und für Schokolade wie auch jene für Holz oder Bauxit erholen sich bereits wieder.
Die Vulnerabilität des globalen Südens und ihre Lehren
Nichtsdestotrotz gilt es, aus der durch die Pandemie offengelegten Vulnerabilität des globalen Südens Lehren zu ziehen. Eine dieser Lehren besteht darin, dass autonome Programme der Landesentwicklung nicht funktionieren, wenn sie Marktrealitäten schlicht ignorieren oder es versäumen, interne Hemmnisse zu überwinden. Ghanas Kakaoproblem bietet hierzu ein anschauliches Beispiel. Im Februar 2020 reiste Präsident Nana Akufo-Addo in die Schweiz und verkündete, sein Land werde sich nicht länger vom Rohstoffexport abhängig machen. Es werde vielmehr selbst in die Schokoladenproduktion ein- und in der Wertschöpfungskette weit aufsteigen – so wie Ghanas Wappentier, der Savannen- oder Raubadler, in schwindelnde Höhen steigt.
Welch ein Kontrast: Hatten doch einige Generationen zuvor Ghanas Führer sich noch beeilt, eine Stahlindustrie aufzubauen. Denn so sah, dachten sie, Modernisierung aus. Akufo-Addo seinerseits setzte nun auf eine ganz andere Industrialisierungsidee: Warum sollte Ghana nicht eigene Großbetriebe vom Typ Toblerone besitzen, mit temperaturgesteuerten Gärungsbottichen, mit Fließbändern und Verpackungsmaschinen? Gewiss, dem Land fehlt eine Molkereibranche und sein Zuckersektor ist eher kümmerlich, aber an Kakaobohnen herrscht kein Mangel.
Allerdings sieht Ghana sich wie viele Entwicklungsländer zwischen einander widerstreitenden Ansprüchen und Interessen hin- und hergerissen. Das Dilemma schildert eindrücklich ein Papier, das kürzlich eine Wirtschaftswissenschaftlerin der Londoner SOAS-University und ein Kakao-Spezialist aus Accra vorlegten.[6] Demnach benötigt Ghanas Zentralbank US-Dollar als Devisen für den Außenhandel. Daher muss die staatliche Kakaoagentur das Rohprodukt an multinationale Konzerne verkaufen. Gleichzeitig würgt die Regierung die heimische Produktion ab, indem sie den Inlandsabsatz von Schokolade und Kakao-„Halberzeugnissen“ mit einer 60prozentigen Steuer belegt. Spezielle Steuervergünstigungen bleiben Firmen, die ihre Produktion überwiegend exportieren, vorbehalten – ein Hemmnis für solche, die es vorziehen würden, zunächst einmal durch die Erschließung lokaler Märkte Fertigkeiten und Kapazitäten zu entwickeln. All diese überkommenen Auflagen konterkarieren Akufo-Addos Hoffnungen, in der Produktionskette aufsteigen zu können. Hätte Ghanas Kakao-Politik ein Wappentier, so wäre es nicht der Raubadler – es wäre ein Fabelwesen mit zwei Köpfen am jeweils entgegengesetzten Ende seines Körpers.
Zudem gibt es weitere Hemmnisse. Die patchworkartigen Besitzverhältnisse auf dem Land erschweren es Kleinbauern, Eigentumstitel an dem von ihnen bewirtschafteten Land zu erwerben. (In Ghana, wo so große Ländereien den traditionellen Häuptlingen gehören, ist Landreform ein außerordentlich kompliziertes Thema.) Und die westafrikanischen Kakaoerträge haben sich in den vergangenen hundert Jahren kaum verbessert. Inzwischen gibt es Förderprogramme für anspruchsvollere und nachhaltigere Kakao-Anbaumethoden, für „smarte“ Bewässerungssysteme beispielsweise – aber sie kommen ziemlich spät.
Solche Dilemmata sind für Entwicklungsländer typisch. Überall in Afrika und Lateinamerika steht der Export von aus Fischerei, Landwirtschaft oder Bergbau stammenden Rohprodukten organisatorisch im Zentrum der jeweiligen Volkswirtschaften. Die meisten davon durchlaufen minimale Verarbeitungsprozesse, bevor sie weiterverkauft werden – entsprechend mager fällt die „Wertschöpfung“ aus. Eine große Rolle spielen dabei Formen der Subsistenzwirtschaft und die mit informellen Arbeitsverhältnissen verbundene Prekarität sowie geringe Rücklagen. Inzwischen macht die Klimakrise alles nur noch schlimmer. Unwirtschaftliche Agrarbetriebe brauchen mehr Land, was zu mehr Waldabholzung führt und so den Klimawandel beschleunigt – der wiederum die Wirtschaftlichkeit landwirtschaftlicher Aktivitäten beeinträchtigt. (Westafrikas jahreszeitlich auftretende Harmattan-Winde – heiß, trocken und staubig – haben sich in den vergangenen Jahrzehnten weiter ausgebreitet.) Tatsächlich gleichen die Turbulenzen des Klimawandels denen von Covid – nur in Zeitlupe. Den Preis zahlen jene, die ihn am wenigsten verkraften können.
Soziales Long-Covid
Die dauerhaftesten Auswirkungen der Schattenpandemie des Weltsüdens könnten das Bildungswesen und Qualifikationen betreffen – also das, was Ökonomen als Humankapital bezeichnen. Schulschließungen haben sich offensichtlich überall als höchst problematisch erwiesen. Weltweit gesehen ist für 1,6 Milliarden Lernende der Unterricht unterbrochen worden, doch in Afrika waren die Schulräume länger geschlossen als im globalen Durchschnitt – dabei handelt es sich um einen Kontinent, dessen Medianalter unter 20 Jahren liegt.[7] Low-income-Länder könnten, Experten der Weltbank zufolge, „mehr als drei volle Jahre ihrer Grundbildungsinvestitionen“ verlieren, was zu entsprechenden Verlusten an künftigen Arbeitseinkommen führen dürfte.
Für viele Familien besteht das Problem nicht im Zugang zum Internet, sondern in mangelnder Elektrizität. Ein Team von Human Rights Watch (HRW) hat zwischen April und August 2020 quer durch Afrika Befragungen durchgeführt und herausgefunden, dass sehr viele Kinder überhaupt keinen Unterricht erhielten. Selbst wenn eine Schule es geschafft hatte, ihre Unterrichtseinheiten ins Netz zu stellen, und es im elterlichen Haushalt ein Smartphone gab, stand für Homeschooling möglicherweise nicht genügend Datenvolumen zur Verfügung. Und im kenianischen Garissa berichtete ein Teenager dem HRW-Team, dass ein örtlicher Radiosender Unterrichtsstunden anbot – aber wir, sagte er, „besitzen gar kein Radio“.
Forscher betonen, dass Schülerinnen besonders darunter zu leiden haben, wenn Schulen schließen: Für sie wächst das Risiko von Kinderehe und -schwangerschaft, häuslichem Missbrauch und Ausbeutung durch Kinderarbeit. Aus all diesen Gründen – und aufgrund der schlichten Tatsache, dass Mädchen ganz selbstverständlich zum Kinderhüten und zur Erfüllung häuslicher Pflichten herangezogen werden – fürchten Unesco-Experten, dass weltweit möglicherweise elf Millionen Mädchen nie wieder zum Schulunterricht zurückkehren werden. Man könnte das als eine weitere Long-Covid-Variante betrachten.
Diese unterschiedliche Betroffenheit der Geschlechter muss aus diversen Gründen beunruhigen. Schätzungen besagen, dass Frauen mit jedem zusätzlichen Schuljahr später im Leben um 11,5 Prozent höhere Löhne erzielen, einige Prozentpunkte mehr, als Männer bei längerer Schulzeit erwarten können. Lawrence Summers, ein bemerkenswert nüchterner Ökonom, hat es einmal so formuliert: „In die Mädchenbildung zu investieren, könnte durchaus die ertragreichste Investition sein, die in Entwicklungsländern zur Verfügung steht.“ Frauen mit höherem Bildungsniveau haben in der Regel weniger Kinder, investieren aber mehr in jedes einzelne Kind. Ihre Kinder sind gesünder und ihrerseits besser ausgebildet. Gebildete Frauen nehmen auch intensiver am gesellschaftlichen Leben teil. Die stärkere Berücksichtigung von Frauen und Mädchen im Bildungswesen könnte also, wie der indische Nobelpreisträger Amartya Sen feststellt, durchaus dazu beitragen, die Ungleichheit der Geschlechter im Familienleben zu verringern.
Im Hinblick darauf, wie es um die Aussichten von Freiheit und Wohlbefinden in der jeweiligen Gesellschaft steht, sind all diese Dinge für Männer wie Frauen gleichermaßen bedeutsam. Wenn Entwicklungsexperten mit der Prognose recht haben, dass die pandemiebedingten Unterrichtsausfälle 72 Millionen Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende in – wie die Weltbank es nennt – „Lernarmut“ zu stürzen drohen, dann sind die Folgen nicht einfach nur finanzieller Art.[8] Wir haben es hier vielmehr mit einer immensen Verschwendung von menschlichem Potential zu tun.
Covid macht uns alle nackt
Covid sei ein Gezeitenwechsel, der sichtbar gemacht habe, „dass wir nackt sind“, sagte mir Sanyade Okoli, eine bekannte, aus Sierra Leone gebürtige Wirtschaftsberaterin mit Sitz in Lagos. Covid „offenbarte all die Schwächen unseres Gesundheitswesens, Bildungswesens, der Governance-Strukturen und so weiter“. Diese regionalen Schwächen kann man Tabellen und Schaubildern entnehmen, und man kann sie ebenso auf den Straßen sehen. Die Inhaberin einer Kommunikationsfirma in Windhoek gab mir ein sehr konkretes Beispiel: „Jeden Tag stehen zehn Menschen vor meiner Tür und bitten um Essen oder um Arbeit.“
Weltbank-Ökonomen zufolge stammen über 80 Prozent der 120 Millionen Menschen, die Covid in äußerste Armut gestürzt hat und deren Einkünfte damit einem Tageslohn von 1,90 US-Dollar oder weniger entsprechen, aus Middle-Income-Ländern, wobei es sich um eine dehnbare Kategorie handelt, die so unterschiedliche Länder wie Indien oder Indonesien und große Teile Westafrikas sowie Lateinamerikas umfasst.[9]
Das sollte nicht überraschen, denn Menschen, die in Ländern mit mittlerem Einkommen leben, sind besonders vulnerabel, wenn es zu globalen Störfällen kommt. Sie kaufen bei uns und sie beliefern uns – und sie sind dabei zutiefst in ein globalisiertes Wirtschaftsgeschehen verstrickt. Diese Verstrickung hat einige wunderbare Fortschritte beschert, doch letzthin gleicht sie für diese Menschen eher dem Versuch, eine abwärts laufende Rolltreppe hinaufzusteigen.
Der Wiederaufbau einer Post-Covid-Welt
Nun besteht die Lösung nicht darin, abzuspringen oder daheim zu bleiben. Selbst wenn wir nichts weiter wollen, als uns um den eigenen Garten zu kümmern, sind wir wohl kaum unabhängig von anderen, sobald es um unser Saatgut geht, um unseren Dünger und – wie wir alle lernen mussten – um unser Wetter. Der Wiederaufbau einer Post-Covid-Welt ist nicht durch einen Rückzug vom Internationalismus, sondern nur durch dessen Stärkung zu bewältigen.
Katastrophen sind fraktal und überaus komplexe Prozesse. Ihr Verständnis und der Umgang mit ihnen erfordert, sowohl mikro- als auch makroperspektivisch vorzugehen. Als reiche Länder in Europa und Nordamerika sich für Shutdowns entschieden, um die Pandemie auszubremsen, boten die Regierungen den Bürgerinnen und Bürgern gezielte Hilfsmaßnahmen an.[10] In den Vereinigten Staaten erhielten notleidende Unternehmen unter dem Paycheck Protection Program Kredite, deren Rückzahlung erlassen wurde, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt wurden. Im Vereinigten Königreich eröffneten sogenannte Bounce Back Loans und vergleichbare Kreditformen günstige Finanzierungskonditionen. Diese Programme – eine Art Ad-hoc-Sozialversicherung – waren zwar nicht perfekt, aber außerordentlich hilfreich.
Etwas Vergleichbares brauchen wir in internationalen Größenordnungen. Die reiche Welt profitiert, unterm Strich, enorm von der Globalisierung. Wir schätzen die Schokolade und die Rosen, gar nicht zu reden von dem Aluminium, Lithium, Tantalum, Yttrium und Neodymium, ohne die es unsere Smartphones nicht gäbe. Es handelt sich in vieler Hinsicht um ein Kooperationssystem, das uns allen zugutekommt. Manche haben allerdings, wie wir alle wissen, mehr davon als andere. Und wenn die Handelspartner der reichen Länder dem System nicht mehr vertrauen, könnten sie versucht sein, es abzuschreiben. Das käme sie zwar teuer zu stehen, die reichen Länder allerdings auch.
Deshalb lässt dieses Kooperationssystem sich nur aufrechterhalten, wenn es von einem gemeinsamen Verantwortungsgefühl erfüllt ist. Wenn etwas schiefläuft, haben wir, die von ihm profitieren, die Pflicht, international ebendas zu tun, was wir zuhause tun: den Vulnerablen helfen, den Sturm zu überstehen. Wenn gesundheitspolitische Maßnahmen reicher Länder die Inzidenzkurve zuhause flach halten, Menschen aber anderswo auf dem Planeten in Not bringen, dann ist das auch unser Problem. Ein integriertes Weltsystem gerät insgesamt in Gefahr, wenn Risiken auf die Verletzlichsten abgewälzt werden.
Die Debatte über unsere internationalen Verantwortlichkeiten in Covid-Zeiten wird oft absurd engstirnig geführt – als ob wir lediglich mehr Impfstoffe in Länder mit unzureichend geimpfter Bevölkerung transportieren müssten. Ja, Programme wie das internationale Vakzin-Verteilungssystem Covax müssen besser ausgestattet werden. Aber alle Impfstoffe dieser Welt können die moralischen und praktischen Übel der bestehenden Ungleichheit nicht beseitigen. In reicheren Ländern stürzen wirtschaftliche Turbulenzen mehr Menschen in die Arbeitslosigkeit. In ärmeren Ländern bringen sie mehr Menschen ins Grab. Die Erfolge, die seit einer Generation im Kampf gegen die Armut in der Welt erzielt werden konnten, sind gewiss herzerwärmend. Aber es zeigt sich auch, dass sie verlorengehen können. Die bereits erwähnte Sanyade Okoli erinnerte sich, dass sich Wohlhabende zu Beginn der Pandemie darum bemühten, Bedürftige zu unterstützen. „Es gab so ein Gefühl“, bemerkte sie bissig, „dass sie uns, wenn wir sie nicht füttern, fressen werden.“
Eine neue Vision der Globalisierung
Die Covid-Pandemie ist, wie der renommierte Wirtschaftshistoriker Adam Tooze formuliert, „die erste wahrhaft allumfassende Krise des Anthropozän“-Erdzeitalters. Seiner Ansicht nach hat sie die „Jahrtausendvision“ zunichtegemacht, dass die Globalisierung die ganze Welt zu mehr ökonomischer und sozialer Gleichheit führen wird. Es fragt sich, was nun an die Stelle dieser Vision treten wird.
Um die globale Ungleichheit auf einem post-pandemischen Planeten bewältigen zu können, benötigen wir empfindlichere Messverfahren zur Früherkennung möglicher Bruchpunkte oder -linien. Die Verletzlichkeiten und Ungleichheiten, die unsere globale Interdependenz bewirkt, lassen sich mit einem schlichten Impf-Piks nicht überwinden. Und dennoch tun wir gut daran, im öffentlichen wie im privaten Sektor gründlich über eine Reihe von Fragen nachzudenken: Wie lässt sich die Schuldenlast von Staaten, die das geliehene Geld für gute Zwecke verwendet haben, restruktuieren, erlassen oder auf andere Weise erleichtern? Wie lassen sich Landwirtschaft und andere Formen der Ressourcennutzung intelligenter und nachhaltiger betreiben? Wie kann man Governance sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene verbessern? Wie können wir inklusiv handelnde Weltinstitutionen schaffen und erhalten?
Und natürlich müssen wir uns darüber klar werden, wie Hilfe gezielt so eingesetzt werden kann, dass sie optimal wirkt. Als das Vereinigte Königreich 2020 entschied, seine Auslandshilfen um umgerechnet vier Mrd. US-Dollar zu kürzen, tat es demonstrativ einen Schritt rückwärts – ausgerechnet in einer Zeit, in der die Geschichte Schritte nach vorn verlangt. Die nachdenklichsten Kritiker von Auslandshilfen haben ein wichtiges Argument für sich: Wir wollen Regierungen, die grundsätzlich dem eigenen Volk und nicht ausländischen Wohltätern oder Kreditgebern verantwortlich sind. Doch wirkliche Hilfe – wie etwa jene von der Weltbank-Gruppe während der vergangenen zwei Jahre im Zusammenhang mit Covid geleisteten, mit Schuldendienst-Aussetzung verbundenen Finanzhilfen – müssen sich nicht zwangsläufig schädlich auf Good Governance auswirken. Und die Ausweitung menschlicher Fähigkeiten ist niemals ein Geldgrab.
Die Botschaft, die uns seit Covid in den Ohren dröhnt, hatte die Klimakrise schon lange vorher verkündet: Was an einem Ort geschieht, kann sich auf viele Orte auswirken. Deshalb dürfen wir die Pandemie nicht als eine aus heiterem Himmel über uns hereingebrochene Gesundheitskrise auffassen: Sie ist etwas viel Umfassenderes. „Die Wissenschaft ist die Exit-Strategie“, lautete ein berühmter Ausspruch des Direktors des Wellcome Trusts, Jeremy Farrar, zu Beginn der Pandemie. Doch obwohl es der Wissenschaft bedarf, reicht sie keineswegs aus – schon gar nicht, wenn es uns nicht bloß um Exit, sondern um den Wiedereinstieg geht. Angesichts lärmender, selbstsüchtiger Nationalismen, die um Gefolgschaft buhlen, werden wir den Alleingangsphantasien der Autarkie widerstehen müssen. Die Zeit nach der Pandemie verlangt vielmehr ein ausgeprägteres Verständnis unserer wechselseitigen Pflichten.
Ich erinnere mich, wie mir Taleni Ngoshi in Namibia von ihrer Verbundenheit mit den Menschen erzählte, deren Lebensunterhalt von ihr abhing. „Es gibt Tage, wenn Du aufwachst und Dir, noch im Bett, durch den Kopf geht: ‚Ich bin es leid!‘“, sagte sie. „Und eine Minute später denkst Du: ‚Ich muss etwas tun. Wenn ich im Bett bleibe und in Selbstmitleid schwelge – was werden dann die anderen morgen zu essen haben?‘“
Die anderen sind auf Taleni angewiesen, genauso, wie letztlich sie selbst auf diese angewiesen ist. Um diese kleinen, lokalen Kreise wechselseitigen Füreinandersorgens herum müssen wir größere, letztendlich globale Kreise ziehen. Resilienz sollte nicht für Reiche reserviert bleiben. Ein weltweiter Aufschwung, der fairer und sicherer ist, setzt voraus, dass wir systemische Risiken möglichst umfassend und rechtzeitig erkennen und anpacken. Handel ohne Verantwortlichkeit ist per se ein Risiko, dass wir uns gar nicht leisten können – auch wenn es so verlockend sein mag wie Schokolade, ist es doch ebenso leicht verderblich wie Schnittblumen.
Deutsche Übersetzung des Beitrags, der unter dem Titel „A tale of two pandemics: the true cost of Covid in the global south“ zuerst auf www.theguardian.com erschienen ist. Die Übersetzung stammt von Karl D. Bredthauer.
[1] Vgl. Marc Engelhardt, Von Tbc bis Corona: Afrika, das ewige Pandemie-Opfer, in: „Blätter“, 10/2021, S. 25-28 sowie Simone Schlindwein, Afrika: Die zweifache Katastrophe, in: „Blätter“, 5/2020, S. 71-75. – D. Red.
[2] Vgl. Adam Tooze, How coronavirus almost brought down the global financial system, www.theguardian.com, 14.4.2020.
[3] Mike Cummings, Pandemic erodes living standards in developing countries, study shows, www.yale.edu, 5.2.2021.
[4] Vgl. dazu auch Vidya Krishnan, Apokalypse mit Ansage. Corona und das moralische Versagen der indischen Gesellschaft, in: „Blätter“, 6/2021, S. 51-55; Ellen Ehmke, Indien: Der große Exodus, in: „Blätter“, 5/2020, S. 76-79 sowie grundlegend zur indischen Wirtschaft Jean Drèze und Amartya Sen, Der indische Wachstumsrausch, in: „Blätter“, 5/2012, S. 76-89. – D. Red.
[5] Die weltweiten Verluste im Tourismusgeschäft werden auf rund acht Billionen US-Dollar geschätzt.
[6] Vgl. Sophie van Huellen und Fuad Mohammed Abubakar, Potential for Upgrading in Financialised Agri-food Chains: The Case of Ghanaian Cocoa, in: „The European Journal of Development Research“, 33/2021., S. 227-252; Sophie Van Huellen, Why Ghana doesn’t get the full value of its cocoa beans – and how this could change, www.theconversation.com, 27.4.2021.
[7] Die Vergleichsziffer für Südamerika ist 31. Vgl. Jeff Desjardins, Mapped: The Median Age of the Population on Every Continent, www.visualcapitalist.com,15.2.2019.
[8] Pandemic Threatens to Push 72 Million More Children into Learning Poverty – World Bank outlines a New Vision to ensure that every child learns, everywhere, www.worldbank.org, 2.12.2020.
[9] Kay Atanda und Alexandru Cojocaru, Shocks and vulnerability to poverty in middle-income countries, https://blogs.worldbank.org, 31.3.2021.
[10] Ein vergleichbares Programm in Nigeria war kärglich finanziert und – wie Nigerianer, mit denen ich sprach, klagten – dermaßen undurchsichtig, dass es besonders Günstlingen der Regierung zugutekam.