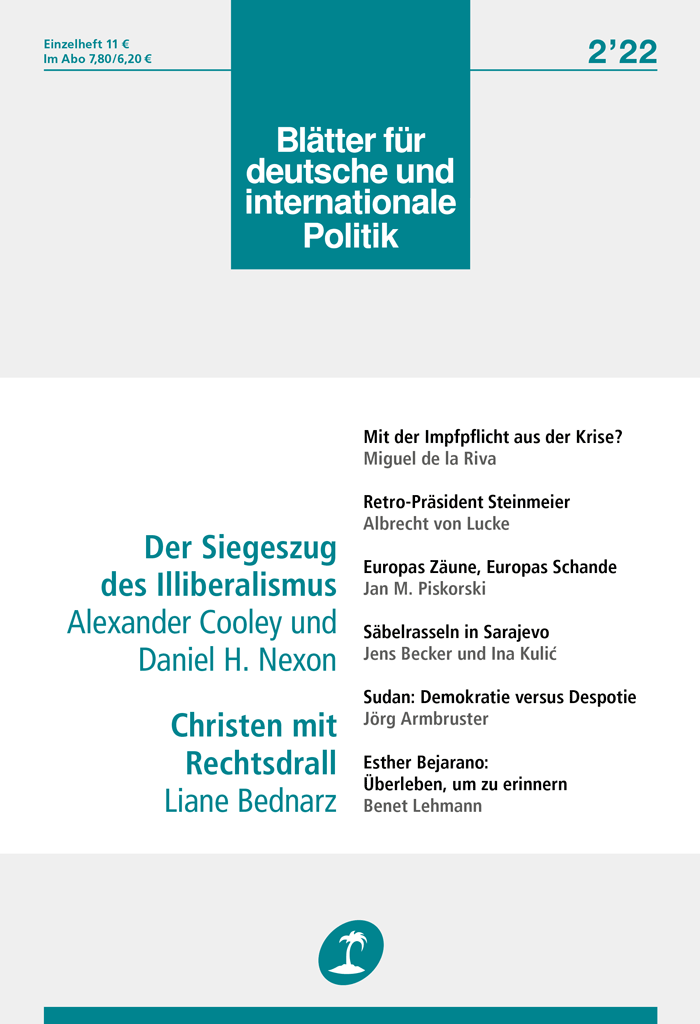Bild: Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, im Rahmen einer Demonstration der Arbeitsgemeinschaft Baeuerliche Landwirtschaft in Berlin, 20.1.2022 (IMAGO / photothek)
Es darf keine Ramschpreise für Lebensmittel mehr geben, sie treiben Bauernhöfe in den Ruin, verhindern mehr Tierwohl, befördern das Artensterben und belasten das Klima.“ Diese Aussage des neuen grünen Bundesagrarministers Cem Özdemir sorgte gleich zum Start der Ampel-Koalition für teils heftige Empörung. Dass die medialen Wogen beim Thema Lebensmittelpreise hochschießen würden, war zu erwarten – auch wenn das, was Özdemir in der „BamS“ vom Weihnachtswochenende gesagt hat, schon seine Vorgänger*innen so oder ähnlich formuliert haben. Vielleicht betonte der neue Landwirtschaftsminister auch deshalb ausdrücklich, dass er es ernst meine. Und ernsthaft kann ja niemand bestreiten, dass die derzeitigen Lebensmittelpreise hierzulande einen erheblichen Teil der Kosten unterschlagen – nämlich jene für die massiven Schäden an Umwelt, Tieren und Klima, wie auch an den Menschen, die im Agrar- und Ernährungssektor arbeiten.
Wie unser Essen erzeugt, vermarktet und gekennzeichnet werden soll, ist denn auch Inhalt des Koalitionsvertrages, auf immerhin fünf von 177 Seiten. Bereits während sie das Agrarkapitel formulierten, standen die Koalitionäre unter forcierter Beobachtung einer neuartigen „Interessengemeinschaft“, bestehend aus sieben Umwelt- und Tierschutzorganisationen, die gemeinsam mit den drei Schwergewichten der konventionellen Landwirtschaft – dem Deutschen Bauernverband (DBV), dem Raiffeisenverband und der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) – die kommende Bundesregierung aufgefordert hatten, den Abschlussbericht der von Angela Merkel 2019 initiierten „Zukunftskommission Landwirtschaft“ als Richtschnur für ihre Agrarpolitik zu wählen.[1] Dieser enthalte taugliche Kompromissvorschläge für agrarpolitische Konfliktthemen wie Strukturwandel, Tier- und Umweltschutzdefizite sowie die Herausforderungen des Klimawandels.[2]
Allerdings haben die drei Koalitionspartner höchst unterschiedliche Vorstellungen davon, was in der Agrarpolitik als „Fortschritt“ anzusehen ist. Während in der SPD in dieser Frage eher diffuse Vorstellungen vorherrschen, geriert sich die FDP mit lediglich technologischen Fortschrittsverheißungen als Verteidigerin des Status quo. Die Grünen schließlich haben relativ konkrete agrarpolitische Vorstellungen, die bei den rund zehn Prozent Ökobauern hierzulande Erlösungsphantasien auszulösen vermögen, bei den 90 Prozent konventionellen Agrarbetrieben indes eher Untergangsszenarien evozieren. Entsprechend gemischt fällt die Bilanz der agrarpolitischen Vorhaben der Ampel aus: Während einige der Vorschläge aus dem Koalitionsvertrag durchaus sinnvoll erscheinen, wie die geplante Datenbank für Tiergesundheit oder die Finanzierung einer besseren Nutztierhaltung durch die Marktteilnehmer, klingen manch andere zwar gut, haben aber bei näherer Betrachtung nur wenig Substanz. Dazu gehört etwa die vollmundige Ankündigung, „die gesamte Landwirtschaft in ihrer Vielfalt an den Zielen Umwelt- und Ressourcenschutz“ auszurichten, nur um dieses Ziel zwei Sätze später auf „30 Prozent Ökolandbau bis 2030“ einzudampfen.
Zerstörerische Landwirtschaft
Doch worum geht es bei all dem überhaupt? Während die Landwirtschaft lediglich 0,7 Prozent zur volkswirtschaftlichen Gesamtleistung beisteuert, sind die von ihr verursachten Schäden enorm. Trotz rund einer Billion Euro an Steuergeldern, die in den vergangenen zwanzig Jahren allein durch die „Gemeinsame Agrarpolitik“ der EU als Agrarsubventionen ausgeschüttet wurden, haben die ökologischen Schäden und die mit massiven Schmerzen und Leid einhergehenden „Produktionskrankheiten“ der Tiere zugenommen. Zugleich hält das Sterben der kleineren landwirtschaftlichen Betriebe an. Denn nach wie vor fördert die EU Betriebe mit großen Flächen anstatt einer umwelt- und tiergerechten Landwirtschaft. Somit bleibt der ökologische Landbau eine Nische – ein Feigenblatt für ein Agrarsystem, dessen Zerstörungskraft bislang durch nichts und niemanden aufgehalten wurde.
Dabei hatte Renate Künast, die erste grüne Agrarministerin, bereits 2001 erklärt: „Der BSE-Skandal markiert das Ende der Landwirtschaftspolitik alten Typs. […] Wir setzen auf die Agrarwende. Der Maßstab dabei ist Klasse statt Masse.“ Und konkreter: „Wir wollen in Zukunft keine Überschüsse produzieren, sondern Qualität. Wir wollen und werden in Zukunft keine Tierquälerei finanzieren, sondern artgerechte Tierhaltung. Wir wollen und werden keinen Raubbau, sondern den Schutz von Boden und Wasser finanzieren.“[3] Doch mehr als zwanzig Jahre später muss man unumwunden feststellen: Die „Agrarwende“ hat unter keiner Bundesregierung stattgefunden.
Als wären die von der Landwirtschaft verursachte Schäden nicht vielfach dokumentiert, hält sich beharrlich die These, die moderne Landwirtschaft erbringe für die Gesellschaft „Gemeinwohlleistungen“ wie die Erhaltung der Kulturlandschaft oder die Sicherung angeblich hoher Umwelt- und Tierschutzstandards – zusätzlich zu ihrer Hauptaufgabe, der „nachhaltigen Erzeugung von Lebensmitteln“.
Das Gegenteil jedoch ist der Fall: Die vorherrschende landwirtschaftliche Praxis bedroht – beispielsweise durch den übermäßigen Einsatz von Dünger – die natürlichen Ressourcen und sogar das Lebensmittel Nummer eins, das Wasser. Einschlägige Untersuchungen des Umweltbundesamtes, verschiedener wissenschaftlicher Beiräte des Bundeslandwirtschaftsministeriums, des Europäischen Rechnungshofes, der Europäischen Umweltagentur und des bundeseigenen Johann-Heinrich-von-Thünen-Instituts lassen daran keinen Zweifel.[4]
Auch zum Klimawandel trägt die Landwirtschaft massiv bei: Allein in Deutschland (und ähnlich in der gesamten EU) verursacht sie einschließlich der landwirtschaftlichen Bodennutzung mehr als 13 Prozent der Treibhausgasemissionen. Bezieht man Vorleistungen wie die Produktion von Mineraldünger und die Verarbeitung der Rohstoffe bis hin zur Essenszubereitung in die Berechnung mit ein, sind es für den gesamten Ernährungssektor rund 30 Prozent.[5]
Wollen die EU wie Deutschland ihr Ziel der Klimaneutralität erreichen und die Pariser Klimaziele einhalten, müssen sie ihre Treibhausgasemissionen folglich auch in der Landwirtschaft schnell und drastisch senken. Besonders bedeutsam sind dabei die Methanemissionen aus der Tierhaltung sowie Lachgasemissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden als Folge der Stickstoffdüngung. Da ein Großteil der Düngung und der damit verbundenen Emissionen der Erzeugung von Futtermitteln dient, lassen sich rund Dreiviertel der Klimagasemissionen des Landwirtschaftssektors auf die Tierhaltung zurückführen. Daraus folgt: Die Pariser Klimaziele sind nur zu erreichen, wenn die Zahl der Tiere signifikant sinkt, bei Wiederkäuern in etwa auf die Hälfte des heutigen Bestandes.[6] Doch genau diese Feststellung sucht man im Koalitionsvertrag vergeblich. Stattdessen will die Ampel-Koalition die Tierbestände „in Einklang mit den Zielen des Klima-, Gewässer- und Emissionsschutzes“ bringen – was auch immer das bedeuten mag.[7]
Das wiederum führt zurück zum Thema Lebensmittelpreise: Während nach den Vorstellungen der „Zukunftskommission Landwirtschaft“ zur Finanzierung der für den Klimaschutz notwendigen Transformation jedes Jahr mindestens 1,5 bis 5,5 Mrd. Euro weitere Steuergelder an die Landwirte fließen sollen,[8] favorisiert die Ampel – glücklicherweise – die Finanzierung durch die Marktteilnehmer.[9] Das aber bedeutet nichts anderes, als dass der Klimaschaden kostenwirksam wird, sprich: Die Preise werden steigen.
Umsetzen lässt sich das am besten durch eine EU-weit zu erhebende Klimaabgabe auf die Produktion oder eine EU-weite Konsumabgabe auf die Endverkaufspreise von Fleisch und Milchprodukten, differenziert nach der jeweiligen Treibhausgasintensität der Produktion. Eine Klimaabgabe in Höhe von 30 Euro je Tonne CO2 – das ist der für 2022 vorgesehene Preis pro Tonne CO2-Äquivalent – würde Rindfleisch um knapp 8 Prozent teurer machen, Milch um rund 5 Prozent und Käse um 3 Prozent. Das Umweltbundesamt veranschlagt die Klimakosten einer Tonne CO2 allerdings auf rund 200 Euro.[10] Damit stiege der Preis von Rindfleisch um etwa die Hälfte, Butter und Milch verteuerten sich um rund 30 Prozent; bei Hähnchen und Schweinefleisch wäre der Effekt moderater. Natürlich muss dieser Prozess sozialpolitisch begleitet werden – doch so lange große Einkommens- und Vermögensunterschiede fortbestehen, werden sich Reiche am Ende trotzdem mehr leisten können als Arme. Die im Koalitionsvertrag angekündigte Erhöhung des Mindestlohns, die Einführung des Bürgergelds oder der Verzicht auf Rentenkürzungen sind nicht ausreichend, um hier gegenzusteuern.
Damit europäische Betriebe Billigimporten aus Drittstaaten nicht ungeschützt ausgesetzt werden, muss die Klimaabgabe überdies auch auf Importe aus Drittstaaten erhoben werden – analog zu den bereits konkret diskutierten Grenzausgleichsmaßnahmen für Industrieprodukte wie Stahl. Und schließlich sollte sichergestellt werden, dass die Klimaziele im Binnenmarkt nicht durch die Produktion für den Export unterlaufen werden.
Tierschutz ohne Kontrolle
Im Unterschied zu den im Pariser Klimaabkommen festgehaltenen verbindlichen Klimaschutzzielen gibt es für den Tierschutz bisher weder auf EU-Ebene noch in den Mitgliedstaaten „ambitionierte“ Ziele, um die Vorgaben des europäischen Primärrechts (AEUV Art. 13), internationaler Vereinbarungen (der Weltorganisation für Tiergesundheit OIE) oder – im Fall von Deutschland – des Artikels 20a des Grundgesetzes zu erfüllen.
Zwar will die Ampelkoalition „eine nachhaltige, zukunftsfähige Landwirtschaft, in der die Bäuerinnen und Bauern ökonomisch tragfähig wirtschaften können und die Umwelt, Tieren und Klima gerecht wird“.[11] Doch dieses Ziel bleibt nur eine Phrase, wird es nicht mit entsprechenden Maßnahmen unterlegt. Tatsächlich darf Klimaschutz in der Landwirtschaft nicht ohne konsequenten Tierschutz erfolgen. Andernfalls droht eine noch stärkere Fokussierung auf die Effizienzsteigerung der Tierhaltung, um den CO2-Abdruck je Kilogramm erzeugtem Produkt zu verringern. Eine weitere Überforderung der Tiere und noch mehr Krankheiten wären geradezu programmiert. Im Koalitionsvertrag wird dieser Zielkonflikt richtigerweise adressiert: „Wir wollen die Emissionen aus Ammoniak und Methan unter Berücksichtigung des Tierwohls deutlich mindern“, heißt es dort.
Genau das aber ist der blinde Fleck in der Diskussion. So sind für die „Zukunftskommission“ neue, tierfreundlichere Ställe gleichbedeutend mit erfolgreichem Tierschutz. Allerdings ist längst erwiesen, dass auch exzellente formale Haltungsbedingungen die Tiere nicht automatisch vor Krankheiten und Leid bewahren. In der Ökotierhaltung gibt es ähnlich viel Schatten wie in konventionellen Betrieben, auch hier erleidet ein vergleichbar hoher Anteil der Legehennen Knochenbrüche und erkranken ebenso viele Schweine an Leber oder Lunge.[12]
Doch weder in der „Zukunftskommission“ noch in der öffentlichen Debatte spielt ein systematischer und unabhängig kontrollierter Tierschutz eine Rolle. Dabei können etwa die routinemäßig durchgeführten Untersuchungen an Schlachtkörpern oder der Milch starke Hinweise auf die Gesundheit bzw. Krankheit und das Wohlbefinden oder Leiden der Tiere in den einzelnen Betrieben liefern. Im Koalitionsvertrag wird ein solches Instrument erfreulicherweise zumindest angekündigt. Wird es tatsächlich umgesetzt, wäre das ein großer Fortschritt.
Ungleich prominenter aber ist im Koalitionsvertrag von der Einführung einer verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung für 2022 die Rede. Man will sich gar um „entsprechende verbindliche EU-weit einheitliche Standards“ bemühen, die Landwirte beim Umbau der Nutztierhaltung unterstützen und strebt an, „ein durch Marktteilnehmer getragenes finanzielles System zu entwickeln“.[13] Doch eine staatliche „Haltungskennzeichnung“ bedeutet noch lange nicht, dass erfolgreicher Tierschutz auch wirklich stattfindet. Zudem wird es den Verbraucher*innen überlassen, ob sie sich für mutmaßlichen Tierschutz entscheiden. Insgesamt ist das ein klarer Verstoß gegen das Tierschutzversprechen in Artikel 20a GG. Dieses gilt nämlich für tatsächlichen Tierschutz – und für alle Tiere.
Für den Tier- und Klimaschutz in der Landwirtschaft kann die neue Bundesregierung am meisten erreichen, wenn sie ihren Einfluss in Europa nutzt, um schnellstmöglich eine Mehrheit der EU-Staaten für verbindliche, höhere europäische Tierschutzanforderungen zu mobilisieren, einschließlich konsequenter unabhängiger Erfolgskontrollen auf Betriebsebene. Die EU sollte zudem alle Spielräume ausschöpfen, damit Tierschutzziele künftig auch im Welthandel durchgesetzt werden können – notfalls muss sie dafür auch handelspolitische Konflikte in Kauf nehmen. Die Bereitschaft, sich dafür mit Vehemenz einzusetzen, wird Auskunft darüber geben, wie ernst es der Ampelkoalition ist, ökologische Vernunft in die Agrarpolitik einziehen zu lassen.
[1] Zukunftskommission Landwirtschaft umsetzen, Pressemitteilung vom 12.10.2021, www.bund.net.
[2] Vgl. dazu: Agrarpolitik in der Konsensfalle, www.foodwatch.org, November 2021.
[3] Deutscher Bundestag, Stenographischer Bericht, 149. Sitzung, 8.2.2001, S. 14520 und 14523.
[4] Vgl. etwa Nitrat und Trinkwasser, www.dvgw.de sowie Umweltbundesamt, Umweltprobleme der Landwirtschaft – 30 Jahre SRU-Sondergutachten, 2015, S. 2 ff.
[5] Vgl. Harald Grethe u.a., Klimaschutz im Agrar- und Ernährungssystem Deutschlands, www.stiftung-klima.de, S. 2.
[6] Landwirtschaft auf dem Weg zum Klimaziel, www.greenpeace.de, 28.10.2021, S. 9 und 13.
[7] Koalitionsvertrag, a.a.O., S. 43.
[8] Vgl. Zukunftskommission Landwirtschaft, www.bundesregierung.de, 2021, S. 122.
[9] Vgl. Koalitionsvertrag a.a.O., S 43.
[10] Gesellschaftliche Kosten von Umweltbelastungen, www.umweltbundesamt.de, 10.8.2021.
[11] Vgl. Koalitionsvertrag, a.a.O., S. 25.
[12] Vgl. Ausgewählte Studienergebnisse zur Tiergesundheit, www.foodwatch.org, 22.9.2016.
[13] Koalitionsvertrag, a.a.O., S. 43.