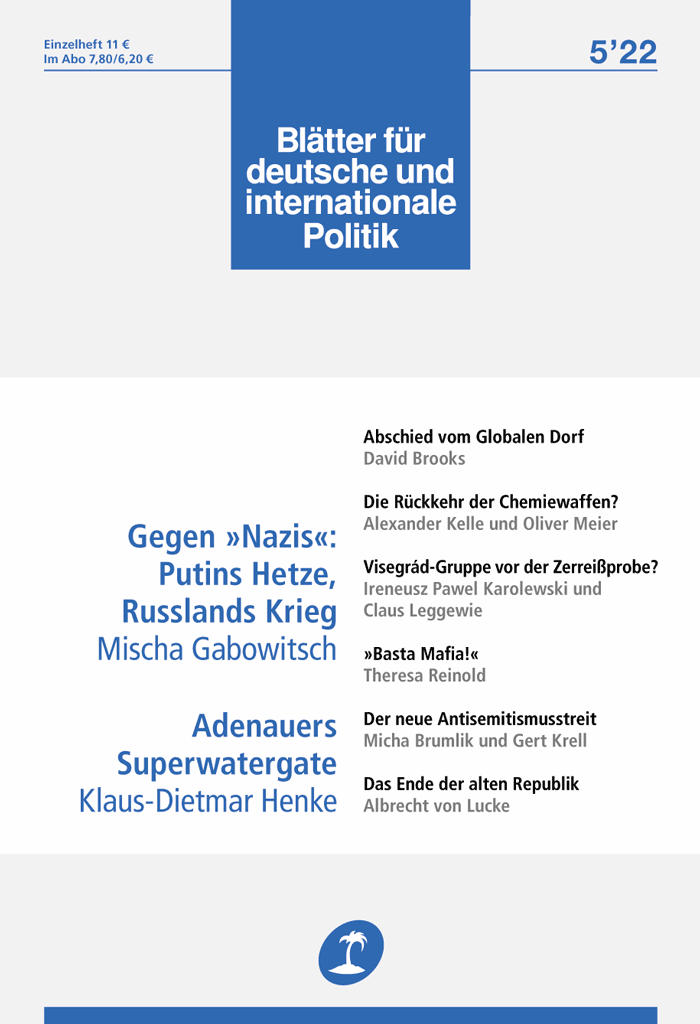Bild: 1 D-Mark (IMAGO / Schöning)
Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai vor 77 Jahren hat es einen derartigen großen Krieg in Europa, ausgetragen zwischen den beiden größten Landmächten des Kontinents, nicht mehr gegeben. Der russische Überfall auf die Ukraine geht mit einer unfassbaren Vernichtung einher, an den Menschen, aber auch an Gebäuden und Infrastruktur des Landes. Das bereits zeigt, dass die Herausforderung der aktuellen Bundesregierung die ihrer Vorgängerregierungen weit in den Schatten stellt. Zu vergleichen ist sie wohl nur mit der der ersten Regierung Konrad Adenauers von 1949 bis 1953.
Allerdings könnte die Lage unterschiedlicher kaum sein. Die Regierung Adenauer kam aus der zweifellos verheerendsten Zeit des vergangenen Jahrhunderts. Deutschland war weitgehend zerstört, Millionen Flüchtlinge irrten durch die verschiedenen Sektoren. Es kam darauf an, an allen Stellen das Notwendigste zu organisieren und politisch die entscheidenden Weichen zu stellen. Insofern betrat Adenauer mit der Bonner Republik tatsächlich Neuland. Aber: Seine Regierung hatte den Krieg bereits hinter sich. Das bedeutete auch, dass es vor allem auf das Basale ankam, die Bevölkerung satt zu machen und ihre primären Bedürfnisse zu befriedigen. Die Menschen waren ausgesprochen genügsam, ihre Erwartungen an die Politik entsprechend gering. Und spätestens als das „Wirtschaftswunder“ begann, ging es in der Bundesrepublik stetig bergauf. Das spielte der Regierung Adenauer in die Hände und erleichterte dem Kanzler das Durchregieren mit seinen durchaus autoritären, zum Teil auch dezidiert antidemokratischen Methoden.[1]
Heute ist das Gegenteil der Fall: Die Regierung Scholz startet quasi in einen möglicherweise lang andauernden Krieg, der die beiden Grundfesten der Republik radikal untergräbt – Frieden und wirtschaftliches Wachstum. Wir sind am 24. Februar tatsächlich „in einer anderen Welt aufgewacht“, wie Außenministerin Annalena Baerbock es nannte.[2] Um den in der Ökologie-Debatte gängigen Begriff zu verwenden: Dies könnte der Kipppunkt von einer langen Friedens- zu einer langen Kriegsperiode gewesen sein.
In jedem Fall erleben wir das definitive Ende der Nachkriegszeit und den Übergang in eine noch unabsehbare Epoche. Das zeigt sich bereits daran, dass unter „normalen“ Umständen tagelang über die Planung von Sprengstoffanschlägen und eine Entführung von Karl Lauterbach („Aktion Klabautermann“) öffentlich debattiert worden wäre. Ganz zu schweigen von der kläglich gescheiterten Impfpflicht gegen Corona: Immerhin hat die Pandemie die Welt die vergangenen zwei Jahre in Atem gehalten und sie ist keineswegs überwunden.[3] Doch angesichts des brutalen Mordens in der Ukraine wird vieles andere vermeintlich zweitrangig, ist der Krieg zur neuen Hauptherausforderung geworden.
Dabei ist der bisherige Kurs der Regierung Scholz keineswegs klar, sondern durch zwei Ziele gekennzeichnet, die in einem konfliktiven Verhältnis zueinander stehen. Erstens: Putin darf den Krieg auf keinen Fall gewinnen. Und zweitens: Deutschland beziehungsweise die Nato dürfen auf keinen Fall Kriegspartei werden, da ansonsten die Gefahr eines Dritten Weltkrieges droht. Das Dilemma dabei: Umso mehr Putin diesen Krieg, wie vom Westen angestrebt, verliert, umso mehr droht die Eskalation zu einem ganz großen Krieg, der dann möglicherweise auch mit Atomwaffen ausgetragen wird. Für die Ampel-Regierung handelt es sich um einen Drahtseilakt: Einerseits ist sie gehalten, die Ukraine in Anerkennung deren Selbstverteidigungsrechts (Art. 51 UN-Charta) durch Waffen zu unterstützen; andererseits muss sie alles tun, um zu verhindern, selbst in einen Krieg gegen Russland zu geraten.
Hinzu kommt ein entscheidender dritter Faktor, der in den bisherigen Debatten kaum vorkommt: Noch ist völlig unklar, wie das Ende dieses Krieges aussehen soll. Damit aber drohen die Rüstungsbefürworter in die gleiche Falle zu tappen wie bereits bei so vielen Kriegen zuvor, von Afghanistan bis Mali. Was nämlich wäre unter der angestrebten Niederlage Russlands und, fast schwieriger noch, unter einem Sieg der Ukraine zu verstehen? Soll es tatsächlich, wie von der Regierung Selenskyj gefordert, die absolute Rückeroberung auch der bereits seit 2014 russisch besetzten Separatistengebiete sein? Oder gar die Rückeroberung der annektierten Krim? Für Putin ist dies faktisch ausgeschlossen, da es seinen eigenen Untergang bedeuten würde. Muss man sich daher nicht doch, schon um die maximale Eskalation zu vermeiden, am Ende auf einen Kompromiss mit Russland einlassen, also (bestenfalls) zum Zustand vor dem 24. Februar zurückkehren – was wiederum für die Ukraine kaum zu akzeptieren wäre?
Daran zeigt sich auch, dass bei aller Solidarität mit der Ukraine deren Kriegsziele und die der sie unterstützenden westlichen Staaten nicht zwangsläufig dieselben sind. Fest steht nur eines: Ein schnelles Ende dieses Krieges ist gegenwärtig nicht zu erkennen. Und der immer höhere Blutzoll, den beide Seiten erbringen, wird eine Friedensvereinbarung immer schwieriger machen. Zugleich stellt der „Abnutzungskrieg“, in dem wir uns jetzt befinden, einen furchtbaren Euphemismus dar, denn er hat massenhaft Tote zur Folge. Und jeder Tag, den der Krieg länger anhält, wird unzählige weitere Menschenleben kosten.
Ein Krieg ohne Sieger
Auch jene, die zu Recht für eine weitreichende Unterstützung der Ukraine plädieren, sollten sich daher der Tragik ihrer Argumentation bewusst sein. Insofern ist es hoch demagogisch, wenn die Friedensbewegung – trotz der berechtigten Kritik an manch simplifizierendem Slogan – nun im metallischen Ton des Kalten Krieges zur „fünften Kolonne Wladimir Putins“[4] erklärt wird. Und es ist ausgesprochen leichtfertig, triumphalistisch zu erklären, „der schlafende Riese Deutschland ist aufgewacht und liefert Waffen in ein Kriegsgebiet“.[5] Denn auch die Befürworter einer maximalen Aufrüstung der Ukraine haben bisher keine befriedigende Antwort auf die Frage, wie am Ende der Frieden aussehen kann.
Selbst wenn es der Ukraine gelingt, die russischen Angriffe abzuwehren, wird es am Ende auf Verhandlungen mit Russland hinauslaufen müssen. Dieser Krieg wird daher keine echten Sieger kennen. Vielmehr wird er im Ergebnis verheerende Verluste für die Ukraine bedeuten, mit unzähligen Toten und der völligen Zerstörung ganzer Städte, großer Teile der Infrastruktur und damit auch der Volkswirtschaft.
Die Folgen eines lang andauernden Krieges werden auch Deutschland treffen – und zwar über den von der EU zu leistenden Wiederaufbau der Ukraine hinaus. Der Internationale Währungsfonds hat seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft bereits deutlich gesenkt, ohne ein Ende des Krieges überhaupt absehen zu können. Dadurch wird die bisherige Geschäftsgrundlage dieser Koalition in ihr Gegenteil verkehrt. Die Regierung Scholz begann diese Legislaturperiode mit einem doppelten, durchaus widersprüchlichen Versprechen: erstens dem einer dringend gebotenen ökologischen Transformation der Industriegesellschaft, und zweitens dem einer Fortschreibung der bisherigen Wohlstands- und Wachstumsgeschichte.[6] „Mehr Fortschritt wagen“, lautete die optimistische Botschaft des Koalitionsvertrags. Doch mit dem 24. Februar ist dieser Vertrag in weiten Teilen zur Makulatur geworden. Bereits jetzt zeigen die zunehmende Inflation wie eine mögliche Stagflation infolge einer schwachen Weltwirtschaft, dass es zukünftig nicht um Wohlstandsgewinne, sondern um die gerechte Verteilung von Wohlstandseinbußen gehen dürfte.
Bisher ist diese neue Realität aber noch gar nicht bei der Bevölkerung angekommen. Zudem sind seit dem Beginn der Republik die Erwartungen der Menschen an ihr eigenes Leben stetig gewachsen – und demzufolge auch die Erwartungen an die Politik. Die Regierung Scholz steht daher vor einer doppelten Aufgabe: Erstens muss sie der Bevölkerung die fundamental neue außenpolitische Lage erklären, wie auch die aus dieser resultierenden Dilemmata. Und zweitens wird sie der Bevölkerung die innenpolitische Notwendigkeit nicht weiteren ökonomischen Aufstiegs, sondern eines teilweisen Abstiegs beibringen müssen.
Die Kosten sollten dabei vor allem jene tragen, die in den vergangenen Friedens- und Wohlstandsjahrzehnten starke finanzielle Polster aufgebaut haben. Dabei wird es auch auf die gerechte Verteilung von Energie ankommen, also um Einsparungen etwa beim Heizen oder auch beim Benzinverbrauch. Wenn Deutschland nach Auffassung der Regierung schon nicht direkt aus den russischen Gasimporten aussteigen kann, dann sollte es der russischen Kriegsmaschinerie wenigstens zu möglichst geringen Einnahmen verhelfen. Warum sollte es nicht wie in der Ölkrise der 1970er Jahre heute, unter weit dramatischeren Vorzeichen, möglich sein, diverse Sonntage zu autofreien zu erklären? Oder wenigstens ein befristetes Tempolimit einzuführen?
Das überforderte Kabinett
All das wird entscheidend davon abhängen, dass sich die Regierung nicht weiter von der FDP als ihrem kleinsten Koalitionspartner am Nasenring durch die Manege ziehen lässt – wie bei der Corona-Impfpflicht, wo sich letztlich das ur-neoliberale, anti-solidarische Prinzip „wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht“ durchgesetzt hat, weil zuvor jeder Kompromiss am Taktieren der Parteien gescheitert war, ungeachtet der verheerenden Folgen für die Gesamtgesellschaft.
Worum es letztlich geht, ist der Normalitätsillusion ein Ende zu bereiten, dass es in absehbarer Zeit wieder materiell so aufwärts gehen wird wie in den vergangenen Jahrzehnten. Doch ganz offensichtlich sind Teile der Regierung der neuen historischen Lage nicht gewachsen. Nie zuvor war ein Bundeskabinett nach so kurzer Zeit bereits so lädiert. Der erste Ausfall war die unglückliche Familienministerin Anne Spiegel. Massiv angeschlagen ist Gesundheitsminister Karl Lauterbach, und zwar nicht nur durch das Scheitern der Corona-Impfpflicht. Und ganz besonders im Fokus der Kritik steht Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Hier rächt sich, dass in den langen Friedensjahren das Verteidigungsministerium sträflich vernachlässigt wurde und kaum jemand Anstoß daran nahm, wenn eine mit dem Militär überhaupt nicht vertraute Person dieses wichtige Amt übernahm.
Auf den Kanzler kommt es an
Letztlich wird es bei der Bewältigung dieser historischen Krise aber vor allem auf den Bundeskanzler ankommen. Doch offenbar ist auch Olaf Scholz bis heute nicht in der neuen Welt angekommen. Seit der Kanzler am 27. Februar im Bundestag seine „Zeitenwende“ verkündete – immerhin nur drei Tage nach dem von Putin befohlenen Überfall auf die Ukraine –, hat er es versäumt zu erklären, was darunter konkret zu verstehen ist. Doch die Verkündung einer Zeitenwende ist das eine, ihre tatsächliche Umsetzung etwas völlig anderes. Scholz wird es sich schwerlich ein zweites Mal leisten können, seine Regierungsparteien, insbesondere die eigene SPD, aber auch die Grünen, mit einem – unter normalen Umständen hochumstrittenen – 100-Milliarden- „Sondervermögen“ (sprich Schulden) vor vollendete Tatsachen zu stellen und damit regelrecht zu überrumpeln. Derartige einsame Entscheidungen, wie sie Adenauer direkt nach dem Kriege und in einer hoch-autoritären Gesellschaft noch unwidersprochen fällen konnte, sind in der heutigen liberalen, mitsprache-orientierten Teilhabe-Gesellschaft normalerweise gar nicht durchzusetzen.
Um die Mehrheit der Bevölkerung, aber auch die eigene Koalition zu überzeugen, wird es entscheidend auf die Kommunikation der riesigen Probleme, insbesondere der erforderlichen Zumutungen, durch den Kanzler ankommen. Bisher kann davon jedoch nicht die Rede sein, im Gegenteil: Scholz größte Schwäche, seine gering ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und der daraus resultierende „Erklärungsgeiz“,[7] schlägt gerade jetzt negativ zu Buche. „Never complain, never explain“ (niemals beklagen, niemals erklären), lautet, angelehnt an das Leitprinzip der Queen, die Devise des Kanzlers. Will heißen: Begründe nichts, sondern lasse die Fakten sprechen. In einer beispiellosen Krise wie der jetzigen ist dies schlichtweg zu wenig. Auch wenn es keine Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede sein muss: Es gilt, das Land auf neue, härtere Zeiten einzustimmen. Der Einzige, der dies in der Kriegs- wie auch in der Klimafrage bisher hinreichend versucht, ist Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die Bevölkerung dankt es ihm durch steigende Zustimmungswerte.
Im Falle des Kanzlers konnte man dagegen den Eindruck gewinnen, die einzigartige historische Herausforderung habe seine Neigung zu einsamen Entscheidungen noch verstärkt. Seine Bevorzugung autoritären Durchregierens erweist sich heute als fatal: Denn ohne die öffentliche Erklärung seiner Politik, und zwar nicht nur bei einzelnen Talkshow-Auftritten, wird er, aber auch das Land, die historischen Herausforderungen nicht bewältigen können.
Wie hatte der Kanzler noch während der Haushaltsdebatte am 23. März erklärt? Es mache ihm Mut, dass dieses Land in der Krise über sich hinauswachse. Ein Satz, der auf ihn zurückfällt: Denn nur wenn Olaf Scholz in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren selbst kommunikativ über sich hinauswächst, wird er dem Land jenen Mut zur Veränderung geben können, den es zur Lösung der gewaltigen Probleme so dringend braucht.
[1] Vgl. dazu den Beitrag von Klaus-Dietmar Henke in diesem Heft.
[2] Siehe dazu Albrecht von Lucke, Putins Krieg: Das Ende unserer Illusionen, in: „Blätter“, 4/2022, S. 59-66.
[3] Vgl. dazu den Beitrag von Miguel de la Riva in diesem Heft.
[4] So der eigentlich vernünftige FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff, in: „Die Zeit“, 14.4.2022.
[5] Ders., a.a.O.
[6] Albrecht von Lucke, Ampel auf Grün: Die sozial-ökologisch-liberale Illusion?, in: „Blätter“, 11/2021, S. 5-10.
[7] Boris Herrmann, Ein gewisser Erklärungsgeiz, in: „Süddeutsche Zeitung“, 6.4.2022.