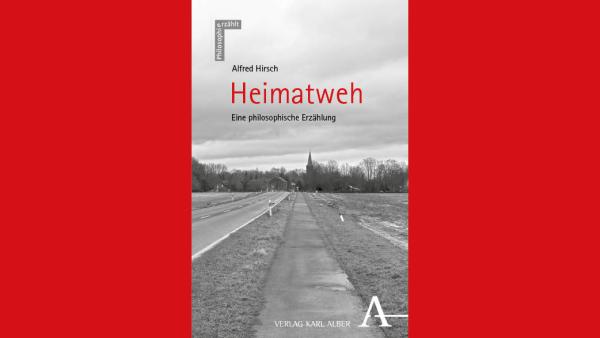Bild: Weiß-rote Bänder an einem Zaun als Zeichen des Protests in Belarus (IMAGO / Pond5)
Das Gedächtnis ist eine knifflige und äußerst unbeständige Sache. Mit jeder neuen „Schicht“ an Erfahrungen wird der Inhalt unserer Erinnerungen beständig verändert. Wir sind von Natur aus wirklich nicht gut darin, uns Dinge zu merken, und die Aussichten werden angesichts unseres blinden Vertrauens in mobile Geräte und das sogenannte Silikongedächtnis nicht besser. Repressive Regime nutzen das kollektive Gedächtnis jedoch immer wieder als einen Raum, in dem sich die Geschichte fälschen lässt, und setzen alles daran, dass neue Generationen bestimmte „unbequeme“ Episoden oder störende Meinungsführer vergessen oder sich falsch an sie erinnern. Drei Jahre nach der größten Protestbewegung in der Geschichte meines Heimatlandes Belarus scheint das Land in eine Fabrik der Amnesie verwandelt zu werden.
Erst unentschuldbar spät las ich über die „desaparecidos“ – über die repressive Strategie des Verschwindenlassens durch den unterdrückenden Staat oder eine politische Organisation, gefolgt von der Weigerung, das Schicksal oder den Aufenthaltsort dieser Person bekannt zu geben. Den herrschenden Militärjuntas erschien dies günstig: Da keine Leichen gefunden wurden, konnten keine Anklagen erhoben und auch keine Gerichtsverfahren begonnen werden. Schon die ungefähre Zahl der Verschwundenen ist kaum vorstellbar: 30 000 Opfer in Argentinien und über 2000 in Chile. Von keinem dieser Menschen wurden jemals Spuren gefunden.
In Argentinien wurde das Schweigen jedoch schnell gebrochen, und zwar von jenen, für die das Erinnern eine Pflicht war – den Aktivistinnengruppen der Mütter und Großmütter der Plaza de Mayo. Sie wurden 1977 spontan von Verwandten der Verschwundenen gegründet und verlangten Gerechtigkeit mit regelmäßigen Protesten auf dem gleichnamigen Platz in Buenos Aires. Die Unmöglichkeit, über den Verlust trauern zu können, verlagerte das Trauma in eine ewige Gegenwart – die Toten waren immer noch da und mit ihren verzweifelten Familien umkreisten sie auf Fotos und selbstgemachten Plakaten den Platz, stets begleitet von derselben Frage: „Wo sind diese Menschen?“
Als ich über die Mobilisierungen zur Bewahrung des Gedächtnisses in Lateinamerika las, konnte ich gar nicht anders, als ein heftiges Déjà-vu-Gefühl zu verspüren. All diese Frauen mit Schwarz-Weiß-Portraits ihrer Lieben, die Lippen fest aufeinander gepresst, die Gesichter eisern entschlossen. Ich entdeckte, dass die Tragödie der Verschwundenen sich nicht nur jenseits des Ozeans abspielte – sondern auch zur Realität meines Landes gehörte. Und bis heute gehört.
Zum Schweigen gebracht
Leider erwies sich der Argentinier Jorge Videla nicht als der letzte Diktator, der Oppositionelle entführen ließ und dann verlangte, man solle eine neue Seite aufschlagen. Vielmehr gehören Auslöschung und das folgende Schweigen des Staates auch zu den Instrumenten des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Seit seiner ersten Amtszeit ging er auf Nummer sicher, indem er jeden Rivalen eliminieren ließ, der den Thron seines Landes hätte erobern können. Zu den bekanntesten Fällen belarussischer „desaparecidos“ gehören die Politiker Juri Sacharenko und Viktor Gonchar, der Unternehmer Anatol Krasovsky sowie der politische Journalist und Kameramann Dmitri Sawadski. Im Jahr 2004 gründeten Iryna Krasovskaya und Swetlana Sawadskaya, die Ehefrauen der Verschwundenen, die gemeinnützige Stiftung „We Remember“.[1]
Ihr Ziel ist es, die Verantwortlichen für die Morde an ihren Partnern vor Gericht zu bringen. Doch obwohl private Ermittlungen den Plan hinter diesen „perfekten Morden“ aufgedeckt haben, von denen es mehr als 30 gegeben hat, musste sich bislang kein Staatsdiener für die Entführungen vor Gericht verantworten[2]. Hingegen wurde Pawel Scheremet, der diesen Plan gemeinsam mit Swetlana Kalinkina in ihrem Buch „Der zufällige Präsident“ aufgedeckt hatte, 2016 von unbekannten Tätern ermordet.
Nach diesem lauten Vorgehen in den späten 1990er Jahren griff Lukaschenko zu einer anderen Methode, um den Dissens zum Schweigen zu bringen. Oppositionsführer durften ihre Meinung nun äußern – aber nur bis zu einem gewissen Grad. Denn das Regime lässt sie nicht mehr entführen, sondern aufgrund von absurden Vorwürfen anklagen und ins Gefängnis stecken. Sodann verbreitet es nur wenige oder gar keine Nachrichten über ihre körperliche und seelische Verfassung. Wir kennen also scheinbar den Aufenthaltsort dieser Menschen, aber was bedeutet das unter diesen Umständen schon? Sie werden von der Öffentlichkeit ausgeschlossen, medizinische Hilfe wird ihnen verweigert, und sie müssen monotone, gesundheitsgefährdende Arbeiten verrichten. Damit sind sie in Wirklichkeit die belarussischen „desaparecidos“. Von den 24 Präsidentschaftskandidaten, die bei den fünf Wahlen nach 1994 gegen Lukaschenko antraten, wurden sieben inhaftiert, weitere vier sahen sich Gewalt und Drohungen ausgesetzt. Zusammen kommen Lukaschenkos Konkurrenten um die Staatsspitze auf über 60 Jahre Haft.
Dem Menschenrechtszentrum Wjasna zufolge gibt es in Belarus derzeit rund 1500 politische Gefangene. Im Jahr 2020 lag die Inhaftierungsrate bei 345 Gefangenen pro 100 000 Einwohner. Belarus gehört damit weltweit zu den 20 Staaten mit der höchsten Rate – als einziges europäisches Land neben der Türkei. Verurteilt wurden die politischen Gefangenen, weil sie „Absichten“ geäußert, „verurteilendes Schweigen“ gezeigt, „mentale Solidarität“ geleistet haben oder gar, weil sie „stillschweigend zugestimmt“ haben. Unter ihnen finden sich Teenager, Rentner und Mütter mit kleinen Kindern. Mit Stand Sommer 2022 beliefen sich ihre Strafen zusammengenommen auf 2756 Jahre. Dennoch enthalten die Schulbücher für das Fach Geschichte, die 2021 neu geschrieben wurden und die Zensur des kollektiven Gedächtnisses betreiben, nur drei Zeilen über die Massenproteste von 2020 und ihre verheerenden Folgen: „Die sechsten Präsidentschaftswahlen fanden am 9. August 2020 statt. Bei fünf anderen Kandidaten erhielt der gegenwärtige Präsident 80,1 Prozent der Stimmen.“
Erzwungene Amnesie
In Belarus fallen jedoch inzwischen nicht nur Menschen unter die erzwungene Amnesie. Derzeit finden die Kämpfe um das kollektive Gedächtnis auch in Bildung, Kultur und Medien statt. In den vergangenen drei Jahren wurden 37 Medienschaffende verhaftet, alle nichtstaatlichen Medien für „extremistisch“ erklärt und verboten und um die 300 NGOs zwangsweise geschlossen.
Die Namen und Geschichten einst populärer Kunst- und Kulturprojekte haben sich neue Eigentümer angeeignet, deren Agenda keine politische Kritik mehr enthält. Das gilt beispielsweise für die jährliche Kunstausstellung „Herbstsalon“ der Belgazprombank. Deren Direktor, der ehemalige Präsidentschaftskandidat Wiktar Babaryka, wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt, und die Ausstellung wird nun von neuen, regimetreuen Personen geleitet. Ruhig und gehorsam.
Verbannte Farben
Eine lächerliche, aber bezeichnende Episode aus dem kulturellen Feld betrifft die jüngst angelaufene Fernsehserie „Eine halbe Stunde vor dem Frühling“, ein Biopic über die populäre sowjetisch-belarussische Folk-Rockband „Pesnjary“. Eine Rolle in dieser Serie wird von Dmitriy Esenevich gespielt, ein ehemaliges Ensemblemitglied des Kupalovsky-Theaters, der 2021 zusammen mit 58 anderen Darstellern auf die schwarze Liste des belarussischen Kulturministeriums geriet, auf der Menschen mit der „falschen“ Haltung stehen. Da sie ihn nicht komplett aus der Serie entfernen konnten, griffen die Behörden zu einer radikalen, aber ästhetisch verstörenden Maßnahme: Esenevich erscheint zwar auf dem Bildschirm, aber entweder ist sein Gesicht verschwommen oder es werden nur Teile seines Körpers gezeigt.
Im heutigen Belarus ist es auch unerwünscht und sogar gefährlich, in der Öffentlichkeit bestimmte Farben zu zeigen. Nach den massiven Protesten gegen die gefälschten Präsidentschaftswahlen von 2020, die mit der brutalen Bekämpfung der Zivilgesellschaft endeten, führten weiß-rote Kleidungsstücke, Schals, Socken, Armbänder, Vorhänge und sogar Süßigkeiten oftmals zu Verhaftungen. Das Regime verknüpft die Kombination dieser Farben mit Extremismus und leugnet ihre historische Bedeutung als offizielles Staatssymbol zwischen 1918 und 1919 sowie zwischen 1991 und 1995. Weil er rot-weiße, „extremistische“ Bänder beschützte, wurde im November 2020 der Künstler Roman Bondarenko von Leuten mit Sturmhauben in seinem eigenen Hof totgeschlagen – die unbekannten Täter waren dort, um sie abzuschneiden. Für den 31jährigen Aktivisten war es eine Frage der Ehre, für die Farben seines Landes einzustehen. Doch trotz zahlreicher dokumentierter Fälle von Gewalt, Einschüchterung und Folter an den Gefangenen ist seit August 2020 kein Vertreter der Sicherheitsbehörden vor Gericht gestellt oder verurteilt worden.
Recht auf Erinnerung
Wenn ich über die belarussischen „desaparecidos“ und die Fabrik der Amnesie nachdenke, die das Regime mit großem Aufwand errichtet, kommt mir eine einfache, aber sehr wahre Aussage in den Sinn, auf die ich in dem Buch „The Impossible City“ der aus Hongkong stammenden Schriftstellerin Karen Cheung stieß: „An einem Ort, an dem es Dir nie erlaubt wurde, Deine eigene Geschichte zu schreiben, kann selbst das Erinnern zu einer radikalen Handlung werden.“ Als ich das las, sah ich vor meinem inneren Auge drei Länder, drei Kämpfe und drei Geschichten über den Widerstand gegen die Amnesie, die sich zu einer mächtigen kultur- und generationsübergreifenden Aussage verbinden – ein Versprechen, für das Recht auf Erinnerung einzutreten.
Den Großmüttern der Plaza de Mayo gelang es, 120 als Kinder verschleppte Erwachsene aufzufinden, von denen die Junta wollte, dass sie sie vergessen. Ihr 30jähriger Kampf hatte Früchte getragen. Solche Geschichten sollten uns Hoffnung geben. Wenn uns nur wenige Mittel zum Widerstand bleiben, so können wir doch in der Pflege und Weitergabe unserer Erinnerung radikal bleiben.
Aus dem Englischen von Steffen Vogel.
[1] Vgl. www.ciwr.org
[2] Pawel Scheremet und Swetlana Kalinkina, Slutschainyi President, St. Petersburg 2004, S. 159.