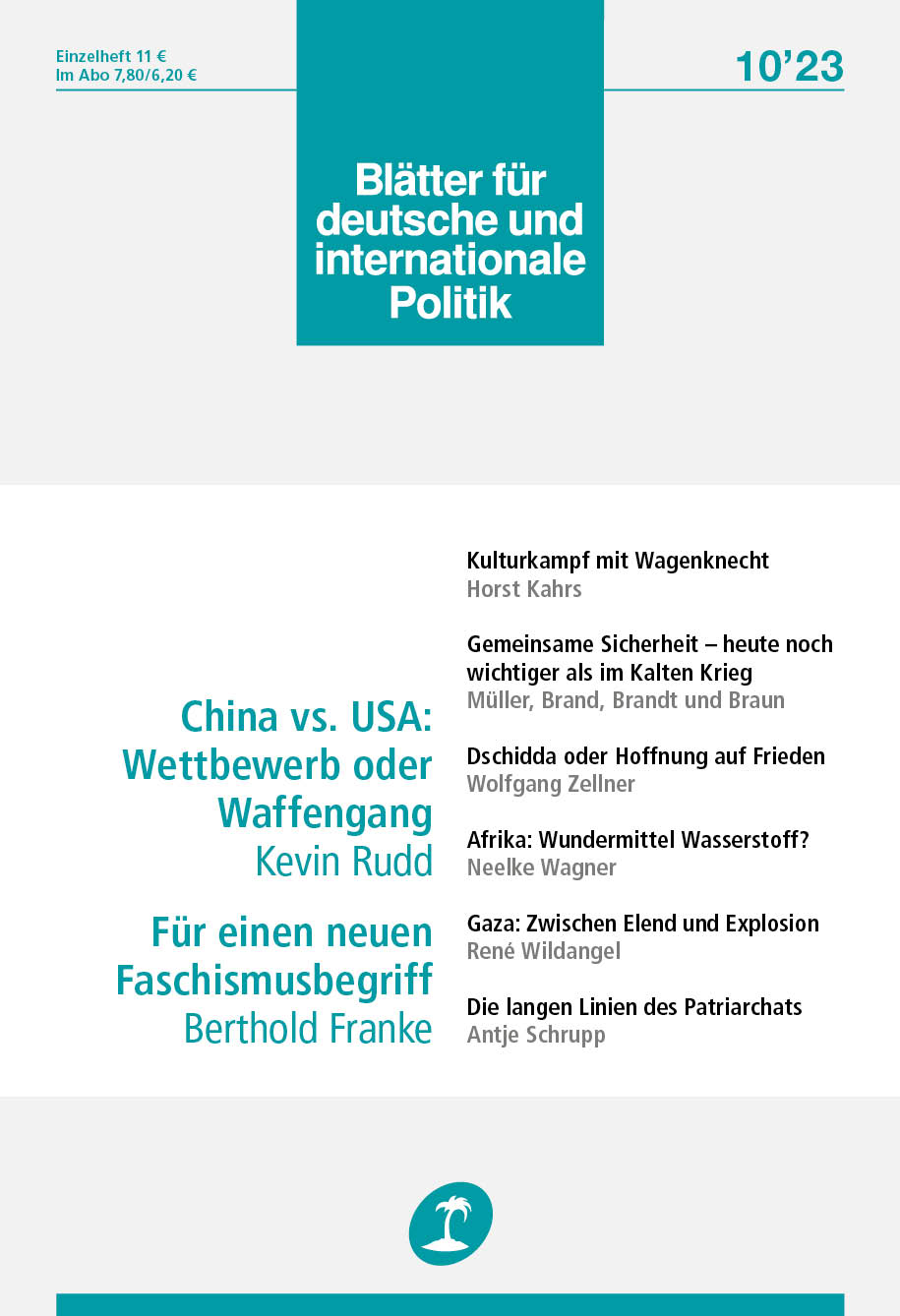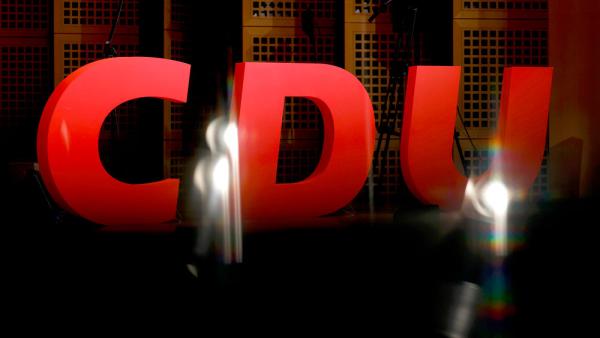Bild: Markus Söder und Friedrich Merz auf dem CSU-Parteitag in München, 23.9.2023 (IMAGO / Chris Emil Janßen)
Wenn eines Tages die Geschichte des deutschen Konservatismus bilanziert werden wird, könnte dem Herbst 2023 eine entscheidende Bedeutung zukommen – als eine fatale Weichenstellung. Zu Recht richtet sich angesichts des scheinbar unaufhaltsamen Aufstiegs der AfD das Augenmerk auf das desaströse Agieren der Ampel-Regierung.[1] Nicht weniger entscheidend ist jedoch die Frage, wie es die angestammte konservative Formation aus CDU/CSU mit den Rechtspopulisten hält. Oder schärfer ausgedrückt: Noch mehr als mit dem Versagen der Regierung hat der Höhenflug der AfD mit dem Versagen der Union zu tun.
Tatsächlich war die Union als bürgerlich-konservative Sammlungsbewegung in der Geschichte der Bundesrepublik lange der Garant dafür, dass sich keine rechtsradikale Partei etablieren konnte. „Rechts von uns ist nur noch die Wand“, lautete die bekannte Devise des langjährigen bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß. Mit dem Aufkommen der AfD und dem Erstarken der Freien Wähler geht dieses Konzept jedoch nicht mehr auf.
Die alten Zeiten hatten insofern einen fundamentalen Vorteil: Der Gegner stand immer nur links. Nach rechts dagegen wurde gesammelt, durchaus mit markigen, populistischen Reden. Heute ist die Lage eine völlig andere. Und dafür trägt maßgeblich die Union selbst die Verantwortung.
Zur Erinnerung: Schon zur Jahresmitte 2015 befand sich die nur zwei Jahre zuvor gegründete AfD klar im Abschwung. Hätte damals, auf dem Höhepunkt der Fluchtkrise, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), getrieben von einem, so Seehofer, von „Ehrgeiz zerfressenen“ Markus Söder, nicht frontal gegen die Bundeskanzlerin agitiert – mit dem unsäglichen Satz „Die Migration ist die Mutter aller Probleme“ –, sondern sich an die Seite von Angela Merkel gestellt und ihr „Wir schaffen das“ unterstützt, dann wäre die AfD schon damals nicht so enorm revitalisiert worden. Doch anstatt die Herausforderung der Migration gemeinsam und entschlossen anzugehen, kam es beinahe zur Trennung der Schwesterparteien, ging die CSU fast bis zur Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft. Und nachdem Seehofer die Kanzlerin öffentlich gedemütigt hatte, konnte der damalige AfD-Chef Alexander Gauland die desaströse Lage im Dezember 2015 nur als „Geschenk“ für seine Partei bezeichnen.
Seither sind viele weitere Geschenke der Union für die AfD hinzugekommen, wobei das wohl größte am 14. September dieses Jahres erfolgte.
An diesem Tag beschloss die CDU gegen die rot-rot-grüne Minderheitsregierung im Thüringer Landtag ein Gesetz zur Senkung der Grunderwerbssteuer von 6,5 auf 5 Prozent – und zwar sehenden Auges mit den erforderlichen Stimmen von AfD und FDP. Damit wiederholten sich in gewisser Weise die Ereignisse vom 5. Februar 2020: Damals hatten CDU und FDP gemeinsam mit der AfD den FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt, was schließlich zum Rücktritt der machtlosen Annegret Kramp-Karrenbauer vom CDU-Parteivorsitz führte.
Im jüngsten Fall hatte CDU-Parteichef Friedrich Merz noch in seinem ARD-Sommerinterview am 27. August, nach der Wahl des ersten AfD-Landrats in Südthüringen[2], erklärt, dass der Abgrenzungsbeschluss gegenüber den Rechtspopulisten zwar nicht in den Kreistagen oder Stadträten gelte, dass er aber auf Landes- und Bundesebene jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausschließe. Genau darin sollte die Brandmauer gegenüber der AfD bestehen.
Nun ist mit dem 14. September die Brandmauer zwar noch nicht ganz gefallen, das wäre erst im Falle einer Koalition mit der AfD der Fall. Aber die Thüringer Union hat ein riesiges Loch in diese Mauer gerissen – und zwar nach Absprache und mit ausdrücklicher Zustimmung von Merz.
Wer eine solche Zusammenarbeit dagegen bestreitet, weil es keine vorangegangene ausdrückliche Absprache mit der AfD gegeben habe, argumentiert rein formalistisch. Eine Partei, die wie die CDU auf die Stimmen der AfD angewiesen ist und deren Zustimmung für den eigenen Antrag bewusst in Kauf nimmt, arbeitet faktisch mit den Rechtspopulisten zusammen. Ja mehr noch: Die CDU macht die AfD damit zum Gesetzgeber in einer eminent wichtigen Materie, nämlich dem Haushalt – also im Kernbereich dessen, was das Parlament auf Landesebene zu entscheiden hat. Was sonst als die eben noch von Merz ausgeschlossene Zusammenarbeit auf Landesebene sollte das sein?
Fest steht: Größere Gestaltungsmacht hatten die Rechtspopulisten in der Bundesrepublik bisher noch nie. Und gerade weil es sich dabei tatsächlich um einen Tabubruch handelt, versammelten sich diesmal, anders als noch nach Merz‘ „verunglücktem“ Sommerinterview, sogar dessen vehementeste Kritiker hinter dem eigenen Vorsitzenden – schon um den Riss in der Union vor den so wichtigen Landtagswahlen in Bayern und Hessen am 8. Oktober nicht noch größer werden zu lassen. Mit einer Ausnahme allerdings, dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther, der von einem „schwerwiegenden strategischen Fehler“ spricht, und einem beredten Schweiger, dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, der wie Günther und Boris Rhein in Hessen schwarz-grün regiert.
Der Triumph der AfD
Wer dagegen das Ereignis genüsslich ausschlachtet, ist die AfD. „Merz’ ,Brandmauer‘ ist Geschichte – und Thüringen erst der Anfang“, jubelte die Parteivorsitzende Alice Weidel. Und das keineswegs zu Unrecht: Denn natürlich wird die AfD mit diesem Beschluss weiter salon- und sukzessive regierungsfähig gemacht. Im Verständnis der Rechtspopulistin soll diese erste relevante Beteiligung an einer gemeinsamen Gesetzgebung denn auch nur der erste Schritt zu einer dann vollständigen Zusammenarbeit auf koalitionärer Grundlage sein.
Und dabei zielt sie auf jene Kräfte in den Reihen der Ost-CDU, die schon lange auf eine Kooperation mit der AfD setzen, weil ihnen diese viel näher ist als SPD, Grüne oder gar die Linkspartei. Es gebe etliche Parteifreunde, die eine Zusammenarbeit mit der AfD herbeisehnten oder „mindestens eine Tolerierung“, sagte jüngst Marco Wanderwitz, der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, dem „Spiegel“.[3]
Faktisch erleben wir, von Thüringen ausgehend, einen fatalen Normalisierungsprozess der AfD. Das ist insofern regelrecht paradox, da gerade dieser Landesverband – geleitet vom heimlich-unheimlichen Anführer Björn Höcke, derzeit angeklagt wegen der Verwendung des SA-Spruches „Alles für Deutschland“ – besonders radikal ist und vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft wird. Das heißt: Parallel zur Radikalisierung der AfD speziell in Thüringen betreibt die dortige Union deren Normalisierung.
Hier zeigt sich eine ganz fatale Tradition der angeblich bürgerlichen Parteien, die vor 93 Jahren ironischerweise just im „Musterland“ Thüringen ihren Anfang nahm. Am 23. Januar 1930 konnten die Nationalsozialisten dort ihre erste Beteiligung an einer deutschen Landesregierung eingehen, von Adolf Hitler ausdrücklich als großer Erfolg gelobt und als Experimentierfeld bezeichnet. Und zwar völlig zu Recht: Denn Thüringen sollte nur das Vorspiel sein für die drei Jahre später stattfindende Machtübertragung an die NSDAP im Deutschen Reich.
Springen wir in die Jetztzeit, dann sehen wir, dass schon nach der letzten Wahl im Jahr 2019 der damalige stellvertretende Thüringer CDU-Fraktionschef Michael Heym befand, es gebe ja „eine bürgerliche Mehrheit rechts“, nämlich CDU, FDP und AfD, die man nutzen könne. Mit dem gemeinsamen Gesetzesbeschluss sind die „Bürgerlichen“ in dieser Hinsicht nun einen wichtigen Schritt weiter.
Die Konsequenzen sind fatal: Sollten sich nämlich die derzeitigen Umfragen bestätigen und die AfD tatsächlich klar stärkste Partei bei der Landtagswahl am 1. September 2024 werden, könnte sie sich mit Fug und Recht auf das Motto berufen, das die CDU nach den letzten Berliner Abgeordnetenhauswahlen mit Erfolg anstimmte: „Die stärkste Partei muss den Bürgermeister stellen“, vulgo in Thüringen: den Ministerpräsidenten.
All das zeigt, in welch verfahrene Situation sich die Union speziell in Thüringen, aber auch insgesamt im Umgang mit den Rechtspopulisten manövriert hat. Dabei wäre es ein Leichtes, die AfD an ihren verheerenden Positionen offensiv zu attackieren. Denn diese haben wenig bis nichts mit der aufgeklärt-konservativen pro-europäischen Tradition eines Konrad Adenauer oder Helmut Kohl zu tun. Dabei beruft sich die AfD als vormalige „Merkel-muss-weg-Partei“ gerade auf die vorangegangene Kohl- und Adenauer-Ära.
Reaktionärer Backlash
Erstes Beispiel für den reaktionären Backlash der AfD sind deren isolationistische Positionen in der EU-Politik, die der jüngste Europa-Parteitag in Magdeburg erneut demonstriert hat. Zwar distanzierte sich die AfD von ihrer vormaligen Forderung nach einer Auflösung der EU, sie hält diese aber weiter „für nicht reformierbar“ und sieht sie „als gescheitertes Projekt“. Daher heißt es in der Präambel zum AfD-Wahlprogramm für die Europawahl 2024, „streben wir einen ‚Bund europäischer Nationen‘ an, eine neu zu gründende europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft, in der die Souveränität der Mitgliedstaaten gewahrt ist.“ Da kein anderer Staat so sehr wie die Exportnation Deutschland von der EU profitiert, wäre ein derartiger Neugründungsprozess ein aberwitziges Unterfangen mit fatalen ökonomischen Auswirkungen für das Land. Ganz zu schweigen vom geostrategischen Bedeutungsverlust gerade auch Deutschlands als europäischer Führungsnation im Falle einer Auflösung der EU.
Das zweite Beispiel für die reaktionäre Haltung der AfD ist deren Geschichtspolitik: In ihrem ARD-Sommerinterview vom 10. September begründete AfD-Chefin Alice Weidel, die auch als mögliche Kanzlerkandidatin ihrer Partei gehandelt wird, warum sie, anders als ihr Co-Vorsitzender Tino Chrupalla, im Mai nicht am Empfang in der russischen Botschaft in Berlin teilgenommen hatte – und zwar nicht etwa mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sondern sie sagte wortwörtlich, „hier die Niederlage des eigenen Landes zu befeiern mit einer ehemaligen Besatzungsmacht, das ist etwas, wo ich für mich persönlich entschieden habe – auch mit der Fluchtgeschichte meines Vaters – daran nicht teilzunehmen“. Damit bricht sie mit der seit vier Jahrzehnten anerkannten Bewertung des Kriegsendes als einem „Tag der Befreiung“, die Bundespräsident Richard von Weizsäcker (CDU) gegen schwere Widerstände mit seiner kanonischen Rede vom 8. Mai 1985 dem ganzen Land, aber auch speziell den Konservativen ins Stammbuch geschrieben hatte. Heute dagegen wieder von einem „Tag der Niederlage“ zu sprechen, ist nichts anderes als jene geschichtspolitische 180-Grad-Wende, von der Björn Höcke immer geträumt hat. Und dennoch traut sich die Union nicht, die AfD wenigstens an diesen beiden zentralen Punkten scharf zu kontern, sondern sie beschweigt deren reaktionäre Haltung und schmiegt sich an die Populisten an. Auf diese Weise versucht die Union, bei deren reaktionären Forderungen mitzuhalten, ja sie teilweise noch zu überbieten, um so die Wählerinnen und Wähler der AfD abzuwerben. Auch das normalisiert die AfD und deren Narrative. Das zeigt vor allem das dritte und für den Aufstieg der AfD wichtigste Kampffeld: die Migrationspolitik.
Angesichts der Tatsache, dass immer mehr überforderte Kommunen die weiße Flagge hissen, ist es dringend geboten, eine möglichst parteiübergreifende Lösung zu finden – und zwar auf europäischer Ebene, wie es Bundesinnenministerin Nancy Faeser gegen alle europäischen Widerstände durchaus versucht. Doch was macht die Union stattdessen?
Taktisch durchaus clever bezieht sich CSU-Chef Söder auf den von Bundeskanzler Olaf Scholz geforderten parteiübergreifenden „Deutschlandpakt“ und verlangt einen solchen „für geregelte Migration“. Doch mit welchem konkreten Inhalt? Der Wahlkämpfer Söder fordert eine „Integrationsgrenze“ und bezieht sich dabei auf das Seehofersche Konzept der „Obergrenze“: „Das Modell der alten und von der CSU durchgesetzten Begrenzung von höchstens 200 000 Migranten pro Jahr hat übrigens unter der großen Koalition funktioniert“, so Söder. Andernfalls „gefährden wir die Stabilität unserer Demokratie“, so der CSU-Chef denkbar alarmistisch, denn: „Unser Land befindet sich ohnehin auf dem Weg in eine destruktive Demokratie von AfD und jetzt auch Wagenknecht.“[4]
Was Söder dabei wohlweislich verschweigt: Bereits Ende August, also nach zwei Dritteln des Jahres, zählte das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge knapp 205 000 Erstanträge auf Asyl.[5] Sollen also ab jetzt, Söder zufolge, alle weiteren Flüchtlinge ihr Recht auf Prüfung ihres Asylantrags eingebüßt haben, nach der rechtlich absurden Devise: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst? Das zeigt die ganze Absurdität des Vorschlags: Denn selbst wenn man die Zahl jetzt auf 300 000 erhöhen wollte, hätte nach unserem Grundgesetz wie nach dem internationalen Flüchtlingsrecht auch der 300 001ste den indiviuellen Anspruch auf Prüfung seines Rechts auf Schutz vor Verfolgung. All das macht Söders Schnellschuss verfassungswidrig und damit zugleich höchst kontraproduktiv. Indem er sich mit einer nicht durchsetzbaren Forderung erneut als Hardliner geriert, wird seine Position zu einer Steilvorlage für die AfD.
Hier aber zeigt sich das vielleicht grundsätzlichste Problem der Union, speziell von Markus Söder, aber inzwischen auch von Friedrich Merz. Söder hat sich derart an die angeblich „bürgerliche Koalition“ mit den Freien Wähler gekettet, dass er jetzt nicht mehr von ihr loskommt. Und Merz hat sich seinerseits so sehr an Söder gebunden, dass er sich von dessen Rechtskurs nicht mehr distanzieren kann – und dies auch gar nicht will.
Die Causa Aiwanger
All das belegt das zweite hoch relevante Ereignis der letzten Wochen, nämlich der „Fall Aiwanger“ – infolge der Publikation des Aiwangerschen[6] Auschwitz-Pamphlets aus dem Jahre 1987 durch die „Süddeutsche Zeitung“. Dass Söder seinen ganzen Wahlkampf auf die Fortsetzung der „bürgerlichen Koalition“ mit den Freien Wählern zugeschnitten hat, war zweifellos der eigentliche, primär taktische Grund dafür, warum er seinen stellvertretenden Ministerpräsidenten nicht entlassen hat, trotz Aiwangers viel zu später und wenig glaubwürdiger „Entschuldigung“. Hinzu kam die berechtigte und auch von Charlotte Knobloch, der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, geteilte Sorge, dass bei einer Entlassung Aiwangers dieser vollends zum bayerischen Robin Hood und populistischen Rächer der „schweigenden Mehrheit“ geworden wäre.
Der Fall Aiwanger zeigt einmal mehr: Söder denkt nicht langfristig strategisch, sondern immer nur kurzfristig taktisch, diesmal allein auf die bayerische Landtagswahl konzentriert – und damit voll gegen die Grünen ausgerichtet wie auf das Bündnis mit Aiwanger vergattert, und zwar über den 8. Oktober hinaus.
Söder hat damit die Weichen für die CSU in fataler Weise gestellt. Er hat nämlich nicht nur Aiwanger faktisch einen Persilschein ausgestellt, sondern vor allem, und das ist die vielleicht noch wichtigere politische Dimension, einer Koalition mit den Grünen eine fundamentale Absage erteilt: „Sie passen nicht zu Bayern“, so Söder auf dem Gillamoos-Volksfest. Ausgerechnet der Mann, der im letzten Wahlkampf publikumswirksam scheinbar jeden Baum umarmte, um damit zu signalisieren, dass er grüner sei als die Öko-Partei, setzt diesmal allein auf die Bewirtschaftung des grassierenden Ressentiments, ja Hasses gegen die Grünen.
Und indem sich wiederum Merz voll an Söder gebunden hat – dieser habe die Causa Aiwanger „bravourös gelöst“, O-Ton Merz, und „Kreuzberg ist nicht Deutschland, Gillamoos ist Deutschland“ – steckt der CDU-Chef ebenfalls voll in der Populismusfalle. Denn auf derartige Polemik gegen die „rot-grün-versiffte Republik“ (Jörg Meuthen) hat bekanntlich die AfD das Copyright und wird daher letztlich bei Wahlen als das Original immer der Gewinner sein. Deshalb ist es nicht nur inhaltlich fatal, sondern auch wahltaktisch kontraproduktiv, die Narrative der AfD zu bedienen, anstatt ihnen entschlossen entgegenzutreten.
Das aber verweist auf Söders und Merz‘ eigentlichen Irrweg: Der Hauptgegner steht in ihren Augen noch immer links. Deshalb agiert und agitiert die Söder-Merz-Union nicht primär gegen die AfD, sondern gegen die Grünen. Oder anders ausgedrückt: Die Union hat die Brandmauer gegen rechts nach links verschoben, als Abwehrbollwerk gegen die Grünen.
Das allerdings ist eine ausgesprochen kurzsichtige Entscheidung. Denn sollte die Union die Bundestagswahl 2025 tatsächlich gewinnen, auf die mit Sicherheit sowohl Merz als auch Söder schielen, wird man – schon mangels „bürgerlicher Alternative“ in Form Freier Wähler – als Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP regieren müssen, wenn man denn nicht eine weitere große Koalition anstreben will. Kurzum: Die „Strategie“ der Söder-Merz-Union, wenn man denn überhaupt von einer solchen sprechen kann, läuft bundespolitisch ins Leere.
Die entscheidende Frage bei alledem ist, ob die Union nun tatsächlich den Weg vieler konservativer Parteien in Europa in die rechts-autoritäre Ecke nachvollzieht[7] – oder ob sie noch einmal in der Lage ist, eine progressive Kraft im Lande zu sein.
„Konservativ sein heißt, an der Spitze des Fortschritts marschieren“, hatte einst Franz Josef Strauß denkbar paradox postuliert. Und derart progressiv-konservativ war die Union durchaus in der alten Bonner Republik, als Protagonistin der sozialen Marktwirtschaft auf Basis der katholischen Soziallehre. Ob ihr das noch einmal gelingt, wird entscheidend davon abhängen, ob sie die eigentliche konservativ-soziale Frage des 21. Jahrhunderts angeht, nämlich die ökologische.
Eigentlich müsste das voll in ihrer DNA liegen. Denn christlich-konservative Politik im Sinne der Bewahrung der Schöpfung bedeutet heute zweifellos, ökologisch zu denken und politisch nachhaltig zu agieren. Dagegen beweisen Söder und Merz, dass die Union immer bereit ist, einmal begangene Fehler, in diesem Fall das lange Ignorieren des ökologischen Themas, zu wiederholen. Denn einen christlich-progressiven Kurs schlägt man sicherlich nicht mit der Kopie populistisch-antigrüner Positionen der AfD ein.
Bis zu den beiden so wichtigen Landtagswahlen am 8. Oktober wird die Union jetzt versuchen, den Eindruck ihrer Geschlossenheit aufrechtzuerhalten, schon um ihre eigenen Wahlchancen nicht zu verringern. Danach allerdings dürfte – schon mit Blick auf die Bundestagswahl 2025 und die Nominierung des Kanzlerkandidaten im Herbst 2024 – der Richtungsstreit erneut und in aller Härte aufbrechen. Dann lautet die entscheidende Frage: Weiter mit Söder-Merz an der Seite der Freien Wähler in eine reaktionär-konservative Richtung – oder tatsächlich in eine progressiv-konservative, nämlich schwarz-grüne? Mit Hendrik Wüst, unterstützt von Daniel Günther, gibt es längst einen natürlichen Antipoden zur Achse Söder-Merz, der für einen schwarz-grünen Kurs steht. Dahinter stecken allerdings keineswegs lange gewachsene Überzeugungen – Wüst begann einst eher als nationalkonservativer Kulturkämpfer –, sondern durchaus auch wahltaktische Erwägungen. Denn als Anführer einer schwarz-grünen Koalition im mit Abstand stärksten Bundesland ist Wüst in der Union nicht nur natürlicher Kanzlerkandidaten-Anwärter, sondern zugleich der Protagonist einer möglichen schwarz-(gelb)-grünen Koalition auf Bundesebene.
Fest steht zugleich auch, dass Merz als Parteivorsitzender Wüst die Kanzlerkandidatur nicht kampflos überlassen wird. Harte Auseinandersetzungen zwischen den beiden Lagern sind daher vorprogrammiert. Wie hatte Kevin Kühnert der Union nach der Wahl des ersten AfD-Landrats in Sonneberg – natürlich völlig uneigennützig – geraten: „Es ist jetzt Zeit, wenn ich mir das erlauben darf als SPD-Generalsekretär zu sagen, für einen Richtungsstreit in der CDU.“[8] Kühnert hat recht: Der Richtungsstreit in der Union wird kommen, weil er tatsächlich notwendig ist. Er hat jedoch unrecht, wenn er glaubt, davon profitiere vor allem die SPD. Denn eine heillos zerstrittene, zu geschlossenem Regieren offenbar kaum fähige Ampelkoalition, und zugleich eine heillos zerstrittene CDU/CSU-Opposition drohen am Ende wieder nur einer Partei zu nützen: der AfD.
[1] Albrecht von Lucke, Gemeinsam nach unten: Das Elend der Ampel, in: „Blätter“, 8/2023, S. 5-8; ders.: Wagenknecht oder AfD-Verbot: Die letzte Chance?, in: „Blätter“, 9/2023, S. 5-8.
[2] David Begrich, AfD oder: Der Kampf um die ostdeutsche Zivilgesellschaft, in: „Blätter“, 8/2023, S. 9-12.
[3] „Der Spiegel“, 21/2023, 21.5.2023.
[4] „Bild am Sonntag“, 17.9.2023.
[5] Markus Balser und Simon Sales Prado, Asylpolitik: Die Nerven liegen blank beim Thema Migration, sueddeutsche.de, 11.9.2023.
[6] Ob das Pamphlet tatsächlich von Aiwangers Bruder Helmut oder doch von Hubert Aiwanger stammt, wird wohl nie endgültig geklärt werden. Insofern kommt in dieser Frage zu Recht die Unschuldsvermutung zum Tragen.
[7] Thomas Biebricher, Mitte/Rechts. Die internationale Krise des Konservatismus, Berlin 2023.
[8] Kevin Kühnert, „Merz ist offensichtlich König ohne Land“, zdf.de, 24.7.2023.