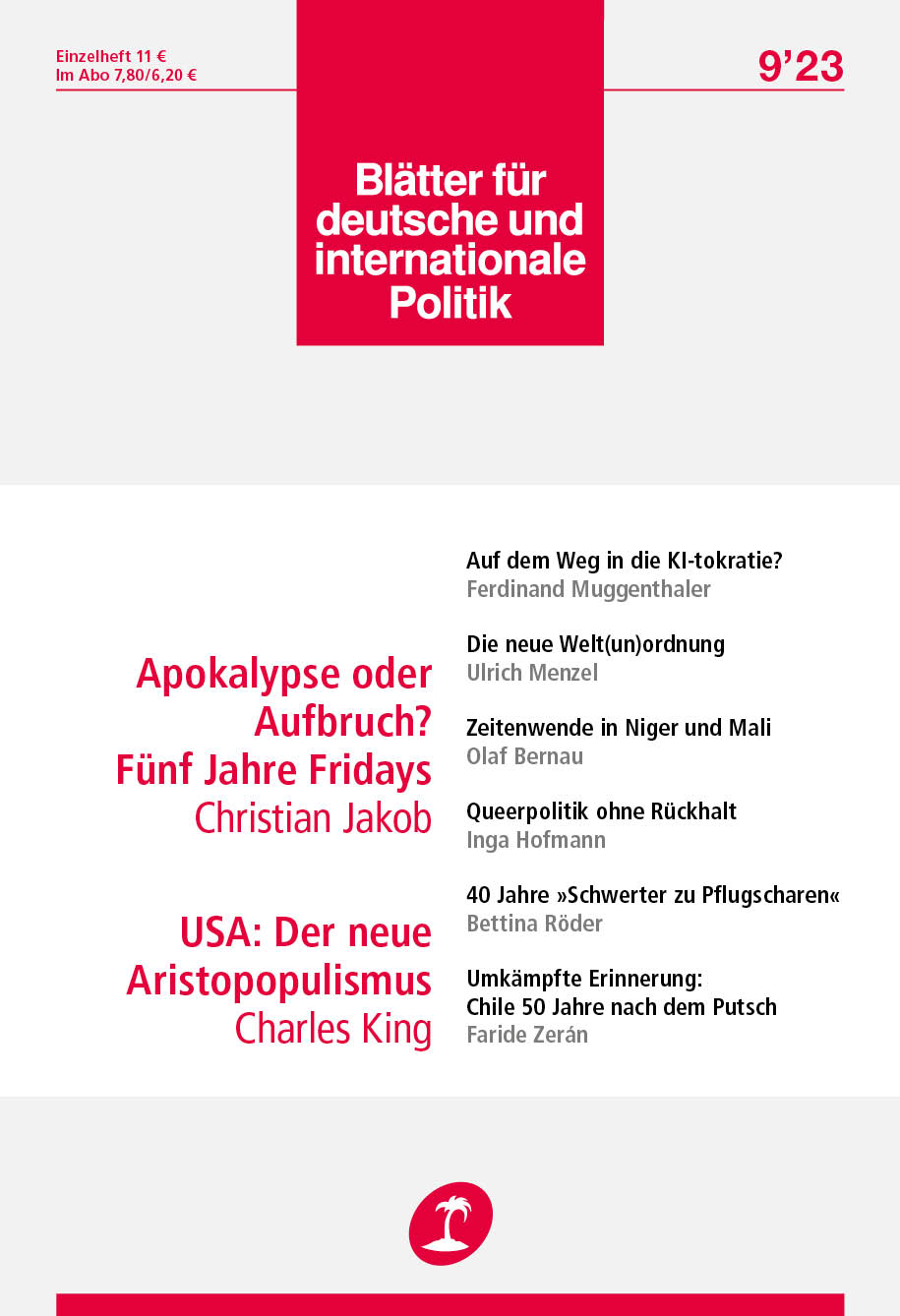Bild: Björn Höcke, 30.8.2019 (IMAGO / Emmanuele Contini) und Sahra Wagenknecht, 13.6.2023 (IMAGO / APress). Montage: Blätter für deutsche und internationale Politik
Mit „Frisch erholt in die Selbstzerfleischung“, kommentierte die „Süddeutsche Zeitung“ die Rückkehr der Ampel-Koalition aus der Sommerpause. Und die FAZ fragte aus gleichem Anlass und passend zur Verabschiedung des Cannabis-Gesetzes spöttisch: „Kann man sich eine solche Regierung schönrauchen?“[1]
Tatsächlich ist das Erscheinungsbild der Ampel fast nur noch mit Galgenhumor zu ertragen. Nach der Sommerpause scheint sie genau da weitermachen zu wollen, wo sie vor ihr aufgehört hat: mit hoch destruktivem Streit. Der desaströse Start in die zweite Hälfte der Legislaturperiode zeigt, wie verfahren die Lage inzwischen ist, speziell zwischen Grünen und FDP. Seit Beginn der Koalition hatte die FDP das Agieren gegen die Grünen zum Prinzip erklärt, exemplarisch zu beobachten beim Gebäudeenergiegesetz, aber auch bei der massiv herabgestuften Kindergrundsicherung. Faktisch hatte Finanzminister Christian Lindner die 12 Mrd. Euro auf einen „Platzhalter“ von zwei Mrd. heruntergeschrumpft und auf diese Weise Familienministerin Lisa Paus regelrecht vor die Wand laufen lassen.
Das war der Grund, warum Paus und andere Grüne des linken Lagers Lindners Wachstumschancengesetz ihre Zustimmung verweigerten – und damit der FDP glatt in die Falle gingen. Denn indem der Finanzminister trotzdem, wider besseres Wissen, eine Pressekonferenz ansetzte, um sie dann angeblich spontan wegen der grünen Verweigerung abzusagen, spielte er den Grünen den Schwarzen Peter zu. Waren zuvor eindeutig die Liberalen die destruktive Kraft, ist nun der Eindruck entstanden, dass die Grünen mit gleicher Münze zurückzahlen, womit sie sowohl den eigenen Vizekanzler, der Lindners Gesetz unterstützte, als auch den Kanzler düpierten, der eben noch ein neues, geschlossenes Auftreten versprochen hatte.
Parallel zur anhaltendenden Kakophonie der Ampel steigt der Zweifel an der Handlungs- und Leistungsfähigkeit dieser Regierung, ja sogar des Staates. Dadurch entsteht eine fatale Eigendynamik: In dem Maße, in dem die Regierung ihre Zerstrittenheit demonstriert, büßt sie zunehmend an Funktionsfähigkeit ein, was wiederum die Kritik an ihr immer weiter anwachsen lässt. Auf diese Weise gerät die Kritik an der Regierung und ihrer Handlungs(un)fähigkeit immer mehr zu einem Zweifel an der Demokratie als solcher.
All das ist natürlich ein enormer Wachstumsbeschleuniger für die AfD, die inzwischen auf dem zweiten Platz in der Wählergunst rangiert und die SPD auf den dritten Rang verdrängt hat – eine in der Geschichte der Bundesrepublik einzigartige Lage für eine Kanzlerpartei.
Wie aber sehen die Lösungsvorschläge mit Blick auf den Niedergang der Ampel und den Aufstieg der AfD aus? Die einen setzen, angesichts der parallel stattfindenden zunehmenden Selbstauflösung der Linkspartei auf Bundesebene, zunehmend auf eine kommende Wagenknecht-Partei.
Wagenknechts »Mission«
„Gründet euch endlich!“, fordert exemplarisch Jan Feddersen in der „taz“, da nur Wagenknecht und Co. den Rechtspopulisten speziell im Osten der Republik das Wasser abgraben und AfD-affine Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen könnten. Insofern sei es ein „verfassungspatriotischer Clou“, ja sogar „eine zivilisatorische, ja antifaschistische Mission, dieses Parteiprojekt der Wagenknecht-Fellows zu unterstützen“.[2] Tatsächlich sammelt Wagenknecht schon lange ihre Truppen innerhalb der Linkspartei, um von innen heraus die Zerstörung des linken Konkurrenzprojekts zu betreiben. Und auch der zeitliche Plan des eigenen Antretens steht – erst bei der Europawahl im Juni 2024 und dann bei den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst 2024, als entscheidendes Vorspiel für die Bundestagswahl ein Jahr darauf. Wie der stets gut informierte Pascal Beucker berichtet, soll zur Vorbereitung der neuen Partei wohl zunächst ein eingetragener Verein gegründet werden, um auf diese Weise die Mitgliedschaft auf stramme Gefolgsleute zu beschränken und nicht gleich alle Sektierer einzusammeln, während der eigentliche Parteigründungsakt auch aus finanziellen und parteirechtlichen Gründen erst 2024 erfolgen könnte.[3]
Die maßlose Stilisierung der Parteigründung zu einer „zivilisatorischen, ja antifaschistischen Mission“ spielt Wagenknecht und Co. natürlich enorm in die Hände. Dabei ist ausgesprochen zweifelhaft, ob und inwieweit es sich bei dieser Partei tatsächlich um ein aufklärerisches Projekt handeln wird.
Wagenknecht bezeichnet ihr Projekt ausdrücklich als ein „links-konservatives“. Mit ihrer klassenkämpferisch grundierten Diktion betreibt sie ein klassisches Umverteilungsprojekt (Nehmt‘s den Reichen, gebt‘s den Armen). Das ist der linke Aspekt ihres ansonsten aber ausgesprochen nationalen, ja sogar nationalistischen Populismus – unten das gute deutsche Volk, dort oben die bösen globalistisch orientierten Eliten –, der von dem der AfD kaum zu unterscheiden ist.
Genau wie die Rechtspopulisten begreift Wagenknecht denn auch die Grünen als ihren Hauptgegner und bezeichnet sie als „die gefährlichste Partei“. Damit meint sie die materialistische Linie der klassischen Linken zu beerben, verkennt aber völlig, dass heute ein wirklich materialistisches Denken ohne ökologische Grundierung und die Bekämpfung der Klimakrise undenkbar ist. Denn die Verteidigung der biologischen Lebens- und Überlebensvoraussetzungen ist zweifellos die größte Gerechtigkeitsfrage der Gegenwart, für die gegenwärtigen wie für zukünftige Generationen.
Wer daher heute „links“ nicht nur in einem nationalistischen, sondern internationalistischen Sinne versteht, muss ökologische Nachhaltigkeit im nationalen wie globalen Maßstab als zentrales Ziel verfolgen. Wer dagegen wie Wagenknecht ökologisches Denken nur als Ausdruck einer Lifestyle-Linken denunziert, agiert alles andere als links und schon gar nicht konservativ in einem normativen Verständnis – nämlich der Bewahrung des unbedingt Bewahrenswerten, sprich: der natürlichen Lebensgrundlagen.
Links-konservatives Denken im Sinne von Wagenknecht, bei dem der primäre Bezugspunkt nur Nation, Familie und das deutsche Volk sind (etwa beim Kampf gegen Migration), ist letztlich national-borniertes, reaktionäres Denken. Da sie darauf abzielt, dezidiert AfD-Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, könnte sie mit dieser Strategie durchaus Erfolg haben.[4] Allerdings spricht dies allein noch nicht für ein progressives Projekt, sondern vielmehr dafür, dass zukünftig zwei populistische Parteien ohne jeden Willen zur Übernahme politischer Verantwortung die regierungswillige Mitte in die Zange nehmen und so immer inkohärentere Koalitionen erzwingen werden – was das Vertrauen in die Demokratie weiter erodieren lassen dürfte.
Was macht die Demokratie wehrhaft?
Die zweite Strategie gegen die Rechtspopulisten agiert daher weit direkter, nämlich mit der Überlegung, die AfD schlicht zu verbieten. So forderte Bundespräsident Frank Walter Steinmeier anlässlich des 75. Jahrestags des Verfassungskonvents im bayerischen Herrenchiemsee, der 1948 die Basis für unser Grundgesetz legte, „dass wir Freiheit und Demokratie erneut verteidigen müssen“. Es gebe „eine historische Lehre“, die sich wie ein roter Faden durch den Verfassungsentwurf ziehe und die bis heute gelte: „Eine Demokratie muss wehrhaft sein gegen ihre Feinde“. Kein mündiger Wähler könne sich auf „mildernde Umstände“ herausreden, wenn er sehenden Auges politische Kräfte stärke, die zur Verrohung der Gesellschaft und zur Aushöhlung der freiheitlichen Demokratie beitrügen.
Auch wenn Steinmeier dabei nicht ausdrücklich ein Verbot forderte und auch keine konkrete Partei nannte, war damit zweifellos die AfD gemeint. „Der Spiegel“ nahm denn auch prompt den Ball auf und forderte als erstes relevantes Presseorgan, die AfD zu verbieten.[5] Die Strategie, die AfD in den Parlamenten und im politischen Prozess durch Ausgrenzung zu schwächen, sei gescheitert und ein Verbot der Partei „notwendig, um die Demokratie zu schützen“.[6]
An diesem Punkt stellt sich die entscheidende Frage: Wann und wie ist eine Demokratie tatsächlich wehrhaft? Und ist dafür tatsächlich das Verbot der AfD notwendig?
Zur Erinnerung: Parteien sind für unsere Demokratie schlechthin konstitutiv. Deshalb werden sie zu Recht geschützt. Bis zur Feststellung ihrer Verfassungswidrigkeit gilt das Parteienprivileg des Artikels 21 Grundgesetz; ein Parteienverbot ist insofern das allerschärfste Schwert. Deshalb wurden in der Geschichte der Bundesrepublik nur zwei Parteien verboten: 1952 die SRP, die Sozialistische Reichspartei als explizite NSDAP-Nachfolgeliste, und 1956 – nicht nur von Linken scharf kritisiert – die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands.
Daraus folgt: Wehrhaft ist eine Demokratie jedenfalls nicht dann, wenn sie angesichts einer 20-Prozent-AfD – wohlgemerkt: in den Umfragen – förmlich in Panik gerät und deren Verbot in die Wege leitet, obwohl 80 Prozent der Wählerinnen und Wähler nicht die AfD wählen und weiter klar auf dem Boden des Grundgesetzes stehen.
Wenn aber diesen 20 Prozent mit dem Verbot der AfD faktisch ihre Stimme entzogen wird, dann schwächt das zunächst einmal die Demokratie, weil damit auch ein konkretes inhaltliches Angebot verboten und die oft beschworene Repräsentationslücke weiter aufgerissen wird. Angesichts der enormen Schwierigkeit, eine neue Partei im Parteienspektrum zu etablieren – faktisch ist dies in der Geschichte der Bundesrepublik nur Grünen, Linkspartei und AfD gelungen –, ist es daher regelrecht naiv, wenn der „Spiegel“ behauptet, die Wählerinnen und Wähler der verbotenen Parteigliederungen „könnten ihr Kreuzchen bald darauf bei geläuterten Alternativen machen“, solche Nachfolgeorganisationen wären ja schließlich erlaubt. Viel wahrscheinlicher ist massive Frustration die Folge eines AfD-Verbots, welche die davon betroffenen Mitglieder und Wähler veranlassen dürfte, noch radikaler zu werden und sich umso mehr von der Demokratie abzuwenden.
Das Verbot der AfD kann daher nur das letzte Mittel sein, wenn tatsächlich alle anderen ausgeschöpft sind. Davon kann aber bisher nicht die Rede sein. So richtig es ist, dass in der AfD-Mitglied- und Anhängerschaft längst ein breiter rechtsradikaler Boden aus überzeugten Rechtsextremen, Reichsbürgern und Querdenkern existiert: Ein großer Teil wählt die Partei zumindest auch aufgrund des Versagens der traditionellen Parteien. Wenn daher jetzt aus den Reihen der Regierungsparteien der lauter werdende Ruf nach einem Verbot der AfD erklingt, muss das vor allem als Unterdrückung von Kritik und Ausdruck des eigenen Scheiterns erscheinen.
Die wirklichen Probleme werden dadurch aber nicht gelöst, sondern nur verdrängt. Noch sind die Parteien unbedingt in der Lage, die AfD durch bessere Arbeit zu verkleinern. Wehrhafte Demokratie bedeutet daher in erster Linie, das Land gut zu regieren, sprich: taugliche Lösungen für die zweifellos gewaltigen Probleme dieses Landes zu finden. Das verlangt nicht zuletzt, dass diese Regierung ge- und entschlossen das umsetzt, was sie im Koalitionsvertrag beschlossen hat, eine sozial gestaltete ökologische Transformation. Zugleich kommt es darauf an, die AfD endlich inhaltlich zu stellen – etwa an ihren gefährlich isolationistischen Positionen, die der jüngste Europa-Parteitag wieder gezeigt hat, und an ihrer „Sozialpolitik“, die zur Folge hätte, dass gerade die finanziell Schwachen die Hauptleidtragenden wären, wenn die AfD (mit)regieren würde.
So kann es der Regierung gelingen, die Werte der AfD wieder zu reduzieren. Dann braucht es kein Parteienverbot. Solange die Ampel aber weiterhin – wie fatalerweise auch CDU/CSU als die klassische Opposition – nur um sich selbst kreist und Partei- vor Staats- und Demokratieräson geht, wird sie die Bevölkerung immer mehr verlieren und dadurch die AfD weiter stärken.
Wenn daher jetzt gefordert wird, die AfD zu verbieten, nachdem die Koalition mit ihrer Wahlrechtsänderung bereits Linkspartei und CSU den Einzug in den Bundestag erschwert hat, dann erinnert dies in gewisser Weise an das, was Bertolt Brecht vor just 70 Jahren, nach dem Volksaufstand des 17. Juni 1953, schrieb: Der Sekretär des Schriftstellerverbandes, heißt es in seinem Gedicht „Die Lösung“, habe auf der Stalinallee Flugblätter verteilen lassen, auf denen zu lesen war, dass das Volk das Vertrauen der Regierung verscherzt habe und es nur durch verdoppelte Arbeit zurückgewinnen könne. „Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?“
Übertragen auf die heutige Zeit bedeutet dies: Wenn der Protest nicht aufhört und die Leute weiter AfD wählen, verbieten wir doch einfach die Partei und das Problem ist erledigt. Das aber ist gerade nicht „Die Lösung“ des Problems, im Gegenteil: Der Verbotsdiskurs stellt unserem Land ein doppeltes Armutszeugnis aus, nämlich erstens der Politik, die bei der Lösung der Probleme versagt, aber zweitens auch der Bevölkerung, die dem Anwachsen der AfD immer noch in weiten Teilen mit Gleichgültigkeit begegnet. Solange man sich aber nicht selbst stärker in den oder für die Parteien engagiert, die wirklich bereit sind, demokratische Verantwortung in diesem Land zu übernehmen, so lange ist das bloße Lamentieren über die Schwäche der Regierung wohlfeil – und gilt weiterhin der Satz: Jedes Volk bekommt am Ende die Parteien, die es verdient.
[1] Daniel Brössler, Frisch erholt in die Selbstzerfleischung, in: „Süddeutsche Zeitung“, 17.8.2023; Berthold Kohler, Auf des Kanzlers Nase, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 17.8.2023.
[2] Jan Feddersen, Gründet euch endlich!, in: „die tageszeitung“ (taz), 15.8.2023.
[3] Pascal Beucker, Kurz vor dem Absprung, in: taz, 21.8.2023.
[4] Deshalb darf man sehr gespannt darauf sein, ob Wagenknecht ihrem neuen Projekt überhaupt einen linken Namen geben oder, wie bereits im Falle von „Aufstehen“, dabei völlig inhaltsleer bleiben wird.