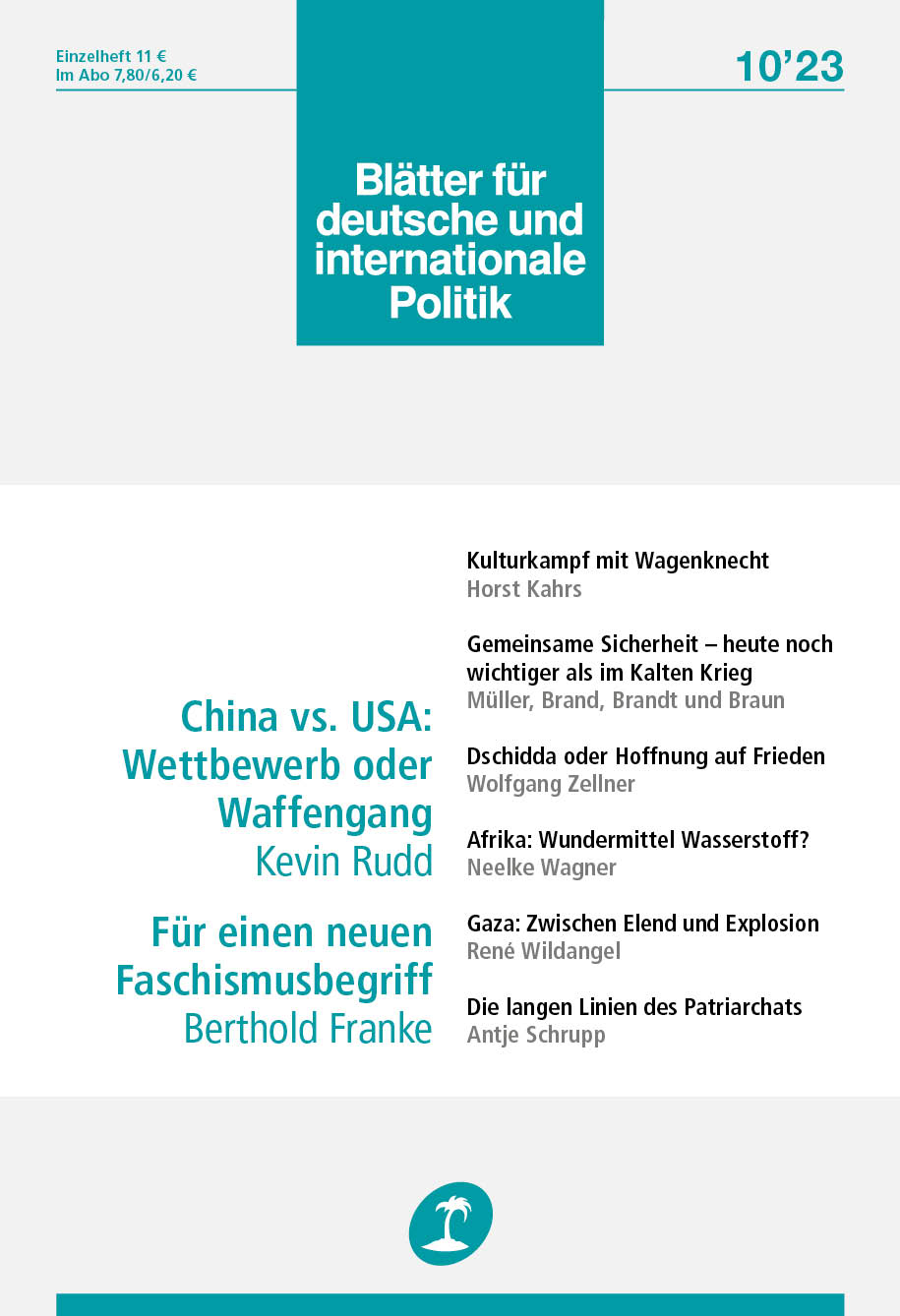Bild: Ein junger Mann betrauert den Tod von Yousef Radwan. Der 25-Jährige wurde bei einem Protest am Grenzzaun zwischen Israel und Gaza getötet, 20.9.2023 ( IMAGO / ZUMA Wire / Yousef Masoud)
Dieser Text erschien in der Oktober-Ausgabe der »Blätter« wenige Tage vor dem Angriff der Hamas am 7.10.2023 und wurde folglich in Unkenntnis der jüngsten Zuspitzung des Konflikts geschrieben.
Unter dem Hashtag #indenfokus hat das Auswärtige Amt 2023 gemeinsam mit einer breiten Koalition von Hilfsorganisationen eine neue Kampagne gestartet. Damit soll auf die vergessenen weltweiten Krisen aufmerksam gemacht werden: im Libanon, in Bangladesch oder im Südsudan. Das ist wichtig und richtig. Doch dass der Gazastreifen nicht im Mittelpunkt der Kampagne steht, dürfte kaum überraschen. Denn wer Gaza in den Fokus nähme, müsste damit rechnen, dass es schnell brisant wird. Aus der Krise vor Ort wird dann schnell eine ganz andere Krise; Einseitigkeitsvorwürfe wären vorprogrammiert. Denn der Diskurs über die Situation in Nahost ist in Deutschland weitgehend zu einer Selbstbespiegelung geworden, in der es weniger um die schwierige Lage vor Ort geht als um polemische Debatten über BDS, Antisemitismusvorwürfe oder das Existenzrecht Israels. Und seit die größten internationalen, aber auch israelische und palästinensische Menschenrechtsorganisationen der neuen israelischen Regierung Apartheid vorwerfen, ist das Klima besonders aufgeheizt.
Angesichts oft schnell getätigter polemischer Vorwürfe ist die Lust deutscher und europäischer Politiker, sich mit der Lage vor Ort zu beschäftigen, ausgesprochen gering. Das gilt für die zuletzt wieder eskalierende Gewalt in der Westbank ebenso wie für die fatale Lage im Gazastreifen. So bleibt Gaza völlig außerhalb des öffentlichen Fokus. Die Folgen dieser Nichtbeachtung sind desaströs – nicht nur für die 2,3 Millionen überwiegend jungen Menschen im Gazastreifen, sondern auch für Israel.
Inzwischen ist es über zehn Jahre her, dass im Deutschen Bundestag eine Debatte über die Situation im Gazastreifen geführt wurde, über die seit 2007 andauernde israelische Blockade und die dramatischen Konsequenzen für die Menschen vor Ort. Mitte 2010 wurde ein gemeinsamer Antrag der damaligen Regierungsfraktionen CDU/CSU und FDP sowie der Oppositionsparteien SPD und Grüne verabschiedet. Vorangegangen war der israelische Angriff auf die sogenannte Gaza-Flotilla, einen Konvoi aus sechs Hilfsschiffen unter türkischer Flagge, die versuchen wollten, die Blockade zu durchbrechen. Neun Menschen starben dabei. Im Antrag wird die Solidaritätsaktion zur See wegen angeblicher Verbindungen einiger Beteiligter zur Hamas ebenso kritisch betrachtet wie das unverhältnismäßig gewaltsame Vorgehen der israelischen Armee. Zudem fordert in ihm die breite Parlamentsmehrheit die Bundesregierung auf, „die Forderung der Europäischen Union nach einer sofortigen Aufhebung der Gaza-Blockade mit Nachdruck zu unterstützen“. Zuvor heißt es: „Die Blockade Gazas ist aber kontraproduktiv und dient den politischen und Sicherheitsinteressen Israels letztlich nicht.“ Zu dieser Analyse kamen die Abgeordneten zu einem Zeitpunkt, als die Blockade gerade einmal drei Jahre bestand. 2012 wurde ein ähnlicher Antrag von den Grünen eingebracht.
Seitdem ist die Blockade nicht nur der deutschen Politik, sondern auch der EU in ihren Erklärungen zum Nahostkonflikt kaum noch eine Fußnote wert. Der kleine Küstenstreifen gelangt eigentlich immer nur dann in die Nachrichten, wenn es zu einer neuen Runde der Gewalt kommt: Seit Beginn der Blockade gab es 2008, 2012, 2014, 2018 und 2021 größere kriegerische Auseinandersetzungen mit über 4000 getöteten Palästinensern und über 100 Toten in Israel. Abgesehen davon ist Gaza in der Berichterstattung kaum noch ein Thema. Das Elend scheint auserzählt, wenigstens schafften es die mutigen Proteste gegen die Lebensbedingungen in Gaza Ende Juli, die von der Hamas gewaltsam aufgelöst wurden, in die Nachrichten. Die sind ansonsten von wiederkehrenden Berichten über israelische Luftangriffe auf Gaza und den Raketenbeschuss israelischer Städte durch militante Palästinenser dominiert. Politische Initiativen bleiben Fehlanzeige – dabei wäre die Debatte darüber heute wichtiger denn je.
Wenn man die jüngere Entwicklung in Gaza verstehen will, muss man zurückgehen ins Jahr 2003. Damals legte der israelische Ministerpräsident Ariel Sharon seinen unilateralen „Rückzugsplan“ vor, gemäß dem sämtliche israelische Siedlungen aus dem Gazastreifen abgezogen werden sollten. Dieser Plan wurde 2004 beschlossen und 2005 tatsächlich umgesetzt. Warum aber gab einer der rechten Ideologen des Likud und Unterstützer der Siedlungsbewegung freiwillig besetztes Land auf?
Die Logik dieses Rückzuges hatte nichts mit dem sogenannten „Land for Peace“-Prinzip der Oslo-Friedensverträge zu tun. Denn an eine Friedensregelung hatte Sharon – 1982 als Verteidigungsminister in Sabra und Schatila für eines der schlimmsten Massaker im Libanonkrieg mitverantwortlich – nie geglaubt. Ihm ging es um genau denselben Punkt, um den es vielen Likudpolitikern und ihren Verbündeten weit rechtsaußen heute auch wieder geht: Wie lässt sich die Beherrschung des israelischen Kernlandes – also ganz Jerusalems und Teilen des Westjordanlandes – dauerhaft organisieren? Grundlage war und ist eine einfache demographische Rechnung: Im Gazastreifen leben nach offiziellen Angaben von 2022 über zwei Millionen Menschen, in der Westbank 3,2 Millionen. Mit weiteren zwei Millionen Palästinensern in Israel sind es insgesamt mehr als sieben Millionen Palästinenser auf dem Gebiet des „historischen Palästina“ (in den Grenzen des ehemaligen britischen Mandatsgebietes bis 1948). Gelänge es, die zwei Millionen Menschen im Gazastreifen dauerhaft aus dieser Rechnung herauszunehmen, wäre die demographische Überlegenheit von sieben Millionen jüdischen Israelis und 700 000 jüdischen Siedlern in der Westbank langfristig gesichert, so das Kalkül der Rechten. Für den demokratisch gesinnten Teil der israelischen Gesellschaft war dies stets ein Albtraumszenario. Dass dieser Plan nach 2006 geradezu perfekt aufgehen würde, konnte selbst Ariel Sharon so nicht vorhersehen.
Die anhaltende Blockade und ihre fatale Wirkung
Denn kurz nach dem Abzug Israels ging die Hamas aus den palästinensischen Parlamentswahlen von 2006 als Siegerin hervor. Von den Hauptfinanziers der Palästinensischen Autonomiebehörde, der EU und den USA, wurde dies aber ebenso wenig anerkannt wie von der israelischen Regierung. Die benötigten Mittel wurden eingefroren, sodass weder die neu gebildete Hamas-Regierung noch eine Einheitsregierung mit der rivalisierenden Fatah überleben konnte. Die Folge war ein kurzer Bürgerkrieg zwischen beiden Gruppen und die bis heute anhaltende Spaltung der palästinensischen Gebiete. Wahlen gab es danach nicht mehr, die Fatah regiert in der Westbank mittlerweile ähnlich autoritär wie die Hamas im Gazastreifen, wenn auch ohne islamistischen Anstrich und mit anhaltender westlicher Unterstützung. Nach der Machtübernahme der Hamas in Gaza 2007 riegelte die israelische Regierung den Gazastreifen komplett ab; spätestens seit dem Putsch von Präsident al-Sisi 2014 ist auch der Grenzverkehr mit Ägypten stark eingeschränkt. Israel überwacht den Luftraum, sperrt mit Kriegsschiffen den für Gazas Fischer so wichtigen Meerzugang bis auf einen kleinen Küstenstreifen ab und hat eine hohe Grenzmauer mit Wachtürmen und Scharfschützen der Armee errichtet. Daher gilt der Gazastreifen völkerrechtlich weiterhin als von Israel besetzt.
Die israelische Rechte hat aber ein anderes, wirkmächtiges Narrativ eingeführt: „Wir sind abgezogen, das Ergebnis ist Terror.“ Dieses Argument ist zentral für die mittlerweile in der israelischen Gesellschaft zum Mainstream gewordenen Ablehnung eines palästinensischen Staates. Und genau so hat es ein Berater von Ariel Sharon auch 2004 formuliert: „Die Bedeutung des Disengagement Plans ist das Einfrieren des Friedensprozesses.“[1] Auch die israelische Blockadepolitik dient diesem Ziel – wenn sie sich tatsächlich gegen die Hamas richten würde, müsste sie nach 15 Jahren längst als gescheitert gelten. Denn heute sitzt der palästinensische Ableger der Muslimbrüder nach wie vor fest im Sattel. Die Macht der Hamas ist längst nicht mehr durch Wahlen legitimiert, sondern beruht auf autoritärer Kontrolle und dem Mythos eines „Widerstandes“ gegen Israel, der durch die Blockade zusätzlich genährt wird. Hauptleidtragender ist die Bevölkerung in Gaza.
Angesichts der Blockade und der Folgen wiederkehrender Kriege in den vergangenen Jahren wurde Gaza zuletzt nur noch als humanitäres Problem betrachtet. Die in Harvard ansässige Forscherin Sara Roy hat in ihrem herausragenden Buch „The De-Development of Gaza“ bereits Mitte der 1990er Jahre gezeigt, dass auch vorangegangene israelische Regierungen nie an einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung des Gazastreifens interessiert waren. Aber seit 2007 hat dies eine neue Dimension angenommen.
2012 erschien ein Bericht der Vereinten Nationen: „Gaza 2020. A liveable Place?“[2] Seine Verfasser warnten vor einer irreversiblen Zerstörung der Lebensgrundlagen und mahnten dringenden Handlungsbedarf an: angesichts einer völlig unzureichenden Gesundheits- und Energieversorgung, grundsätzlich fehlender wirtschaftlicher Perspektiven, einer Versalzung des Grundwassers sowie rasanten Verseuchung der natürlichen Ressourcen und Anbauflächen aufgrund von Überdüngung und unzureichender Abwasserentsorgung.
Doch mehr als ein Jahrzehnt später hat sich die Situation für die Bevölkerung durch die anhaltende Blockade und die folgenden Kriege, in denen immer wieder wichtige zivile Infrastruktur zerstört wurde, dramatisch verschärft: 97 Prozent der Grundwasserreserven in Gaza sind vergiftet, es wird nach wie vor Abwasser ins offene Meer geleitet, Elektrizität ist nicht ausreichend vorhanden und oft nur für wenige Stunden verfügbar. Mehr als 80 Prozent der Menschen sind mittlerweile von Hilfsleistungen abhängig. Ein bis in die Bronzezeit zurückreichendes Handelszentrum am Mittelmeer wurde durch die Blockade in ein Armenhaus verwandelt, die einst florierende Wirtschaft, beruhend auf einer lokalen Industrie und produzierendem Gewerbe, Handel und landwirtschaftlicher Produktion, ist fast vollständig beseitigt. Der Gazastreifen ist weiterhin für Personen, aber auch für Waren abgeriegelt: Nur ausgewählte Güter können eingeführt werden, die Liste der Dual-Use-Güter, gegen die Sicherheitsbedenken existieren, ist lang – sie umfasst Baumaterialien wie Zement, Stahl und Holz, aber auch wichtiges medizinisches Gerät und Alltagsgegenstände.
Auch der Zugang nach Gaza ist strikt reglementiert und nur über die komplizierte Beantragung eines „Permits“ bei den israelischen Besatzungsbehörden möglich. Menschenrechtsorganisationen wird der Zugang in der Regel verweigert. Wer einreisen darf, meist in humanitärer Mission, kann die Isolation, in der hier eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen aufgewachsen ist, mit Händen greifen. Über 50 Prozent sind jünger als 18 Jahre, Gaza hat den zweithöchsten Anteil weltweit in der Altersgruppe bis 14 Jahre. Diese jungen Menschen bleiben im Gazastreifen eingesperrt; dazu kommt die Traumatisierung durch wiederkehrende Luftangriffe, vor denen ihre Eltern sie im dicht bevölkerten Gebiet nicht schützen können.
Mit 70 Prozent hat Gaza nach UN-Angaben zudem die höchste Jugendarbeitslosigkeit der Welt. Zwar wird unter schwersten Bedingungen ein Bildungssystem aufrechterhalten. Aber wer hier die Schule beendet und einen Uni-Abschluss erlangt, hat kaum Chancen auf einen Job. In jüngster Zeit hat Israel erstmals wieder zehntausenden Palästinensern aus Gaza erlaubt, in Israel zu arbeiten; eine Lockerung der Blockade ist dennoch nicht in Sicht. Im Mai 2023 war Außenminister Eli Cohen in Indien, um dort Arbeiter anzuwerben, die die Palästinenser aus Gaza bald ersetzen könnten.
Nach der Madrider Friedenskonferenz 1991 schien ein neues Zeitalter anzubrechen. Auch wenn viele Beobachter, insbesondere in Palästina, skeptisch waren, ob die Oslo-Verträge wirklich in einer umfassenden Friedensregelung münden würden, war die Hoffnung doch groß – insbesondere in Gaza. Denn in einem unabhängigen Staat Palästina könnte der Küstenstreifen eine Perle sein: mit wunderbaren Sandstränden und Urlaubsressorts als Erholungsgebiet für Palästinenser, Israelis und Touristen aus der ganzen Welt. Mit einem Hafen für Waren- und Passagierverkehr, zentral im Mittelmeer positioniert. Mit eigenen Gasvorräten vor der Küste, die Energie für das gesamte Land liefern könnten. Und einem Flughafen, der Palästina mit der Welt verbinden würde. Was heute utopisch klingt, war schon längst Realität: 1998 wurde der Flughafen im Beisein von US-Präsident Bill Clinton eröffnet. Doch infolge der zweiten Intifada wurde er zerstört, die Landebahnen als Strafmaßnahme für palästinensische Anschläge aufgerissen.
Gazas Rechte, Israels Sicherheit, Europas Verantwortung
Mit der „Gaza-Jericho-Vereinbarung“ hatte 1994 die Übertragung von Autonomie an die Palästinenser begonnen. Besonders schwierige Fragen, beispielsweise der Status von Jerusalem, sollten erst am Ende verhandelt werden. Aber es war immer klar, dass Gaza und die Westbank eine Einheit bilden sollten, die von den Palästinensern selbst verwaltet werden soll. Doch obwohl Deutschland und die EU immer noch die Zweistaatenlösung beschwören, haben sie ihre konkrete Unterstützung für diese Einheit längst aufgegeben. Wenn EU-Diplomaten überhaupt einmal den Gazastreifen besuchen, geht es stets um humanitäre Fragen. Dabei könnten sie in Gaza konkrete Dinge tun, um die Blockade mit ihren fatalen Auswirkungen zu beenden. Das wäre nicht nur ein konkreter Beitrag, um die Grundrechte der Palästinenser zu verbessern. Auch israelische Bürgerinnen und Bürger und ihre Sicherheit würden von einer tragfähigen Lösung profitieren, schließlich ist es die Perspektiv- und Schutzlosigkeit der Bevölkerung in Gaza, die der Hamas und dem von ihr proklamierten „Widerstand“ Unterstützung verschafft. Daher sollte auch Deutschland, das seit Angela Merkels Rede in der Knesset 2008 – ein Jahr nach Beginn der Blockade – Israels Sicherheit als „Staatsräson“ definiert, für eine entsprechende Initiative eintreten.
Im Rahmen eines gemeinsamen EU-Engagements sollten dabei drei Punkte im Mittelpunkt stehen: Erstens sollte die EU sich für ein Ende der Blockade mit ihren fatalen Konsequenzen einsetzen. Dabei geht es einerseits um die Bewegungsfreiheit der jungen Bevölkerung in Gaza und den internationalen Zugang zum Küstenstreifen – und um eine Perspektive für einen wirtschaftlichen Neuaufbau in Gaza. Andererseits gilt es, Israels Sicherheitsinteressen zu adressieren, mit denen die Regierung bis heute die Blockade begründet. Eine kontrollierte Öffnung des Gazastreifens könnte die Lebensbedingungen nachhaltig verbessern, einen echten wirtschaftlichen Wiederaufbau einleiten und die Abhängigkeit von Hilfsgütern beenden. Das würde nicht der Hamas zugutekommen, die von der Verelendung des Gazastreifens profitiert, sondern in erster Linie der lokalen Bevölkerung. Deutschland und die EU könnten hier eine aktive Rolle spielen, so wie einst mit der Grenzunterstützungsmission (BAM) an der ägyptischen Grenze, die den Personen- und Güterverkehr in Koordination mit Israel überwachte.
Zweitens sollten Deutschland und die EU – als wichtigste Unterstützer der Autonomiebehörde – die beiden palästinensischen Kontrahenten zu einer Verständigung über Neuwahlen drängen. Der letzte Versuch dazu scheiterte 2022. Es ist nicht zuletzt die Autonomiebehörde in Ramallah, die zögerlich mit Blick auf eine Versöhnung agiert. Die Hamas hat sich immerhin 2017 von ihrer hetzerischen, durch und durch antisemitischen Gründungscharta verabschiedet und stattdessen erklärt, sie sehe einen „unabhängigen palästinensischen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt in den Grenzen vom 4. Juni 1967“ als nationalen Konsens an. Die Zeit drängt. Wenn der 87jährige Mahmoud Abbas als Präsident ausscheidet, droht ein Machtvakuum, das Wahlen oder gar einen Versöhnungsprozess massiv erschweren würde.
Drittens kann statt kurzfristiger humanitärer Hilfe nur eine politische Regelung verhindern, dass es immer wieder zu Gewalt kommt. Der Zeitpunkt, eine solche Regelung auf die Tagesordnung zu setzen, wäre günstig. Denn derzeit ist eine regionale Annäherung im Gange. Unter chinesischer Regie einigten sich Iran und Saudi-Arabien im April darauf, ihre in der Region teils offen ausgetragenen Konflikte beizulegen, mittlerweile haben beide Länder Botschafter ausgetauscht. Einer der geostrategischen Schauplätze der verfeindeten Lager: Gaza.
Der Iran hat dort nach der Revolution von 1979 die Entstehung des Islamischen Dschihad unterstützt und finanziert ihn bis heute – ebenso wie die Hamas. Entsprechend feindselig steht Saudi-Arabien, früher Vermittler im Versöhnungsprozess zwischen Fatah und Hamas, den militanten Palästinenserorganisationen gegenüber. Zudem nähert sich das Königreich seit längerem inoffiziell Israel an. Nach den militärischen Auseinandersetzungen im Mai war es Ägypten, das einen Waffenstillstand zwischen dem Islamischen Dschihad und Israel vermittelte. Als Nachbarland hat Ägypten ein besonderes Interesse an der Stabilität des Küstenstreifens. Zudem müssen Katar und die Türkei eingebunden werden, in der Vergangenheit Unterstützer der Hamas und Gastgeber ihrer Exilführung. Für Recep Tayyip Erdog˘an war das Teil seiner regionalen Einflussnahme, aber es gibt auch in Ankara Zeichen einer Wiederannäherung an Israel. Ziel regionaler Verhandlungen sollte ein langfristiger Waffenstillstand und ein Abkommen über die Nutzung der vor der Küste befindlichen Gasreserven sein.
Wird stattdessen Gaza auch weiterhin ignoriert, ist die nächste Runde von Gewalt und Gegengewalt kaum zu vermeiden. Netanjahus rechtsradikale Koalitionspartner machen bereits Druck in diese Richtung. Siedlungsministerin Orit Strook, selbst radikale Siedlerführerin aus Hebron, brachte im März 2023 sogar eine Wiederbesetzung des Gazastreifens ins Spiel. Das Eskalationspotenzial bleibt also hoch. Es ist daher dringend an der Zeit, dass Bundesregierung und EU endlich auch wieder Gaza „in den Fokus“ nehmen.
[1] Ari Shavit, Top PM Aide: Gaza Plan Aims to Freeze the Peace Process, www.haaretz.com, 6.10.2004.
[2] Vgl. Gaza in 2020. A liveable place? A report by the United Nations Country Team in the occupied Palestinian territory, August 2012.