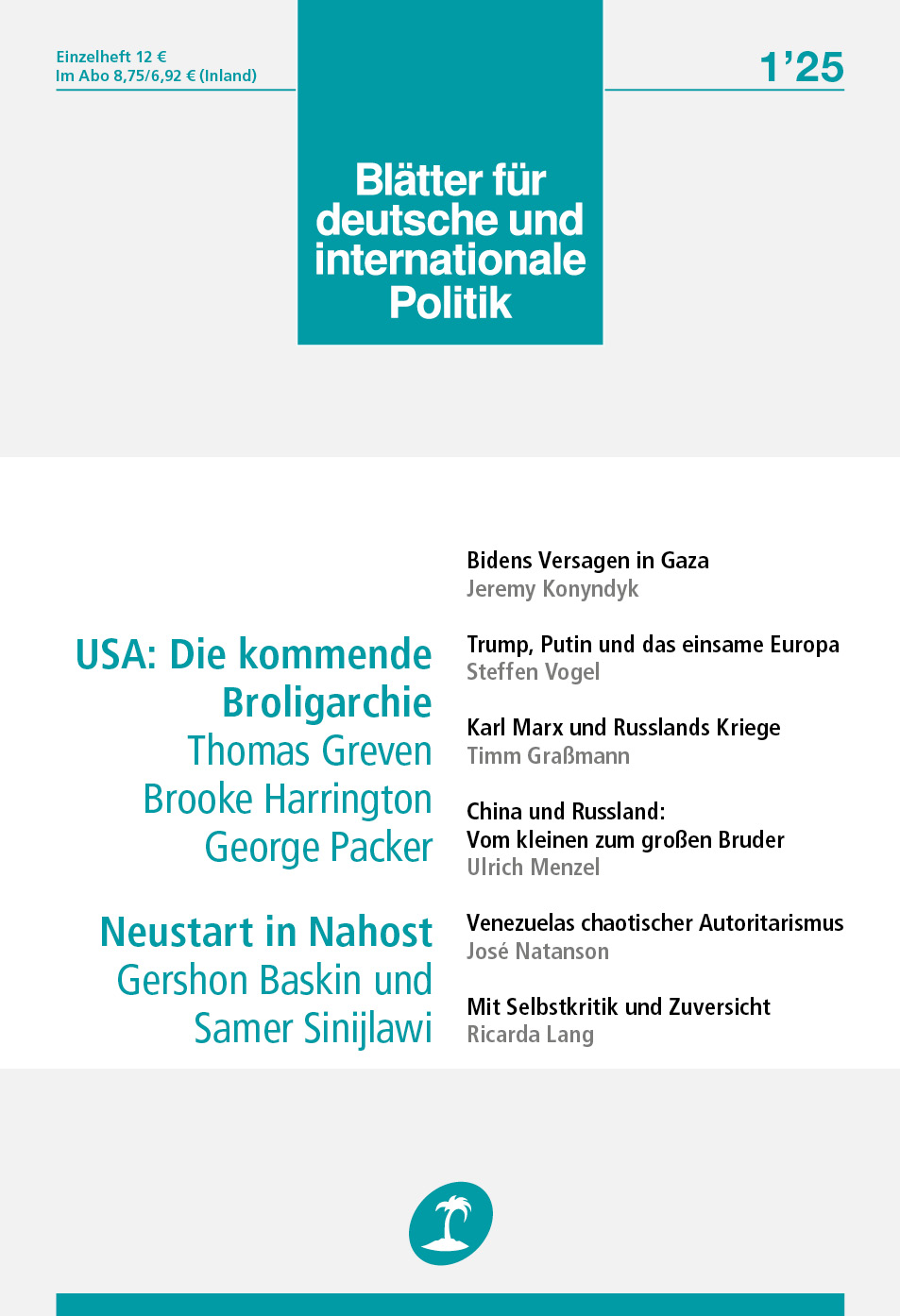Bild: Gruppenfoto der G7 Aussenministerinnen und Aussenminister in Anagni, 25.11.2024 (IMAGO / photothek / Kira Hofmann)
Eigentlich war das Superwahljahr 2024 dazu prädestiniert, ein globales Fest der Demokratie zu werden: Fast die Hälfte der Weltbevölkerung in mehr als 60 Staaten war dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Doch ausgerechnet die prominentesten Vertreter der westlichen liberalen Demokratien gingen beispiellos geschwächt aus dem Superwahljahr hervor: Mehr als die Hälfte der Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten verloren ihren parlamentarischen Rückhalt und regieren seither mit Minderheitsregierungen. In Italien und ab dem 20. Januar 2025 auch in den USA stehen überdies dezidierte Verfechter eines autoritären Staatsumbaus an der Spitze. Damit droht das Jahr 2024 und insbesondere der vergangene 6. November zu einem historischen Kipp- und Wendepunkt für die internationale Ordnung zu werden.
Speziell den Geschehnissen des 6. November 2024 – die Wiederwahl des verurteilten Straftäters Donald Trump zum Präsidenten der USA und der Zusammenbruch der ersten Drei-Parteien-Koalition in Deutschland – kommt dabei eine enorme Bedeutung zu. Entsprechend intensiv werden die außenpolitischen Implikationen einer zweiten Trump-Administration für die europäische Sicherheitsarchitektur und speziell für den Verteidigungskampf der Ukraine diskutiert.[1]
Doch die enorme internationale Tragweite dieses Datums wird in den Debatten oft nur unzureichend ausgeleuchtet.