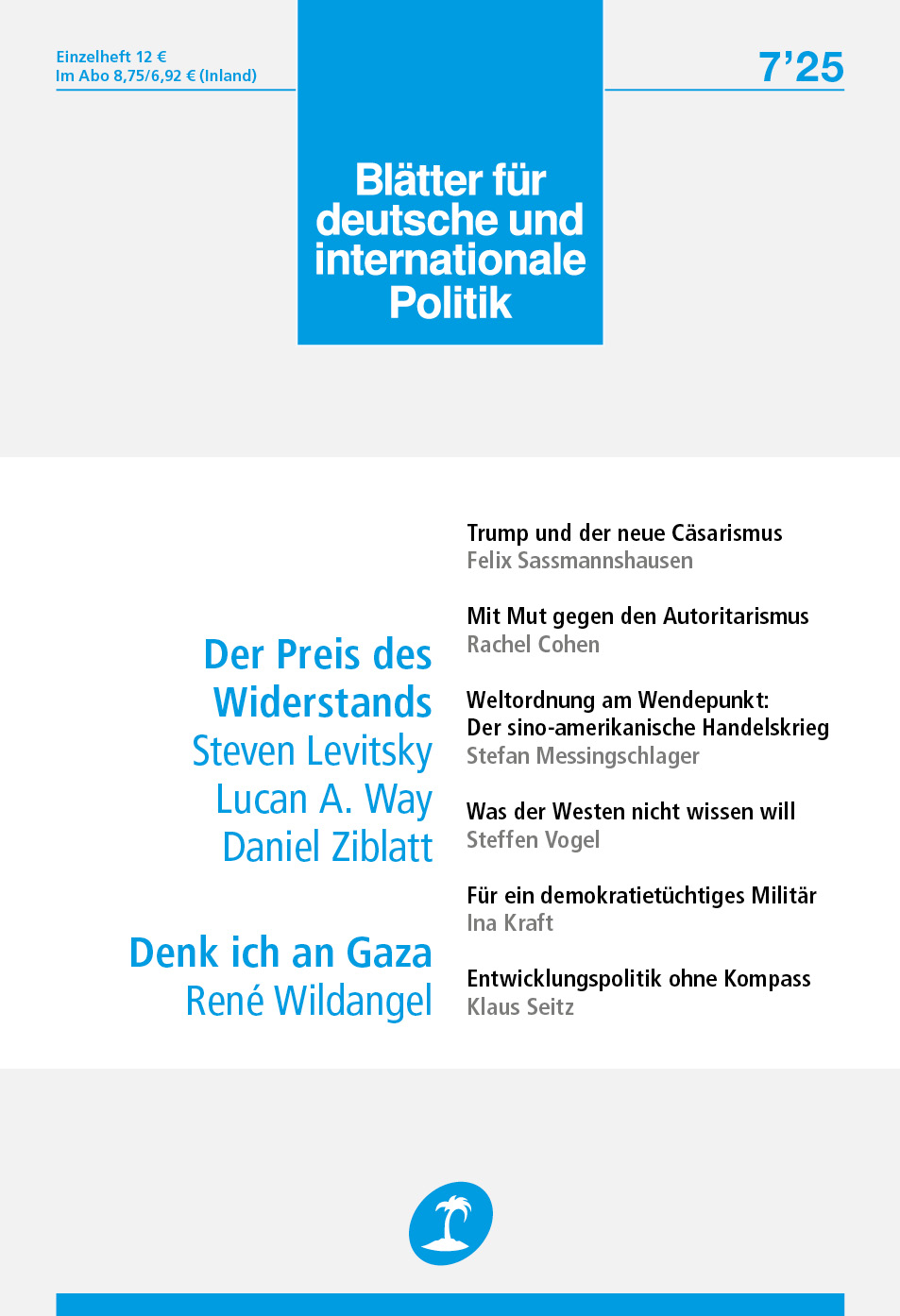Bild: Teilnehmer einer Nazi-Demonstration der so genannten Deutschen Jugend Voran (DJV) in Berlin-Mitte verdecken ihren Hitlergruß nur durch das Schließen der Fäuste, 1.6.2025 (IMAGO / Eventpress / Jeremy Knowles)
Sie tragen schwarze Muskelshirts mit Aufschriften wie „Ich bin auch ohne Sonne braun“. Ihre Haare sind kurz, gescheitelt und streng gekämmt. Sie zeigen den White Power- oder gar den Hitlergruß. Sie sind Teenager, die gegen queere Demonstrationen aufmarschieren, Brandanschläge auf Kulturhäuser verüben oder Politikerinnen und Politiker auf offener Straße krankenhausreif schlagen: Sie verkörpern eine neue Generation junger Neonazis, die selbstbewusst und extrem gewaltbereit auftritt. Öffentlich treten sie unter Namen wie „Jung und Stark“, „Deutsche Jugend voran“ oder „Letzte Verteidigungswelle“ auf. Welche Gefahr geht von diesen Neonazis aus? Kehrt mit ihnen eine Welle rechter Gewalt wie in den 1990er Jahren zurück, die inzwischen in der zeitgeschichtlichen Betrachtung als „Baseballschlägerjahre“[1] bezeichnet werden?
Die rechte Gewalt der 1990er und 2000er Jahre, die heute mit diesem Begriff beschrieben wird, war ein Faktum in West- wie in Ostdeutschland. Dominierten in Westdeutschland tendenziell Brandanschläge auf Asylunterkünfte das Gewaltgeschehen, so waren es in Ostdeutschland Formen rassistischer Massengewalt. Sie existierten allerdings keineswegs nur zu Beginn der 1990er Jahre, wie das Beispiel Dresden-Heidenau zeigt, wo organisierte Neonazis zusammen mit Anwohnern auch noch im Jahr 2015 über Tage eine Asylunterkunft belagerten.[2] Wiederholt sich heute ein Muster rechter Gewalt und ihrer organisierten neonazistischen Kerne?
Ende Mai dieses Jahres ging die Generalbundesanwaltschaft gegen die Neonazis der „Letzten Verteidigungswelle“ vor. Ihnen wird vorgeworfen, Anschläge auf Unterkünfte für Asylsuchende in Thüringen und auf ein Kulturhaus in Brandenburg begangen zu haben. Der Fall erregte besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, weil es sich bei den Tatverdächtigen zum Teil um Jugendliche und minderjährige Heranwachsende handelt.[3] Die Aktivitäten der Gruppe wurden auch deshalb bekannt, weil ein Journalistenteam des Magazins „Stern“ undercover in der Szene recherchiert hatte und deren Pläne gegenüber den Behörden aufdeckte.[4] Nun wird wegen des Verdachts der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung gegen diese Jugendlichen ermittelt.
Bereits in den vergangenen Jahren häuften sich Angriffe von zum Teil sehr jungen Neonazis etwa auf CSD-Paraden in ostdeutschen Städten: So wurden Teilnehmende des CSD in Halle (Saale) 2023 von Neonazis verfolgt und angegriffen.[5] In Bautzen kam es 2024 zu Angriffen, als dort zeitgleich zum CSD zwei rechte Gegendemonstrationen stattfanden, die sich aggressiv gegen die öffentliche Sichtbarkeit queeren Lebens wandten. Aus Furcht vor Übergriffen wurde damals die Aftershow-Party des CSD abgesagt. Laut dem Autor:innenkollektiv Feministische Intervention wurden von 200 bundesweit stattfindenden Paraden 68 angegriffen oder gestört.[6]
Zu einem regelrechten Gewaltexzess kam es Mitte Juni in Bad Freienwalde (Brandenburg), wo Neonazis ein regionales Bürgerfest für Demokratie überfielen. Laut Presseberichten waren die Täter vermummt, bewaffnet und gingen planvoll gegen ihre Opfer vor. Es gab drei Verletzte.[7]
Wiederkehr oder Kontinuität neonazistischer Gewalt?
Die Frage, warum neonazistische Gewalt wiederkehrt, beschäftigt die Öffentlichkeit wie die Wissenschaft.[8] Dabei gilt es zunächst zu prüfen, ob der seit etwa zwei Jahren zu beobachtende Wiederaufschwung einer jugendkulturell geprägten Neonaziszene wirklich eine neue Qualität besitzt oder ob es sich vielmehr um eine Kontinuität rechtsextremer Vergemeinschaftung und Organisation handelt, nunmehr unter durch die Digitalisierung politischer Kommunikation veränderten Bedingungen.
Für die Kontinuitätsthese spricht zunächst, dass, entgegen der öffentlichen Wahrnehmung, rechte und rassistische Gewalt in Deutschland zu keinem Zeitpunkt verschwunden waren. Die Statistiken der Beratungsstellen für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt zeigen, dass rechte und rassistische Gewaltstraftaten in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau verharrten und 2024 neue Rekordwerte erreichten. Auch wenn die Fallzahlen der Beratungsstellen von denen des Bundeskriminalamts abweichen, ist das hohe Niveau rechter und rassistischer Gewalt evident. Diese Tatsache wurde in der Öffentlichkeit verdrängt, nicht zuletzt durch die durchaus zu Recht geführten Diskurse über die Gefahren des Islamismus, aber auch durch von antimuslimischem Rassismus geprägte Deutungen über „Migrantengewalt“. Selbst das Bundesinnenministerium unter Alexander Drobrindt (CSU) konzediert heute, wie schon seine Vorgängerin Nancy Faeser (SPD), dass vom Rechtsextremismus eine konstant hohe Gefahr für die Demokratie und das Zusammenleben der Menschen ausgeht. In den zurückliegenden Wahlkämpfen zur Europawahl und zur Bundestagswahl gab es zahlreiche körperliche Angriffe von Neonazis auf Wahlkampfhelfer und Mandatsträger. Dabei stach der Angriff auf den sächsischen SPD-Politiker Matthias Ecke im Mai 2024 ob seiner Brutalität besonders hervor.[9]
In den Tagen nach solch schweren rechten Gewalttaten mehren sich sodann ritualhaft Rufe nach Strafverschärfungen, nach Zivilcourage und einer Kultur der Anerkennung und des Schutzes für Kommunalpolitikerinnen und -politiker, die keinen Zugriff auf einen Dienstwagen oder Personenschutz haben – zumeist ohne spürbare Folgen. Daher fühlen sich viele ehrenamtlich tätige kommunale Vertreterinnen und Bürgermeister massiv bedroht und nicht ausreichend geschützt; viele tragen sich mit dem Gedanken, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.
Wiewohl rechte und rassistische Gewalt nie wirklich verebbt ist, haben sich die Umstände, unter denen Jugendliche und junge Erwachsene mit rechtsextremen Inhalten konfrontiert werden, völlig verändert.
Radikalisierung durch Social Media
An die Stelle von Aufklebern, Flugblättern und sogenannten Schulhof CDs, wie sie die NPD noch vor etwas mehr als einem Jahrzehnt vor Schulen verteilte, sind Social-Media-Kanäle getreten, in denen offen neonazistische Inhalte niedrigschwellig angeboten werden. Im Messengerdienst Telegram etwa muss man nicht lange nach rechtsextremen Inhalten suchen. Neonazigruppen wie die „Freien Sachsen“ oder auch Rechtsrockbands veröffentlichen in diesen Foren nicht nur eine Flut von Bildern und Videos von ihren Aktionen, sondern machen auch ein direktes Kommunikationsangebot. Politiker wie der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke erzielen mit ihren Inhalten eine immense Reichweite. Bei Tiktok und Instagram ist ein ganzes Biotop rechtsextremer Influencer entstanden, deren digitale Propagandabauchläden für jede rechte Subkultur und spezielle Zielgruppe – darunter keineswegs nur Jugendliche – etwas zu bieten haben. Hinzu kommen rechte Podcasts, Blogs und Videostreamer, die wiederum auf ein Netzwerk weiterer rechter Medienaktivisten verweisen. Der intellektuelle Anspruch dieser Formate oszilliert zwischen kurzen Clips, die ihre Zielgruppe aktivistisch mobilisieren wollen, bis hin zu Podcasts, in denen rechtsextreme Weltanschauungen ausführlich vorgestellt, Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt diskutiert oder detaillierte Strategiedebatten der extremen Rechten gespiegelt werden. Hinzu kommen regelrechte Social-Media-Kampagnen aus dem AfD-Umfeld, die sich der Klaviatur dieser Plattformen strategisch clever bedienen.
Gewiss, es gibt keinen Automatismus, dass sich die Nutzer der zum Teil ideologisch schillernden Angebote rechtsextremer politischer Verortung politisch radikalisieren. Doch das Zusammenspiel einer mit Bildern, Symbolen und schnellen Videoschnitten operierenden Politik der Emotionen einerseits und der oftmals nur einen Klick entfernten Gewaltassoziationen gegenüber politischen Gegnern der extremen Rechten andererseits schafft einen digitalen Gesinnungsraum, in dem sich problemlos zwischen Holocaustleugnung, der Ankündigung einer rechten Demonstration und der Abwertung der von rechts als „Kartellparteien“ gescholtenen demokratischen Parteien wechseln lässt. Verschwörungstheorien, die ebenso Anleihen bei der Reichsbürgerideologie aufnehmen wie bei rechter Esoterik, werden an aktuelle Ereignisse angepasst und erzielen eine Reichweite, die analoge Medien kaum mehr erreichen.
Die Normalisierung rechter Politik
Und doch: Das Internet ist nicht für die Herausbildung einer neuen Generation von Neonazis verantwortlich. Alle derzeit erfolgreichen rechtsextremen Social-Media-Formate sind vielmehr ein Echo der Normalisierung rechtsextremer Deutungen in Politik und Lebenswelt der vergangenen Jahrzehnte. Diese wiederum korrespondiert mit dem Aufstieg der AfD, die bis auf Bremen und Schleswig-Holstein in allen Bürgerschaften und Landtagen sowie im Bundestag vertreten ist. Seit ihrem Bestehen hat die Partei die Grenzen des Sagbaren und die politischen Tabus in der Gesellschaft mehr als deutlich nach rechts verschoben. Die Generation jener Jugendlichen, die sich derzeit im Nahfeld des politischen Neonazismus sozialisiert, erlebte Zeit ihres Lebens eine Normalisierung rechtsextremer Politik, besonders dort, wo die AfD bei Wahlen überdurchschnittlich gut abschnitt. Eine Langzeitperspektive dieser Normalisierung rechtsextremer Einstellungen bietet die sozialwissenschaftliche Forschung, deren Ergebnisse seit mehr als zehn Jahren auf eine hohe Zustimmungsbereitschaft für rechtsextreme und rassistische Einstellungen verweisen.[10] Zugleich beobachten Lehrerinnen und Sozialarbeiter vermehrt, dass sie es in Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe mit den Kindern der „Generation Hoyerswerda“ zu tun haben, also mit jenen, deren Eltern von der in den 1990er Jahren mancherorts dominierenden rechten Jugendkultur geprägt wurden. Dies zeigt, wie rechte politische Orientierungen transgenerationell weitergegeben werden.
Organisatorisch ist der militante Neonazismus keineswegs einheitlich aufgestellt. Neben der Kleinstpartei „Der Dritte Weg“ und den „Jungen Nationalisten“ (JN), der Jugendorganisation der Partei „Die Heimat“ (ehemals NPD), werben diverse regionale Neonazigruppierungen um Jugendliche und junge Erwachsene. Politisch-ideologisch bezieht sich Der Dritte Weg offen auf den historischen Nationalsozialismus. Die anderen genannten Organisationen bedienen sich des ideologischen Arsenals des Nazismus bzw. Neonazismus und seiner Formen. Die aufgeführten Strukturen als einheitliche Bewegung in einem bewegungssoziologischen Sinne aufzufassen, ginge fehl. Vielmehr handelt es sich um einen politischen Bewegungskern, dessen Akteure versuchen, in der Sphäre rechter Pop- und Jugendkultur organisierend wirksam zu werden.
Die sich häufenden Hilferufe von Lehrerinnen und Lehrern geben einen Hinweis darauf, dass rechtsextreme Orientierungen bei Jugendlichen keine isolierten Einzelfälle sind. Wie aber ließe sich einer rechtsextremen Orientierung bei Jugendlichen wirksam entgegentreten?
Die sozialpädagogische Forschung und Praxis hat hierzu in den vergangenen 25 Jahren umfangreiche Erkenntnisse publiziert.[11] Sie alle empfehlen, Jugendlichen konkrete, die Selbstwirksamkeit stärkende, alternative Handlungsräume zu eröffnen. Wozu sie jedenfalls nicht raten, ist eine Rückkehr zur „akzeptierenden Jugendarbeit“. Das unter der damaligen Bundesjugendministerin Angela Merkel (CDU) initiierte „Aktionsprogramm gegen Agression und Gewalt“ (AgAG) sollte die Jugend- und Sozialarbeit mit rechten Jugendlichen und jungen Erwachsenen professionalisieren und rechte Jugendkultur und rassistische Gewalt zurückdrängen. Doch gerade in den ostdeutschen Bundesländern zeitigte das Programm einen gegenteiligen Effekt: Die neonazistische Jugendkultur erschloss sich darüber neue und erweiterte Resonanzräume. Einige Rechtsrockbands probten in Jugendclubs, in denen akzeptierende Jugendarbeit stattfand, Fahrten zu Auswärtsspielen lokaler Fussballclubs mit rechten Hooligans stabilisierten die rechte Jugendkultur eher, statt sie zurückzudrängen. Es war die Anlage und die Umsetzung des Programms, die der Hegemonie rechter Jugendkultur in den frühen 1990er Jahren eine – wenn auch unabsichtliche – Starthilfe gab. Eine Rückkehr dahin, wie sie offenkundig dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer vorschwebt[12], wird auch jetzt nicht erfolgreich sein, im Gegenteil. Wer zum Muster des Jugendclubs als Basis rechtsextremer Selbstorganisation zurückkehrt, wird neonazistische Strukturen nicht schwächen, sondern wieder und weiter stärken.
[1] Vgl. Christian Bangel, #baseballschlägerjahre: Ein Hashtag und seine Geschichten, in: „Aus Politik und Zeitgeschichte“ (APuZ), bpb.de, 2.12.2022.
[2] Vgl. David Begrich, Wir sind das Pack: Von Hoyerswerda nach Heidenau, in: „Blätter“, 10/2015, S. 9-12.
[3] Vgl. Michael Götschenberg, Rechtsextreme Terrorzelle: 16- und 18-Jähriger in MV festgenommen, ndr.de, 22.5.25.
[4] Vgl. „Die Nazi-Kinder“: Wie Rechtsextreme Jugendliche rekrutieren, Brandanschläge verüben und die Demokratie abschaffen wollen, in: „Stern“, 19/2025.
[5] Vgl. Staatsschutz ermittelt nach Angriffen auf CSD-Teilnehmende, mdr.de, 12.9.2023.
[6] Vgl. Autor*innenkollektiv Feministische Intervention (AK Fe.In), Demonstrationen, Angriffe und Störungen: Nazis greifen queeres Leben an. Ein Rückblick auf die Pride-Saison 2024, nsu-watch.info, 2.5.2025.
[7] Vgl. Vermummte in Bad Freienwalde: Attacke auf Fest gegen rechts, tagesspiegel.de, 16.6.2025.
[8] Vgl. Julius Geiler, Revival zu beobachten. Wie gefährlich sind die neuen Neonazi-Jugendgruppen?, tagesspiegel.de, 19.3.2025.
[9] Vgl. David Begrich, Nach Angriff auf Matthias Ecke, Unterstützt die Demokraten vor Ort, freitag.de, 6.5.2024.
[10] Vgl. Andreas Zick, Beate Küpper und Nico Mokros, Die distanzierte Mitte. Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2022/23, herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von Franziska Schröter, Bonn 2023.
[11] Vgl. hierzu exemplarisch: Kevin Stützel, Jugendarbeit im Kontext von Jugendlichen mit rechten Orientierungen. Rekonstruktiv-praxeologische Perspektiven auf professionelles Handeln, Wiesbaden 2019.
[12] Vgl. Michael Kretschmer, „Was könnte Wladimir Putin von uns wollen?“, zeit.de, 25.5.2025.