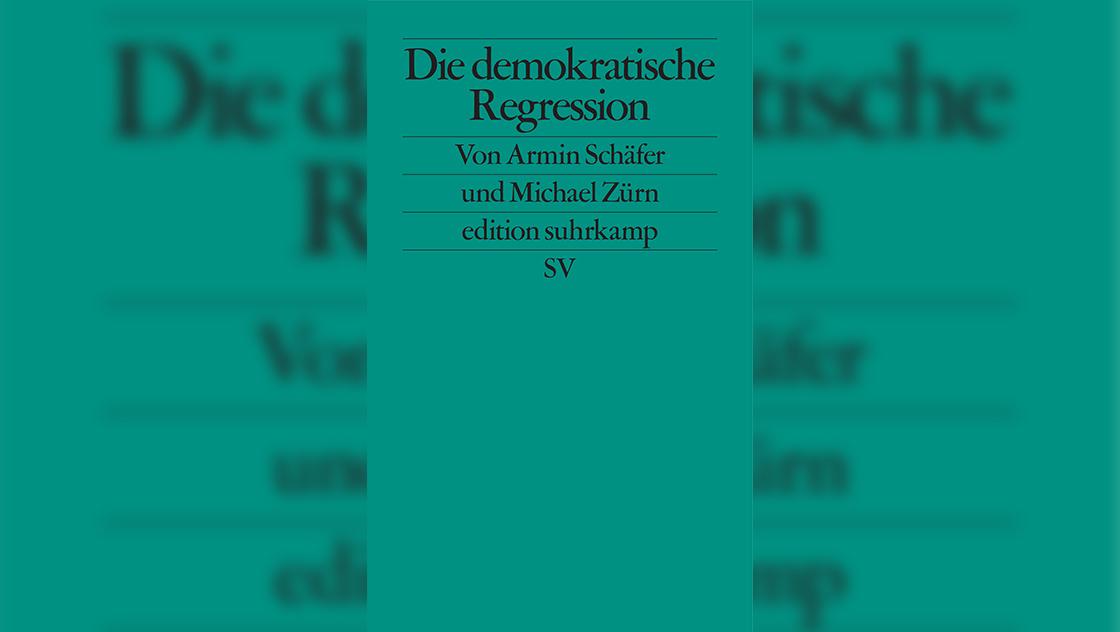
Bild: Armin Schäfer und Michael Zürn, Die demokratische Regression, Suhrkamp Verlag 2021.
Worin liegen die Ursachen für den autoritären Populismus, der in den letzten Jahren weltweit an Dominanz gewonnen hat? Und wie steht es um die Zukunft der Demokratie angesichts der populistischen Erfolge? Das sind die Fragen, die sich die Politikwissenschaftler Armin Schäfer und Michael Zürn in ihrem Buch „Die demokratische Regression“ stellen. Schäfer ist Professor an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Zürn leitet die Abteilung „Global Governance“ am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. „Die politischen Ursachen des autoritären Populismus“ – so der Untertitel – wollen sie in ihrer Studie analysieren. Das ist bereits eine programmatische Ansage.
Denn bisher, so ihre Beobachtung, haben zwei Erklärungsmodelle die Debatte über den Populismus bestimmt: Entweder wurde er aus ökonomischer oder aus kultureller Perspektive beschrieben; entweder hat man ihn als Reaktion von wirtschaftlichen Verlierern betrachtet, deren Wohlstand durch die Globalisierung bedroht wird (Philip Manow) – oder als Widerstand gegen eine kosmopolitische Elite, die für den Alltag und die Werte der „einfachen Menschen“ kein Verständnis mehr aufbringen kann (Cornelia Koppetsch). Beide Erklärungen greifen zu kurz, so Schäfer und Zürn.









