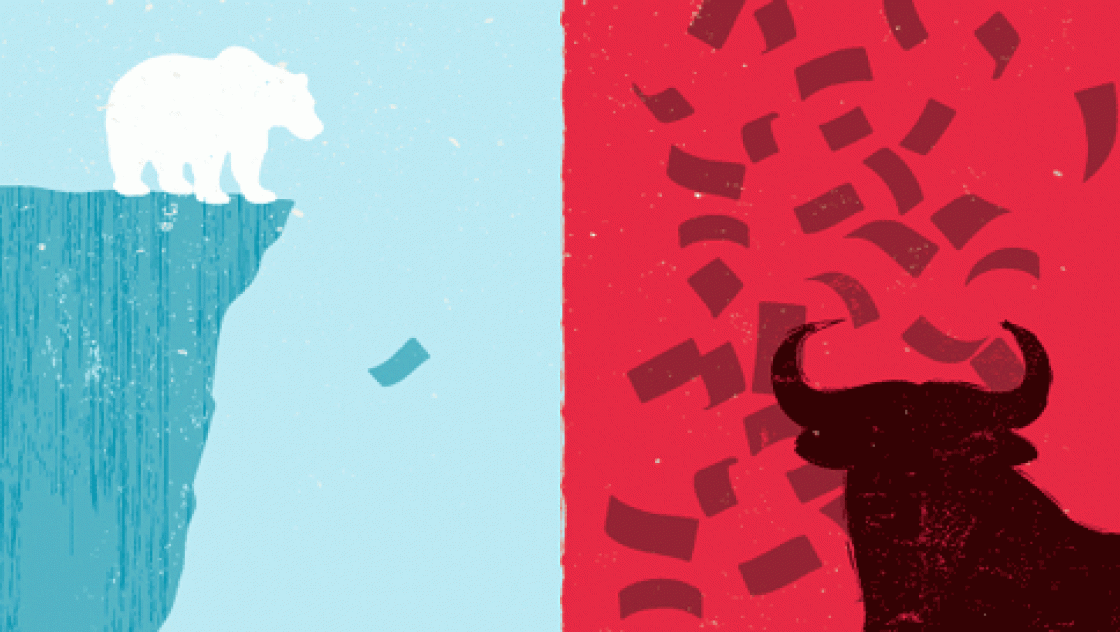Der Neoliberalismus und die Aktualität des Racket-Begriffs
Explodierende Kapitalgewinne bei steigender Massenarmut, prekäre Arbeitsverhältnisse bis hin zur Sklavenarbeit: Die klassenpolitischen Folgen des Shareholder-Value-Kapitalismus sind spätestens seit Beginn der Finanzkrise vor sechs Jahren[1] offensichtlich. Dennoch fehlt es der kritischen Sozialwissenschaft an einem Begriff, der soziale Ungleichheit kohärent thematisiert und zugleich die neuen Elitenstrukturen im globalisierten Kapitalismus adäquat erfasst. Zwar hat die Klassenanalyse keine Probleme, die „Verlierer“ der aktuellen Politik zu benennen, aber vor der theoretischen Eingrenzung der „Gewinner“ kapituliert sie nach wie vor.
Diese Leerstelle hat eine lange Tradition: Bereits Max Horkheimer und Theodor W. Adorno hatten erkennen müssen, dass die Aussagekraft des Klassenbegriffs an seine Grenzen stößt. Die „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten bildete für sie die Zäsur in ihrer Theoriebildung. Am Ende stand der Abschied von einer zwangsläufig zum Klassenkampf führenden Entwicklungslogik. Adorno konstatierte: „Der Unterschied von Ausbeutern und Ausgebeuteten tritt nicht so in Erscheinung, dass er den Ausgebeuteten Solidarität als ihre ultima ratio vor Augen stellte: Konformität ist ihnen rationaler. Die Zugehörigkeit zur gleichen Klasse setzt längst nicht in Gleichheit des Interesses und der Aktion sich um.“[2]
Aus dieser pessimistischen, aber durchaus erfahrungsgesättigten interessenpolitischen Einschätzung entwickelten die Begründer der Kritischen Theorie zum Ende der 1930er Jahre in zahlreichen Schriften den Racket-Begriff – als herrschaftstheoretisches Muster, das der „Dialektik der Aufklärung“ ebenso wie ihrer „Anthropologie des Tauschverhältnisses“ zugrunde liegt. Zweifellos bilden die diversen Racket-Fragmente keine kohärente Gesellschaftstheorie. Sie beinhalten aber nach wie vor hoch aktuelle Aspekte. Ja, mehr noch: Aspekte, die ihre wahre Aktualität erst im Neoliberalismus wirklich entfalten – in Zeiten eines globalen Finanzkapitalismus, der nicht nur die Grenzen zwischen Rechtssystemen auflöst, sondern auch zwischen legalen und illegalen Geschäften.
Surplusaneignung als Schutzgelderpressung
Das Wort „Racket“ kommt aus der amerikanischen Umgangssprache und meint ursprünglich den Zustand der Schutzgelderpressung beziehungsweise die Gruppe, die Schutzgeld erpresst. Der „Racketeer“ ist der Protagonist und das „Racketeering“ die Ausübung seiner Herrschaft. Rackets wurden in den 1930er und 40er Jahren in vielen amerikanischen Studien erwähnt.[3] Die Bezeichnung wurde sowohl für illegale als auch für legale Jobs verwendet.[4] Gerade diese aus dem Slang resultierende Doppeldeutigkeit machte die Rackets für Horkheimer attraktiv. Er erwähnt sie erstmals in dem unveröffentlichten Text „Die Rackets und der Geist“von 1939/40, in dem das Racket die „Grundform der Herrschaft“ bezeichnet und als solches immer gegen den Geist verschworen ist.[5] In der „Dialektik der Aufklärung“ übernehmen Adorno und Horkheimer das Wort und verwenden es auch synonym für Clique, Bande, Gruppe oder Gang.
Nicht ohne Grund hat der Racket-Begriff seinen Ursprung in der Schutzgelderpressung, denn Adorno und Horkheimer sehen fließende Übergänge zwischen der monopolkapitalistischen Praxis der Surplusaneignung und der „außergesetzlichen“ Herrschaft schutzgelderpresserischer Banden. Letztere betreiben die Aneignung lediglich mit Methoden, die zum Staatsmonopol – der „physischen Zwangsgewalt“ – in Konkurrenz treten können. „Der Verbrecher“, so Horkheimer, „repräsentiert das unrationellere, primitivere Racket gegenüber dem vom Staat geschützten Klassenmonopol. Sein Beruf weist auf früh- und vorbürgerliche Formen der Herrschaft zurück; sie wuchern als Mafia und Camorra verachtet in der Gegenwart wie gestürzte Gottheiten, die vor der neuen Religion zu dämonischen Mächten geworden sind.“[6]
Horkheimer führt den Racketbegriff somit als herrschaftstheoretische Erweiterung des Klassenbegriffs ein. Ursprünglich war der Begriff für die staatskapitalistischen Analysen vorgesehen, die im exilierten Institut für Sozialforschung betrieben wurden. Der Staatskapitalismus wurde dabei als letzte Stufe der bürgerlichen Geschichte betrachtet. Die Ausformulierung des Racketbegriffs ging aber schon in den frühen Texten weit über die Anbindung an den Staatskapitalismus hinaus. Horkheimer bezweckte vielmehr eine analytische Entschlüsselung der allgemeinen bürgerlichen Herrschaftsprinzipien. Das Racket diente ihm als theoretische Folie, auf der sich die Kontinuität und Intensität von Herrschaftsmustern historisch ablesen lassen soll: „Jede herrschende Klasse ist immer insofern monopolistisch gewesen, als sie sich von der überwältigenden Mehrheit der Menschen abriegelte. Die Struktur entsprach der konkurrierender Rackets. Selbst die gesellschaftlich nützlichen Funktionen, welche die herrschenden Klassen ausübten, haben sich in Waffen gegen die unterdrückte Bevölkerung und gegen die konkurrierenden Gruppen ihrer eigenen Klasse verwandelt.“[7]
Aus der Hegemonie des Kapitalverhältnisses im Liberalismus resultiert der allgemeine Konkurrenzdruck, der sich stets auf das Grundprinzip kapitalistischer Reproduktion bezieht: das Interesse an der Aneignung des Mehrwerts. Adorno erkennt darin einen latenten Akt der Unterwürfigkeit, den er allen Klassen unterstellt: „Die Interessengleichheit reduziert sich auf die Partizipation an der Beute der Großen, die gewährt wird, wenn alle Eigentümer den Großen das Prinzip souveränen Eigentums zugestehen, das jenen ihre Macht und deren erweiterte Reproduktion garantiert: die Klasse als ganze muss zur äußersten Hingabe ans Prinzip des Eigentums bereit sein, das sich real vorab aufs Eigentum der Großen bezieht.“[8]
Letztlich bindet sich der Begriff des Rackets – ebenso wie die „Dialektik der Aufklärung“ als solche – nicht nur an eine konkrete, historische Formation,[9] sondern soll zudem eine „Theorie der politischen Praxis der herrschenden Klassen“ begründen. Horkheimer und Adorno reformulieren und erweitern so ihr materialistisches Herrschaftskonzept über die Beziehung zwischen Rackets und Klassen.
Die Grenzen des Klassenbegriffs
Die Gestalt und Intensität dieser Beziehung ist dabei stets von historischen Machtverhältnissen geprägt. Nicht nur Horkheimer und Adorno galt spätestens seit Faschismus und Stalinismus die Emanzipation der Arbeiterklasse als gescheitert. Ihre Integration in die totalitären Herrschaftssysteme wurde von der Kritischen Theorie als abgeschlossen betrachtet. Die Gewerkschaften im Westen hätten durch verschiedene Reformstrategien ihre Struktur und Funktion denselben Herrschaftsprinzipien angeglichen, die sie ursprünglich überwinden wollten. Die amerikanischen Gewerkschaften im New Deal würden ihre Politik und gesellschaftliche Aufgabe nun nur noch als „business“ betrachten.[10]
Diese pessimistische Diagnose resultierte aus den Skandalen der korrupten Funktionäre des Big Labor im New Deal wie auch aus der nationalistischen Rolle der deutschen Arbeiterbewegung im Ersten Weltkrieg, ihrer Spaltung in der Weimarer Republik und der dann folgenden Passivität und Zerschlagung im „Dritten Reich“. Hinzu kam die Enttäuschung über die Arbeiterklasse in anderen europäischen Ländern und ihre autoritäre Konsolidierung in Sowjetrussland. Diese Erfahrungen führten zur bereits erwähnten theoretischen Relativierung des Klassenkampfs, der sich in eine „Klassenanpassung und in Kriege umgewandelt“ habe.[11] Der eigentliche Klassenantagonismus, wie auch die ausbeuterische Politik des Kapitals, hat sich damit auf die internationale Ebene verschoben.[12] Der Klassenkampf träte in den Metropolen nur noch als Handel zwischen den verschiedenen „monopolistischen Einheiten“ von Arbeit und Kapital in Erscheinung.
Diese Diagnose ist nicht zuletzt ihrer Zeit geschuldet. Dass zwischen Kapital und Arbeit stets ein immanentes Machtgefälle besteht, schließen die Protagonisten der „Frankfurter Schule“ allerdings auch hier nicht aus. Doch gerade der Racket-Begriff macht die Dynamik in der politischen Praxis der „herrschenden Klassen“ hinsichtlich der Integration der „Beherrschten“ äußerst anschaulich.
Geschichte, Herrschaft und das ewige Privileg der Eliten
Die Rackets sind tief in die Geschichtsphilosophie der „Dialektik der Aufklärung“ eingebunden: Ebenso, wie die Rache in der Strafe ihre zweite gesellschaftliche Natur erfahren hat, hat sich die physische Stärke in der „Urhorde“ zum Privileg des Rackets gewandelt.[13] Horkheimer macht die ursprüngliche Unterwürfigkeit gegenüber Rackets an den Initiationsriten des „primitiven“ Stammes deutlich. Um in das patriarchalische „bevorzugte Racket der Zauberer“ aufgenommen zu werden, verlangten diese die „völlige Brechung der Persönlichkeit“ – nicht anders als heute: „Das Verhalten des Einzelnen zum Racket, sei es Geschäft, Beruf oder Partei, sei es vor oder nach der Zulassung, die Gestik des Führers vor der Masse, des Liebhabers vor der Umworbenen nimmt eigentümlich masochistische Züge an. Die Haltung, zu der jeder gezwungen ist, um seine moralische Eignung für diese Gesellschaft immer aufs neue unter Beweis zu stellen, gemahnt an jene Knaben, die bei der Aufnahme in den Stamm unter den Schlägen des Priesters stereotyp lächelnd sich im Kreis bewegen.“[14]
Für Horkheimer ist die Imitation des herrschenden Habitus die Grundlage für den Erhalt des Privilegs. Rackets sind für ihn die subtile, disziplinierende Institution, der das Individuum nicht nur in der bürgerlichen Gesellschaft unterworfen ist.[15] Ihn verfolgt die Frage, inwieweit sich die religiösen und mythologischen Ideale der Vorzeit zur „zweiten gesellschaftlichen Natur“, zu technokratischen Idealen der Produktivität in der Neuzeit wandelten und damit wiederum dem „ewigen“ Ziel dienen: der Stabilisierung partikularer Herrschaft in Rackets.
Im Ergebnis kann der Racket-Ansatz, wie Michael Th. Greven konstatierte, als „eine Theorie der Gewalt“ bezeichnet werden, „auf die sich die Herrschaft genetisch-kausal gründet und die auch in ihren höheren Vermittlungsformen stets noch den letzten Grund darstellt, auf den sich Herrschaft und Unterwerfung zurückführen lassen“.[16]
Das Racket-Muster beschreibt präzise die Selbstreferentialität der privilegierten Eliten, wie sie auch in aktuellen Studien hervortritt.[17] Nach außen legitimieren sie sich über vermeintliche Leistungsmerkmale, die als Substrat und Ergebnis gesellschaftlichen Wettbewerbs gerechtfertigt erscheinen. Diese angeblichen Auslesekategorien verschleiern jedoch das tatsächliche Zustandekommen des Privilegs, das im Racket-Muster desavouiert wird. Adorno charakterisiert und kritisiert die Elitenauslese wie folgt: „Seine [des liberalen Elitebegriffs,K.L.] Unwahrhaftigkeit besteht darin, dass die Privilegien bestimmter Gruppen teleologisch für das Resultat eines wie immer gearteten objektiven Ausleseprozesses ausgegeben werden, während niemand die Eliten ausgelesen hat als etwa diese sich selber. [...] Die mangelnde Homogenität der Eliten ist eine Fiktion, verwandt der marktgängigen vom Chaos der Wertewelt und der Zersetzung aller festen Ordnungen. Wer nicht hereinpasst, wird draußen gehalten.“[18] Auch Otto Kirchheimer beschreibt das Privileg der Racketmitglieder und die ihrer Herrschaftslegitimation inhärenten Widersprüche: „‚Rackets’ scheinen zu einem Stadium der Gesellschaft zu gehören, wo der Erfolg mehr vom Zugang zu Organisationen und zu technischen Mitteln aller Art abhängt als von besonderen Talenten.“[19]
Rackets nach dem Faschismus: Legalität versus Legitimität
Horkheimer hält auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland am Racketbegriff fest. Diverse Gesprächsnotizen dokumentieren seine Überlegungen bis in die späten 60er Jahre. Dabei verbindet er den Begriff auch weiterhin mit privilegierten Gruppen, vor allem im Verwaltungsapparat und in den Konzernen. Er unterstellt den Rackets einen fast konspirativen Charakter: „Die mehr oder weniger rasch wechselnden Zusammenschlüsse, Kompromisse und Streitigkeiten der Rackets bestimmen die politischen Maßnahmen. Der Einzelne ist Objekt der Manipulation, völlig ohnmächtig, wenn er nicht in einem Racket eine besondere Stellung einnimmt.“[20]
Die Racketeers konsolidieren in diesem Muster ihre Stellung über die Dynamik von Bündnissen, Konflikten und Intrigen. Die konkurrierenden Rackets bilden dadurch eine flexible Konfiguration, in der die maßgeblichen politischen Entscheidungen getroffen werden. Sie formieren sich laut Horkheimer bis in die Parlamente, um ihre Klientelpolitik zu betreiben.[21]
Die Legalität dieser Herrschaftspraxis steht im Racket-Muster nicht im Mittelpunkt, schließlich sind die Grenzen von Raub und Tausch im Kapitalismus oftmals fließend, nämlich „ideologischen Trends“ der Produktionsweise unterworfen und letztlich eine Sache der Interpretation. Die Korruptionsforschung, die in den letzten zwanzig Jahren eine immense Konjunktur erfuhr, war sich dieses Problems – der fließenden Grenzen – stets bewusst. Wichtiger als die Frage der Legalität ist daher die Frage der Legitimität, der Anerkennung und Rechtfertigung von Herrschaftspraxis durch die Gesellschaft. Das Racket legitimiert sich nach Horkheimer dadurch, dass es als der „echte Leviathan den rückhaltlosen Gesellschaftsvertrag“[22] fordert. Auch Adorno erweitert das Prinzip „Schutz gegen Gehorsam“ zum Spezifikum der bürgerlichen Gesellschaft: „Das bürgerliche Klassenbewusstsein zielt auf den Schutz von oben, das Zugeständnis, das die eigentlich herrschenden Eigentümer denen machen, die ihnen mit Leib und Seele sich verschreiben.“[23]
Offensichtlich erfährt die Herrschaftsformation des Rackets erst im neoliberalen Zeitalter ihre eigentliche Verwirklichung. Denn Politik hat sich heute, in Zeiten einer „marktkonformen Demokratie“ (Angela Merkel), ausnahmslos ökonomischen Kriterien wie Austerität und Privatisierung zu unterwerfen – sie selbst wird wie alles zum Business. Die Politik ist damit zur Annäherung an die ökonomisch Privilegierten regelrecht verpflichtet.
Hier kommt der Widerspruch zwischen liberalistischem Klientelismus und echter, demokratischer Repräsentation zum Vorschein. Der Racketbegriff erwächst aus dieser Widersprüchlichkeit, weil er zeigt, dass Staatlichkeit auch in anderen, legalen oder illegalen, Gruppen imitiert wird und so Legitimität, als Souveränität und Schutz, auch in archaischen Formen durch wirtschaftlichen Erfolg geschaffen werden kann.
Die racketlose Gesellschaft und die „Idee der Demokratie“
Schon in seinem ersten Racket-Text „Die Rackets und der Geist“bezeichnet Horkheimer das Herrschaftsprinzip der Rackets als Muster, dem nicht nur die etablierten Gruppen unterworfen wären. Vielmehr müsste es als subtiles Macht- und Politikmuster auch von sozialen Bewegungen für ihren Organisationsaufbau reflektiert werden, um die Imitation desselben auszuschließen. Horkheimer verfällt dabei keinesfalls in eine kulturpessimistische Haltung; politische Kämpfe sind nach seiner Auffassung nicht ausweglos. Nur ein politischer Kampf, der Kritik verharmlost oder einseitig artikuliert, begibt sich in den Verdacht, Bestehendes zu reproduzieren – und eben das unternehmen die Rackets. Auch deshalb zielt Horkheimers Begriffsbildung auf eine Differenzierung der Klassentheorie, damit Herrschaftskritik nicht dem zu pauschalen Paradigma des Klassenkampfs verhaftet bleibt.
Die durch den Racket-Ansatz differenzierte Klassenkampfmetapher wurde von Horkheimer durch eine weitaus allgemeinere, aber heutzutage nach wie vor hoch aktuelle Annahme erweitert – nämlich durch die „Idee der Demokratie“, die – wie auch immer ausgestaltet – das politische Denken der Menschen begleite.
Daran wird die aufklärerische Intention und letztlich auch der Forschungsauftrag des Racket-Ansatzes deutlich, den Horkheimer folgendermaßen formuliert: „Eine wahre Soziologie des Rackets als des lebendigen Elements der herrschenden Klasse in der Geschichte könnte sowohl einem politischen als auch einem wissenschaftlichen Zweck dienen. Sie könnte helfen, das Ziel der politischen Praxis zu klären: Eine Gesellschaft, deren Muster sich von dem des Rackets unterscheidet, eine racketlose Gesellschaft. Sie könnte dazu beitragen, die Idee der Demokratie zu definieren, die in den Köpfen der Menschen noch immer ein Schattendasein führt. Heute haben die Rackets diese Idee in ihre ökonomische und politische Praxis eingebaut.“[24]
In „Die Rackets und der Geist“ beschreibt er die Idee der Demokratie weiter: „In der wahren Idee der Demokratie, die in den Massen ein verdrängtes, unterirdisches Dasein führt, ist die Ahnung einer vom Racket freien Gesellschaft nie ganz erloschen. Die Idee zu entfalten, bedeutet freilich die Durchbrechung einer dicken Suggestion, die noch die wahre Kritik am Racket in seinen Dienst stellt.“[25]
Demokratie und Aufklärung sind demnach eng miteinander verbunden. Ihre Entwicklung und somit die Überwindung des Racket-Musters sind weniger ein zu erlangender Zustand als vielmehr ein permanenter Prozess der Verwirklichung einer immer racketloseren Herrschaft.
Rackets heute
Der Racketbegriff blieb in der „Kritischen Theorie“ zwar letztlich unausformuliert, aber seine gesellschaftstheoretische Plausibilität und seine Erweiterung der materialistischen Analyse machen ihn für zeitgenössische Diagnosen gerade informeller Herrschaft hoch attraktiv. Denn das Racket bezeichnet eine privilegierte Komplizenschaft, deren Strukturen durch die Festigkeit der internen, informellen Verbindungen und die Intensität der Verflechtung mit staatlichen und wirtschaftlichen, legalen und illegalen Strukturen bedingt ist. Die informellen Verbindungen sind dabei von der ideologischen Nähe der Mitglieder abhängig. Der Eintritt in das Racket ist das entscheidende Privileg, das über Macht oder Ohnmacht, Inklusion oder Exklusion entscheidet.
Dagegen verharrt die materialistische Analyse häufig am vermeintlich „authentischen“ Interessebegriff des Klassenkampfs.[26] Allerdings bleibt die Analyse der herrschenden Klassen die zentrale Grundlage auch für die Identifikation von Racketstrukturen, denn dort wo klassenpolitische Offensiven – wie im Neoliberalismus – den Klassenantagonismus wieder zementieren, verändern sich auch die Racketstrukturen und die vermeintliche Interessengleichheit der Beteiligten wird erneut relativiert.
Die globalen Finanzakteure sind für die moderne Gestalt des Rackets als Herrschaftsmuster exemplarisch: So hat die neoliberale Globalisierung keinesfalls eine isolierte „transnational capitalist class“[27] hervorgebracht, sondern vielmehr eine transnationale Vernetzungsdynamik herrschender Klassen, die nationale Legitimationsmuster, kulturelle Einbettungen und Abhängigkeiten sukzessive außer Kraft setzt und am ehesten mit dem Racketmuster zu erfassen ist.
Rackets und Korruption: Der „Staat als Beute“ und die Rent Seeking Society
Vor allem die Korruptionsforschung hat diese Tendenzen seit längerem erkannt. Sie – wie auch die politikwissenschaftlichen Netzwerktheorien – bieten Kategorien und Annahmen, die dem Racketmuster gewissermaßen folgen. Die Korruptionsforschung wird seit geraumer Zeit von „neoliberalen“ institutionenökonomischen Ansätzen dominiert.[28] Sie definieren unsere heutige Gesellschaft – unter der individualistischen Vorannahme des Homo oeconomicus – auch als „Rent Seeking Society“.[29] Dieses Theorem beschreibt die Bereicherungspraxis dominanter Eliten in den Staatsapparaten. Es bezieht sich auf das Verhalten und die Stellung der privilegierten Akteure, die „staatliche Eingriffe in die (marktwirtschaftliche) Allokation“[30] herbeiführen, beeinflussen und sich an den dadurch abfallenden Renten bereichern. Diese Praxis ist formal über Eigentums- und Verfügungsrechte (wie Monopole, Subventionen oder Schürfrechte) geregelt, die der Staat als Souverän verwaltet und vergibt.
Das Rent Seeking meint somit den Kampf von Gruppen im Staat um diese spezifischen Rechte und Privilegien auf den Märkten. Wenn die Profitmöglichkeiten auf dem politischen Markt lukrativer erscheinen als auf den ökonomischen Märkten, wird das Rent Seeking in den Staatsapparaten entsprechend zunehmen. Dieser Effekt konnte über empirische Analysen speziell osteuropäischer Transformationsgesellschaften nachgewiesen werden. Die informelle Gestalt des politischen Marktes in diesen Ländern begünstigt das Entstehen korrupter Staatsoligarchien, die bisher keine lukrativen Investitionsmöglichkeiten auf den ökonomischen Binnenmärkten erkennen und daher ganz auf die Bereicherung durch Staatsgelder setzen. Analoge Strukturen bestehen auch in vielen Ländern Lateinamerikas, in denen die Staatsapparate von mächtigen Gruppen durchsetzt sind, deren politisches Hauptinteresse in der eigenen Bereicherung besteht. Die extremsten Varianten des Rent Seeking werden als Kleptokratie bezeichnet, womit letztlich die Herrschaft von parastaatlichen Räuberbanden gemeint ist.[31]
Der Rent-Seeking-Ansatz thematisiert daher letztlich den „Staat als Beute“ konkurrierender Machtgruppen, sprich: die Vereinnahmung staatlicher Haushalte durch private Gruppen. Da diese Theorien auch einen pragmatischen Hintergrund für das Handeln neoliberaler Akteure bilden, sagen sie eine Menge über das Wirtschaftsleben unserer Zeit aus. Die analytische Aussagekraft der Rent-Seeking-Ansätze korrespondiert – zumal in Zeiten von „Politik als Business“ – daher glänzend mit den Racket-Thesen Max Horkheimers und Theodor W. Adornos.
Netzwerke und Rackets
Allerdings ist ein klassisches Korruptionskartell zweifellos erst einmal ein Verbrecherkartell, und damit repräsentiert es das „unrationellere Racket“. Den wirtschaftlichen Akteuren stehen heute jedoch speziell auf internationaler Ebene diverse Legitimitätsauffassungen (und -fiktionen) zu ihrer Verfügung, so dass immer „fließendere Übergänge“ zwischen legalem Verhalten und Verbrechen entstehen.
Speziell an diesen Schnittstellen beginnt das besondere Interesse der Netzwerkforscher an „neuen“ informellen Strukturen. Diese wurden durch die Entflechtung der nationalstaatlichen Souveränität massiv verstärkt.
Die Bedeutung informeller Netzwerke wurde zuvor bereits durch die Parteienforschung hervorgehoben, die sie als notwendigen Bestandteil von Entscheidungsverfahren betrachtet.[32] Jean Cartier-Bresson hat ihre Bedeutung auch für Korruptionsnetzwerke präzise dargelegt: „Die unterschiedlichen Korruptionsmuster [zwischen den unterschiedlichen Ländern, K.L.] erklären sich bereits aus den Unterschieden im Aufbau der persönlichen Beziehungsnetzwerke, von denen die wirtschaftlichen und politischen Güter verwaltet werden. Um die verschiedenen Formen von Marktmacht analysieren zu können, die auf der Geber- und der Nehmerseite des Korruptionsmarkts zum Tragen kommen, bedarf es einer Untersuchung von Struktur und Form der gesetzeskonformen Netzwerke, die von Intermediären der öffentlichen Politik aufgebaut wurden.“[33]
Die Forschungsliteratur hat in den letzten beiden Jahrzehnten eine Unmenge an Interaktionsmodellen zur Optimierung der Entscheidungsfindung in informellen Netzwerken geschaffen.[34] Alle diese Netzwerktheorien besitzen allerdings weder eine historische Dimension noch einen kritisch-analytischen Blick auf die sozialen Machtverhältnisse und die Privilegien ihrer Mitglieder – im Gegensatz zum Racket-Ansatz von Horkheimer und Adorno.[35]
Dennoch sind Korruptionsforschung und Netzwerktheorien, indem sie wesentliche Bestandteile des Racket-Musters implizieren, auch ein Beleg für die politische Praxis von Rackets im Neoliberalismus. Das allerdings lässt den Mangel ihrer kritischen Reflexion umso deutlicher hervortreten. Adorno hat daher die Intention der Racket-Theorie gegenüber derartig formalen Ansätzen folgendermaßen kritisch-pointiert zusammengefasst: „Die Theorie, die an der Lage heute lernt, die Banden in den Klassen zu identifizieren, ist die Parodie auf die formale Soziologie, welche die Klassen leugnet, um die Banden zu verewigen.“[36]
Man könnte es auch anders formulieren: Solange die Theorie, ebenso wie die Gesellschaft, der (scheinbaren) Legitimation und Rechtfertigung von Herrschaft verhaftet bleibt, so lange wird es auch und gerade im neoliberalen Finanzkapitalismus keine weitere wissenschaftliche Aufklärung über die Strukturen privilegierter Komplizenschaft und ihre Herrschaftswirkung geben. Aber genau diese Strukturen sollten von der kritischen Sozialwissenschaft ernster genommen werden. Schließlich verbirgt sich hinter den neuerdings viel beklagten feudalen Vermögensverhältnissen im Finanzkapitalismus eine ebenso feudale Herrschaftsstruktur.
[1] Am 15. September 2008 musste die US-Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz erklären, was im Zuge einer politisch durchaus vermeidbaren Kettenreaktion die bis heute anhaltende Wirtschaftskrise auslöste – mit horrender Arbeitslosigkeit, bei allerdings längst wieder sprudelnden Devisen- und Kapitalgewinnen.
[2] Theodor W. Adorno, Reflexionen zur Klassentheorie, in: ders., Gesellschaftstheorie und Kulturkritik, Frankfurt a. M. 1975, S. 11.
[3] Adolf A. Berle und Gardiner C. Means, The Modern Corporation and Private Property, New York 1939; Gordon L. Hostetter und Thomas Beesley, The Rising Tide of Racketeering, in: „The Political Quarterly“, 1933 , S. 403-422; Leo Huberman, The Labor Spy Racket, New York 1937; Harold Seidman und Labor Czars, A history of Labor Racketeering, New York 1938; George E. Solosky, Rackets and Labor, in: „The Atlantic Monthly“, 1938, S. 393-402.
[4] Vgl. Otto Kirchheimer, Zur Frage der Souveränität, in: ders., Politik und Verfassung, Frankfurt a. M. 1964.
[5] Max Horkheimer, Die Rackets und der Geist, in: Gesammelte Schriften (hg. von Alfred Schmidt und Gunzelin Schmid-Noerr), Band 12, Frankfurt a. M. 1985, S. 287 f.
[6] Ders., Theorie des Verbrechers, in: Gesammelte Schriften, Band 12, a.a.O., S. 270.
[7] Ebd., S. 101.
[8] Theodor W. Adorno, Reflexionen zur Klassentheorie, in: ders., Gesellschaftstheorie und Kulturkritik, Frankfurt a. M. 1975, S. 12.
[9] Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Amsterdam 1947, S. 53.
[10] Otto Kirchheimer, Zur Frage der Souveränität, in: ders., Politik und Verfassung, Frankfurt a. M. 1964, S. 73.
[11] Max Horkheimer, Zur Soziologie der Klassenverhältnisse, in: Gesammelte Schriften, Band 12, a.a.O., S. 85.
[12] Vgl. Max Horkheimer, Nachwort der Herausgeber Alfred Schmidt und Gunzelin Schmid-Noerr, in: Gesammelte Schriften, Band 5, Frankfurt a. M. 1987, S. 439.
[13] Max Horkheimer, Zur Rechtsphilosophie, in: Gesammelte Schriften, Band 12, a.a.O., S. 262.
[14] Horkheimer/Adorno, Dialektik der Aufklärung, a.a.O., S. 182.
[15] Max Horkheimer, Vernunft und Selbsterhaltung, in: Gesammelte Schriften, Band 5, a.a.O., S. 334.
[16] Michael Th. Greven, Zur Kontinuität der „Racket-Theorie“, in: ders., Kritische Theorie und historische Politik, Opladen 1994, S. 161.
[17] Etwa in jener von Michael Hartmann, Soziale Ungleichheit – Kein Thema für die Eliten? Frankfurt a. M. 2013.
[18] Theodor W. Adorno, Das Bewusstsein der Wissenssoziologie, in: ders., Gesellschaftstheorie und Kulturkritik, Frankfurt a. M. 1975, S. 138.
[19] Otto Kirchheimer, Zur Frage der Souveränität, in: ders., Politik und Verfassung; Frankfurt a. M. 1964, S. 80.
[20] Max Horkheimer, Nachgelassene Schriften 1949-1972, in: Gesammelte Schriften, Band 14, Frankfurt a. M. 1988, S. 359.
[21] Ebd., S. 316.
[22] Max Horkheimer, Die Rackets und der Geist, in: Gesammelte Schriften, Band 12, a.a.O., S. 289.
[23] Theodor W. Adorno, Reflexionen zur Klassentheorie, in: ders., Gesellschaftstheorie und Kulturkritik, Frankfurt a. M. 1975, S. 12.
[24] Max Horkheimer, Zur Soziologie der Klassenverhältnisse, in: Gesammelte Schriften, Band 12, a.a.O., S. 103.
[25] Ders., Die Rackets und der Geist, a.a.O., S. 291.
[26] Vgl. Nicos Poulantzas, Staatstheorie, Berlin 1978.
[27] Kees van der Pijl, Transnational Classes and International Relations, London 1998.
[28] Vgl. Markus Dietz, Korruption: Eine institutionenökonomische Analyse, Berlin 1998.
[29] Vgl. die Beiträge in: James M. Buchanan, Robert D. Tollison und Gordon Tullock (Hg.), Toward a Theory of the Rent-Seeking-Society, Houston/Texas 1980.
[30] Rupert F.J. Pritzl, Korruption, Rent Seeking und organisiertes Verbrechen in Russland – eine institutionenökonomische Analyse, in: „Politekonom“, 1/1997.
[31] Susan Rose-Ackerman, Corruption and Government. Causes, Consequences and Reform, Cambridge 1999, S. 38.
[32] Vgl. dazu bspw. Seymour Martin Lipset und Rokkan Stein, Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments, in: Peter Mair (Hg.), The West European Party System, Oxford 1990, S. 91-208.
[33] Jean Cartier-Bresson, Ursachen und Folgen der Korruption, Wirtschaftliche Analysen und Erkenntnisse, in: OECD (Hg.), No longer Business as usual: Im Kampf gegen Bestechung und Korruption, Köln 2001, S. 26.
[34] Auch das Problem sozialer Devianz wurde dabei in den Blick genommen. Vgl. Donatella Della Porta und Alberto Vannucci, Corrupt Exchanges: Actors, Resources and Mechanisms of Political Corruption, New York 1999.
[35] Als interessante Ausnahme ist hervorzuheben: Colin Hay, The tangled webs we weave: the discourse, strategy and practise of networking, in: David Marsh (Hg.), Comparing Policy Networks, Buckingham/Philadelphia 1998.
[36] Theodor W. Adorno, Reflexionen zur Klassentheorie, a.a.O., S. 23.