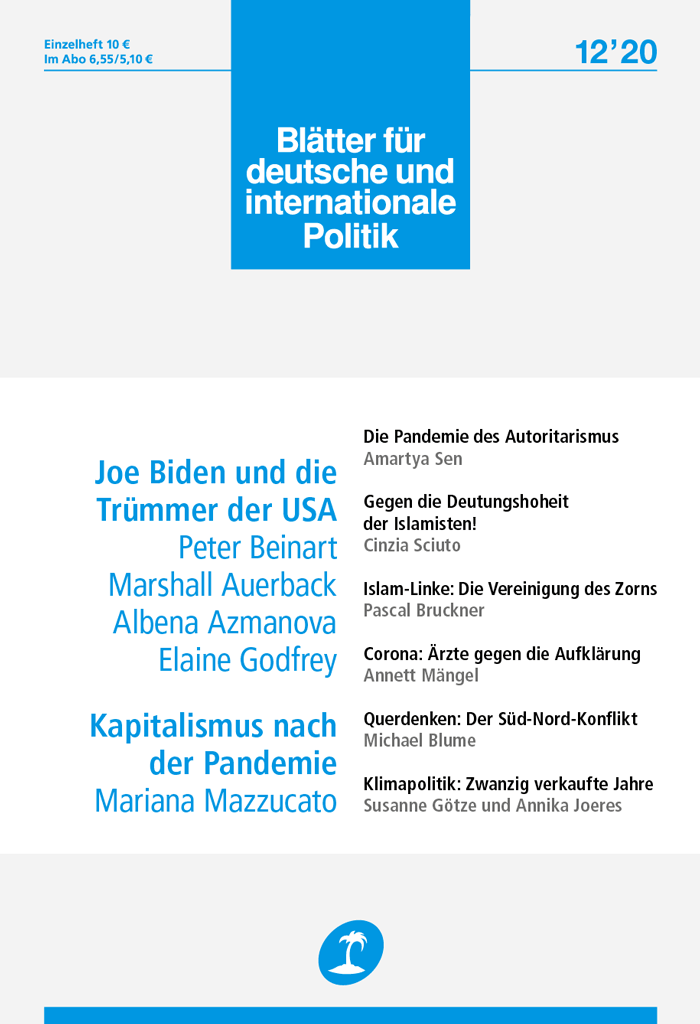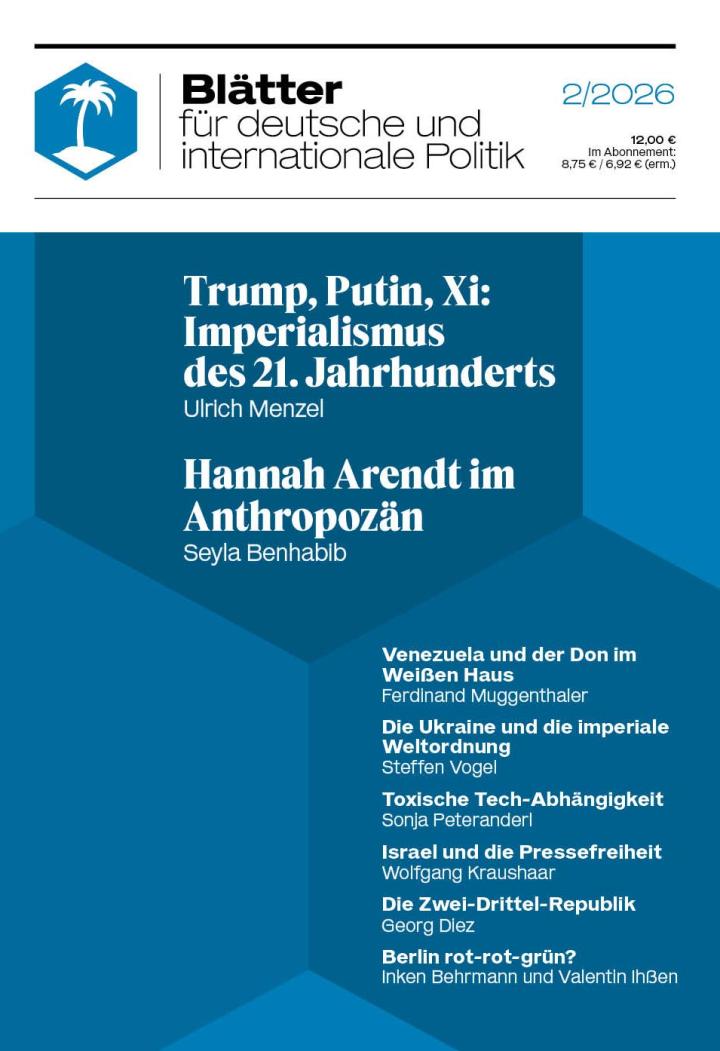Bild: imago images / ZUMA Wire
Schon im Vorfeld des 3. November war klar, dass diese US-Wahl keine Wahl wie viele andere sein würde.[1] Doch die Ereignisse der Wahlnacht selbst wie auch der folgenden Tage haben sie endgültig zu einem existenziellen Vorgang für die Vereinigten Staaten, aber auch für die gesamte demokratische Welt gemacht. Diese Wahl wurde zu einem Exempel für die Angreifbarkeit und Verletzlichkeit der Demokratie.
Seit den ersten Hochrechnungen am Wahlabend durchläuft die demokratische Welt drei Phasen: erstens die Phase des Schocks, zweitens die Phase der Erleichterung, manche sprechen gar von einer Erlösung – und drittens, und zwar mehr und mehr, eine Phase der Ernüchterung, im besten Falle der Versachlichung, im schlimmsten aber einer neuerlichen, vielleicht noch gefährlicheren Polarisierung.
Der eigentliche Schock ereignete sich am Wahlabend um 19 Uhr 59 Washingtoner Ortszeit, als Noch-Präsident Donald Trump ankündigte, dass er den Ausgang der Wahl nicht anerkennen werde: „Dies ist ein Betrug an der amerikanischen Öffentlichkeit. Dies ist eine Peinlichkeit für das Land. Wir waren auf dem Weg, diese Wahl zu gewinnen, und offen gesagt: Wir haben diese Wahl gewonnen“, so Trump im O-Ton. „Das ist ein sehr großer Moment. [...] Wir wollen, dass das Gesetz in der richtigen Weise angewendet wird. Wir werden vor den Supreme Court ziehen. Wir wollen, dass alles Wählen endet.“ Das war in der Tat ein großer, genauer: ein historischer Moment. Denn damit machte Trump unmissverständlich klar, dass er nach vier Jahren der Bekämpfung der US-amerikanischen Institutionen auch den letzten Schritt zu gehen bereit ist, nämlich den der Missachtung, ja der völligen Negierung der Wahl und ihres Ergebnisses als des heiligsten Akts der Demokratie.
Gewiss kann man sagen, Trump habe diese Strategie – nämlich die Verwerfung der Briefwahlstimmen – im Vorfeld bereits angekündigt.[2] Doch die Androhung ist das eine, die tatsächliche Durchführung aber macht die Ankündigung zu einem ungeheuerlichen Vorgang, zumal in den USA als der wichtigsten, da mächtigsten Demokratie der Welt. Es ist daher aus demokratischer Perspektive nicht übertrieben, von einem Blick in den Abgrund zu sprechen.
Darin aber steckte zugleich auch ein zutiefst aufklärerisches Moment. Obwohl Trump sich stets als Volkstribun, als der einzig wahre Vertreter des Volkes geriert – gegen den angeblichen deep state des Establishments –, hat er am Ende seiner Amtszeit dem amerikanischen Volk seine ganze Verachtung demonstriert, übrigens auch allen republikanischen Briefwählern, deren Stimmen er gleichfalls für null und nichtig erklärte. Die Behauptung der Populisten, sie allein handelten im Namen des Volkes wurde radikal konterkariert, genau wie der wohl bekannteste Ausspruch der US-Demokratie, aus Abraham Lincolns historischer Rede in Gettysburg: Demokratie ist die „Regierung des Volkes durch das Volk für das Volk“. Mit seiner Aussage am Wahlabend hat Trump endgültig bewiesen, dass es ihm nie um eine Regierung durch und für das Volk ging, sondern allein um die Herrschaft seines Clans. In diesem Augenblick kehrten sich Trumps Worte gegen ihn selbst. Er selbst agierte als deep state – als tiefer Staat gegen das Volk. Getreu der Devise, nicht „the winner“, sondern „The looser takes it all“, als ein Tyrann der Minderheit. Es war die finale Selbstdemaskierung, ein Putsch von oben gegen die Demokratie – ein Schockmoment für die USA, aber auch darüber hinaus, als ein Moment von globaler Ausstrahlung. Denn in diesem Augenblick wurde klar, wie ungemein fragil der Vorgang der demokratischen Wahl ist und wie schnell – selbst in einer über Jahrhunderte gewachsenen Demokratie wie der der Vereinigten Staaten – der pure Kampf um die Macht bewährte Verfahren beinahe außer Kraft setzen kann. Insofern muss man Donald Trump fast dankbar sein – dafür, dass er auch noch diesen letzten, radikalsten Schritt seiner Regierungszeit gegangen ist. Trump hat demonstriert, wie schnell eine Demokratie den liberalen, rechtsstaatlichen Pfad verlassen kann. Zugleich hat er aller Welt gezeigt, was unter „illiberaler Demokratie“ zu verstehen ist, von der sein Bruder im Geiste Viktor Orbán spricht – nämlich faktisch die Abschaffung der Demokratie. Deshalb war schon der Wahlabend, ohne dass überhaupt ein Ergebnis vorgelegen hätte, von immenser globaler Bedeutung.
Trump hat die US-Demokratie damit ihrer maximalen Belastungsprobe ausgesetzt – wenn man von einer möglichen militärischen Steigerung absieht. Doch wie um diesen Schritt auch noch zu vollziehen, ging der Nächste in der Clan-Riege, Trumps ältester Sohn Donald jr., in den folgenden dramatischen Stunden noch über seinen Vater hinaus und sprach, in Übernahme der Worte aus Goebbels Sportpalastrede, vom „totalen Krieg“, den es nun auszufechten gelte. „Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen“, hatte Goebbels in einem Aufsatz im Jahr 1928 das strategische Ziel der NSDAP ausgegeben. „Uns ist jedes gesetzliche Mittel recht, den Zustand von heute zu revolutionieren.“[3] Ohne auch nur in irgendeiner Weise die besondere Dimension des Nationalsozialismus relativieren zu wollen, wird man darin die zentrale Strategie zur Machterlangung jedes modernen Autokraten sehen müssen: die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln zu untergraben, um sich ihrer zu entledigen – und sich wenn nötig, wie das Beispiel der beiden Trumps jetzt lehrt, mit allen antidemokratischen Mitteln an der Macht zu halten.
Vom Schock zur Erleichterung
Trump hat sich am 3. November als ein potentieller Diktator selbst entlarvt, der willens und auf dem Wege war, den Populismus zur Diktatur auszubauen. In diesem Augenblick des Wahlabends ist damit klargeworden, dass es diesmal nicht mehr nur – wie in normalen demokratischen Wahlen – um den Machtwechsel ging, sondern zugleich auch um die fundamentale Verteidigung der Demokratie.
Hier aber setzt die zweite Phase ein, die Phase zunehmender Erleichterung, die fast zu einer Erlösung wurde, als am Tag vier nach der Wahl Joe Biden endlich als president elect bestätigt wurde. Während die im Vorfeld befürchteten und von Trump provozierten militanten Aufstände ausblieben, funktionierten die demokratischen Verfahren. Damit war klar, dass die USA diesmal noch scharf an der Katastrophe vorbeigeschrammt sind.
Joe Biden gebührt ein doppelter Dank; erstens dafür, dass er in dieser hochangespannten Situation an den demokratischen Regeln und Gepflogenheiten strikt festgehalten hat. Indem die Demokraten insgesamt der Versuchung widerstanden, selbst in das Rennen um die schnellstmögliche Ausrufung des Wahlsiegers einzusteigen, haben sie ihrem Namen als Demokraten Ehre gemacht und zugleich bewiesen, dass es neben den Trumpisten weiterhin ein starkes anderes Amerika gibt.
Zweitens gebührt Biden große Anerkennung dafür, dass es ihm gelungen ist, Trump überhaupt zu schlagen. Zur Erinnerung: Das letzte Mal, dass ein Präsident nach nur einer Amtszeit aus dem Weißen Haus vertrieben wurde, war 1992, als Bill Clinton George Bush senior besiegte. Und ein Zweites kommt hinzu: Trump konnte 72 Millionen Stimmen erringen – mehr als Barack Obama, als er 2008 auf einer Welle der Begeisterung in seine erste Amtszeit segelte, und mehr als je ein Republikaner vor ihm gewann. Am Ende erhielt Trump neun Millionen Wählerstimmen mehr als noch im Jahr 2016. Dass Biden diese enorme Zahl noch um sechs Millionen übertraf und mit 78 Millionen Stimmen das beste je erreichte Ergebnis erzielte, macht seinen Sieg bereits zu einem historischen.
Zugleich zeigt es aber auch, wie ungemein schwer es auch diesmal war, den großen Volksverhetzer und -verführer zu schlagen. Ohne Corona, so die Ironie der Geschichte, hätte Trump die Wahl mit großer Wahrscheinlichkeit gewonnen – wobei unklar ist, was ihm am Ende mehr geschadet hat: die Pandemie selbst oder sein totales Versagen bei ihrer Bekämpfung.
Inzwischen steht fest, dass Biden 306 Wahlleute gewinnen konnte – genauso viele wie Trump vor vier Jahren und deutlich mehr als die erforderlichen 270. Und dennoch wurde das zweite große Ziel der Demokraten, die Mehrheit im Senat zu erringen, aller Wahrscheinlichkeit nach verfehlt. All jene, die behaupten, dass Joe Biden ein schwacher, da wenig kämpferischer Kandidat gewesen sei, mögen in dieser Hinsicht Recht haben – und reden doch am Kern der Sache vorbei. Ja, Biden war offensichtlich nicht der richtige Mann, um klar, also mit dem erhofften und prognostizierten Erdrutschsieg auch den Senat zu gewinnen – aber er war offensichtlich der Richtige, um überhaupt gegen Trump zu gewinnen. Ob ein anderer der Kandidaten geeigneter gewesen wäre, ist rein hypothetisch und gehört in den Bereich der Legendenbildung. Biden jedenfalls gelang es, die „blue wall“ in Michigan, Wisconsin und Pennsylvania wieder zu errichten, indem er etliche der „alten weißen Arbeiter“ im Rustbelt zurückeroberte, die Clinton an Trump verloren hatte. Für seinen Sieg brauchte es aber auch das Bündnis zwischen Moderaten und Progressiven in der demokratischen Partei, mit „Trump muss weg“ als verbindendem Leitmotiv. Daran hatte es vier Jahre zuvor, im Wahlkampf von Hillary Clinton, noch gemangelt, als viele der Linken gar nicht erst zur Wahl gingen.
Was wäre gewesen, wenn?
Insofern entpuppte sich „Sleepy Joe“ (Trump über Biden) als der richtige Mann zur richtigen Zeit, um Trump zu schlagen. Und genau darauf kam es in dieser historischen Situation in erster Linie an. An diesem Punkt ist es ausgesprochen sinnvoll, einmal das Kontrafaktische zu denken: Was wäre gewesen, wenn Trump diese Wahl doch noch gewonnen hätte?
Die Folgen wären in ihren Dimensionen kaum abschätzbar. Fest steht, der antidemokratische Schub wäre verheerend gewesen. Sämtliche Populisten, von Jair Bolsonaro bis Viktor Orbán, aber auch die querdenkenden Verschwörungsideologen von QAnon hätten diesen Sieg ihrer globalen Galionsfigur als absolute Bestätigung des eigenen Weges begriffen. Alles spricht dafür, dass die Rechtspopulisten in Europa und Deutschland dem erwiesenen Demokratieverächter frenetisch gehuldigt hätten – während die Demokraten in den USA, aber auch im Rest der Welt, die eigene Niederlage erneut, wie schon vor vier Jahren, anerkannt hätten, eben als gute Demokraten.
Auch die trumpnahen Medien wären im Falle eines Trump-Sieges gewiss nicht von ihrem Triumphator abgefallen – ganz zu schweigen von seiner inzwischen freiwillig gleichgeschalteten republikanischen Partei. Nein, es brauchte offenbar die totale Niederlage, es brauchte Trumps Scheitern, um endlich die ersten, zaghaften Absetzbewegungen einzelner Republikaner in die Wege zu leiten.
Die Zeit der Ernüchterung
Mit dem Ausgang der Wahl ist nun beileibe nicht alles gut, aber das Schlimmste wurde gerade noch einmal abgewendet. Das macht den Moment der Erleichterung aus. Von Erlösung kann deswegen allerdings keine Rede sein. Denn der kommenden Regierung Biden sind – zum gegenwärtigen Zeitpunkt – enge Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit gesetzt. Deshalb hat längst die Phase der Ernüchterung begonnen.
Mit der Wahl Joe Bidens wird sich zweifellos einiges ändern, in nationaler wie internationaler Hinsicht. Er selbst hat mehrfach angekündigt, etwa in einem Grundsatzartikel in der „Foreign Affairs“,[4] dass er mit dem Tag seiner Vereidigung am 20. Januar dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten wird; das gleiche gilt für die WHO. Und auch das von Trump aufgekündigte Nuklearabkommen mit dem Iran wird Biden, der es einst als Vizepräsident unter Obama mitverhandelte, wieder zu beleben versuchen. Zudem besteht die Hoffnung, dass seine Regierung die Rüstungskontrollgespräche mit Russland wieder aufnimmt, da mit New START das letzte Abkommen zur Verringerung der strategischen Nuklearwaffen im Februar 2021 ausläuft.
In der Frage der internationalen Sicherheit muss man der Trump-Regierung immerhin eines zugutehalten: Anders als die Vorgängerregierungen, insbesondere die Regierung von Bush junior, hat sie keine Kriege vom Zaun gebrochen. Allerdings hat Trump einiges dafür getan, dass Andere umso vernichtender in jenen Regionen agieren konnten, in denen seine Regierung durch den schlagartigen Rückzug der US-Truppen ein Vakuum hinterlassen hat, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten. Biden dürfte hier weit stärker versuchen, durch diplomatischen und ökonomischen Druck den Einfluss der USA wieder zu erhöhen.
Die zentrale außenpolitische Herausforderung seiner Amtszeit wird jedoch zweifellos auf der immer stärker aufziehenden Auseinandersetzung mit China liegen, dessen Präsident Xi Jinping mit Blick auf den 20. Parteitag im Jahr 2022 bereits jetzt fast maximale Macht reklamiert, nach innen wie außen. Da der asiatisch-pazifische Raum mit dem Zustandekommen des jüngsten Abkommens soeben zur größten Freihandelszone der Welt geworden ist, bleibt diese Region wie schon unter Obama der eigentliche geostrategische Hotspot der USA.
Speziell die Europäer sollten sich daher nicht der Illusion hingeben, dass der alte transatlantische Westen jemals wieder die enorme Bedeutung erlangen wird, die er vor 1989 und eigentlich noch bis 9/11 hatte. Stattdessen wird auch Joe Biden die Europäische Union und ganz besonders Deutschland weit stärker als früher in die Pflicht nehmen, insbesondere was die geforderten zwei Prozent des Bruttosozialprodukts für die Nato-Finanzierung anbelangt.
Der „gespaltene Westen“ (Jürgen Habermas) bleibt also weiter die Realität – allerdings verläuft der Riss heute nicht mehr primär, wie noch unter Trump, zwischen den Kontinenten, sondern er geht quer durch diese hindurch, speziell durch Europa, mit Orbán und Kaczyński auf der einen, Macron und Merkel auf der anderen Seite, aber auch durch die tief gespaltenen USA. Das zeigt: Die Welt ist mit dem Trumpismus noch lange nicht fertig – und auch nicht mit Donald Trump. Im Gegenteil: Die gesamte Amtszeit von Joe Biden wird vor allem innenpolitisch im Schatten seines Vorgängers stehen, was gewaltige außenpolitische Folgen impliziert.
Ein Übergangspräsident im Schatten Trumps
Schon vor der Wahl hat sich Biden selbst als einen „Übergangskandidaten“ bezeichnet. Mit seiner Wahl steht fest, dass er ein bloßer Übergangspräsident ist, der maximal vier Jahre amtieren wird. Das aber wird das gesamte Agieren der Regierung wie auch der demokratischen Partei auf ein Datum fokussieren – das Jahr 2024 und die Verteidigung der Präsidentschaft, dann möglicherweise unter einer Kandidatin oder auch einer Präsidentin Kamala Harris, wenn Biden das Amt bereits früher, etwa nach den midterm elections 2022, an seine Vizepräsidentin übergeben sollte. Auch wenn Biden dergleichen natürlich dementiert, spricht angesichts seiner angeschlagenen Gesundheit einiges dafür.
Unabhängig vom zukünftigen Kandidaten steht eines heute bereits fest: Wohl noch nie galt so sehr die Devise „Nach der Wahl ist vor der Wahl“. Denn nach Trump kann durchaus vor Trump sein. Und die Erfahrung mit dem vielleicht klügsten Strategen der neuen Rechten, mit Viktor Orbán, lehrt: „They ever come back.“ Bidens Präsidentschaft steht deshalb schon heute im Banne des Jahres 2024.
Trump ventiliert zweifellos längst seine mögliche Rückkehr als Kandidat, um die Schmach der Niederlage ungeschehen zu machen. Zugleich arbeitet er an seiner Dolchstoß-Legende: „An den Wahlurnen unbesiegt“, lautet die Devise, hinterrücks gemeuchelt durch gefälschte Briefwahlstimmen. Und Millionen seiner Wählerinnen und Wähler sind zutiefst gewillt, ihm das zu glauben – und jeden als Verräter zu begreifen, der Zweifel an dieser Verschwörung schürt, gerade auch seitens der Republikaner. Das macht Trump auch in der ehemaligen Grand Old Party bis auf Weiteres zu einer ungemein gefährlichen Größe. Zumal dann, wenn er noch andere Überlegungen wahrmacht und einen eigenen Fernsehsender gründet. Abermillionen von Zuschauern wären ihm gewiss.
Schon gar nicht erledigt ist auch der Trumpismus. Im Gegenteil: Ob mit oder ohne Trump wird er weiter eine eminente Rolle in der nationalen Politik spielen. Viele Trumps sitzen bereits in den Startlöchern. Und aus der US-amerikanischen Geschichte der letzten Jahrzehnte wissen wir: Schlimmer geht immer. Das zeigt die Trias: Reagan, Bush junior, Trump.[5] Insofern wäre es naiv zu glauben, dass es nicht auch zu Donald Trump noch eine Steigerung geben könnte. Zumal die Populisten, die zukünftig noch kommen werden, Trumps erfolgreiche mediale Methoden als Blaupause für den nächsten Wahlgang nützen können.
Der Sieg gegen Trump hat insofern den USA, aber auch der gesamten demokratischen Welt bloß eine Atempause im Kampf gegen die populistische Versuchung verschafft. Doch die Gefahr existiert weiter – und sie ist keineswegs geschwächt, im Gegenteil. Ob Corona oder, noch weit dramatischer, die Klimakrise: Die liberale Demokratie ist in diesem entscheidenden Jahrzehnt derart gewaltigen Herausforderungen ausgesetzt, dass die Versuchung weiter zunehmen wird, sich von ihren zähen parlamentarischen Fesseln zu befreien, um autoritär-diktatorisch durchzuregieren. Diese existenzielle Spannung trifft wohl auf wenige Länder so zu wie auf die Vereinigten Staaten nach Trump – ein zutiefst gespaltenes, in sich verfeindetes Land, von der Pandemie geschlagen und einer immensen Wirtschaftskrise ausgesetzt. Nichts spricht daher wirklich dafür, dass der von Biden propagierte „Anfang vom Ende der düsteren Ära der Dämonisierung in Amerika“ mit dieser Wahl gekommen ist.
Bis auf Weiteres »America first«
„America first“ wird somit – wenn auch in anderer Weise als zuvor – die zentrale Devise der Regierung Biden sein. Mit Blick auf 2024 und den Kampf gegen den nächsten Rechtspopulisten wird ihr ganzes Handeln den rein nationalen Interessen untergeordnet sein. Und angesichts des Schocks des 3. November wird Biden alles daran setzen, das heillos zerrissene Land trotz eines wohl weiter hetzenden Donald Trump nicht weiter zu spalten, sondern – so gut es eben geht – zu versöhnen.
Dieses Leitmotiv wird umso mehr gelten, da der kommenden Regierung eine enorme Hypothek ins Haus steht: nämlich blockierte Machtverhältnisse durch einen Senat, der aller Voraussicht nach in republikanischer Hand bleibt. Damit haben die Republikaner, an der Spitze der mächtige Mehrheitsführer Mitch McConnell, die Möglichkeit, sämtliche Gesetzesvorhaben der Regierung zu blockieren und zudem gleich zu Beginn ihnen nicht genehme Regierungsmitglieder durchfallen zu lassen. Auch deshalb zielt Biden auf ein überparteiliches Team, auch unter Einbindung moderater Republikaner, während linke Demokraten wie Bernie Sanders und Elisabeth Warren, die als Arbeitsminister bzw. Finanzministerin im Gespräch sind, wohl keinerlei Chance haben, von einem republikanisch dominierten Senat akzeptiert zu werden. Sieht man daher einmal davon ab, dass Trumps Niederlage am 3. November ein Sieg für alle Demokraten ist und bleibt, sind die Verlierer auf demokratischer Seite ebenfalls klar: Es sind die progressiven Demokraten der „Squad“, die linken Abgeordneten um Alexandria Ocasio-Cortez – und damit zugleich alle, die auf grundsätzliche Veränderungen drängen. Denn während es dem Partei-Establishment der Demokraten durchaus in die Hände spielt, den ihnen genehmen kompromisslerischen Kurs als von den Republikanern erzwungen verkaufen zu können, wären die Chancen für die dringend erforderlichen fundamentalen Reformen – von einer umfassenden Krankenversicherung bis zum Green New Deal – mit der Blockade des Senats zerstört.
Das entscheidende Datum ist daher vorerst der 5. Januar – mit den beiden Stichwahlen in Georgia um die beiden letzten vakanten Senatsposten. Dann wird sich klären, ob es den Demokraten vielleicht doch noch gelingt, die beiden zusätzlichen Sitze zu ergattern, die ihnen das 50-zu-50-Patt sichern würden – so dass Kamala Harris als Vizepräsidentin mit ihrer Extrastimme zum Zünglein an der Waage würde. Damit wäre die Regierung Biden nicht auf Kompromisse mit den Republikanern angewiesen, um deren Blockadepolitik zu umgehen, sondern könnte weitergehende Reformen durchsetzen.
Momentan spricht wenig dafür. Umso mehr bleibt es dabei: Am 3. November hat die demokratische Welt in einen Abgrund geschaut; doch das wird nicht der letzte Abgrund dieser Art gewesen sein. Die demokratische Welt tut daher gut daran, alles zu unternehmen, um auf den nächsten Angriff auf ihre Fundamente besser vorbereitet zu sein.
[1] Albrecht von Lucke, Die Schicksalswahl oder: Trumps Kampf gegen das Recht, in: „Blätter“, 11/2020, S. 5-9.
[2] Claus Leggewie, Die Wahl als Farce: Donald Trump und der Aufstieg der Autokraten, in: „Blätter“, 11/2020, S. 10-12.
[3] Joseph Goebbels, Was wollen wir im Reichstag?, in: „Der Angriff“, 30.4.1928; Nachdruck in: Joseph Goebbels, Der Angriff, Aufsätze aus der Kampfzeit, München 1935, S. 71.
[4] Joseph R. Biden, Why America must lead again, in: „Foreign Affairs”, März/April 2020, www.foreignaffairs.com.
[5] Wobei die Regierung von Bush junior mit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Irak und seinen verheerenden Folgen unter globalpolitischen Vorzeichen weit dramatischere Auswirkungen hatte.