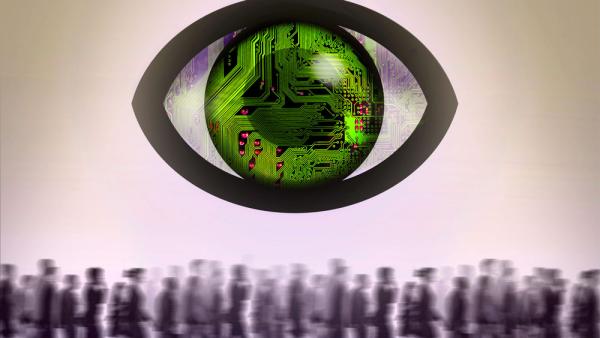Bild: Der Vorsitzende Richter Thomas Sagebiel vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main, am Tag der Urteilsverkündung im Prozess gegen zwei Männer, die die Bundesanwaltschaft im Zusammenhang mit dem Tod des Politikers Walter Lübcke angeklagt hat. (IMAGO / Jan Huebner)
Der Prozess ist beendet, die Aufklärung ist es nicht: Nach 45 Verhandlungstagen verkündete das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main am 28. Januar das Urteil im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der geständige Hauptangeklagte, der Neonazi Stephan Ernst, wurde zu lebenslanger Haft mit anschließend drohender Sicherungsverwahrung verurteilt. Der als Mordhelfer angeklagte Markus H., auch er seit Jugendtagen ein militanter Rechtsextremer, kam mit einer Bewährungsstrafe wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz davon. Vom Vorwurf der Beihilfe wurde Markus H. ebenso freigesprochen wie Ernst von einem zweiten Tatvorwurf, dem rassistischen Mordversuch an dem irakischen Geflüchteten Ahmed I., der bereits 2016 auf offener Straße niedergestochen und schwer verletzt worden war.
Es ist ein Urteil, das man getrost mutlos nennen darf. Der Staatsschutzsenat ging mit den Freisprüchen, beide begründet mit dem Zweifelsgrundsatz „in dubio pro reo“, den Weg des geringsten Widerstands. Die Vermutung liegt nahe, dass die Entscheidung damit vor allem revisionsfest gemacht werden sollte: Der Bundesgerichtshof müsste jetzt befinden, dass die Frankfurter Kolleg*innen ihre Zweifel an der Schuld der Angeklagten hätten überwinden müssen. Das ist eine sehr hohe Hürde, höher wohl, als sie es im umgekehrten Fall einer Verurteilung gewesen wäre.
Gewiss, die Beweislage war schwierig, und zwar sowohl für die Mordbeihilfe durch Markus H. als auch für die Täterschaft von Stephan Ernst beim Angriff auf den jungen Iraker; die Freisprüche lassen sich begründen. Aber man hätte, mit nicht minder guten Gründen, auch zu einem anderen Ergebnis kommen können. Die Bundesanwaltschaft hatte das in ihrem Plädoyer getan und nach einer sehr ausführlichen Beweiswürdigung beide strittigen Anklagepunkte für erwiesen gehalten. Für Stephan Ernst hätte der zusätzliche Schuldspruch nicht allzu gravierende Auswirkungen gehabt. Für Markus H. aber wäre der Unterschied gewaltig gewesen: Neun Jahre und acht Monate Gefängnis hatte die Anklagebehörde für ihn gefordert. Stattdessen verließ der Neonazi das Gericht als freier Mann.
Doch nicht nur deshalb lagen Welten zwischen dem Schlussvortrag, den Oberstaatsanwalt Dieter Killmer kurz vor Weihnachten gehalten hatte, und dem Urteil des Gerichts. Killmer hatte den Mord am CDU-Politiker historisch, politisch und gesellschaftlich eingeordnet. Hatte einen Bogen geschlagen vom Mord an Walther Rathenau, Außenminister der Weimarer Republik, über das Attentat auf Rudi Dutschke bis zur rechtsterroristischen Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU). Hatte verwiesen auf das rechtsextreme Konzept „des führerlosen Widerstands“, dem auch Ernst gefolgt sei, als er am 1. Juni 2019 nach Wolfhagen-Istha gefahren sei und den Kasseler Regierungspräsidenten auf der Terrasse von dessen Haus erschossen habe. Und er hatte die Unterstützung von Gleichgesinnten hervorgehoben, „online wie offline“, die Lübcke wegen seiner liberalen Haltung in der Flüchtlingspolitik mit Hass und Hetze überzogen hatten.
In der mündlichen Urteilsbegründung des Gerichts, formuliert in dürren Worten und vom Blatt abgelesen wie eine leidige Pflichtübung, kam von alldem rein gar nichts vor. Stattdessen betonte der Senatsvorsitzende Thomas Sagebiel, es sei nicht die Aufgabe des Gerichts gewesen, nach rechtsextremen Netzwerken zu suchen: „Nur wenn das Einfluss auf die Tat gehabt hätte, wäre es festzustellen gewesen.“ In dieser Abwehrhaltung spiegelte sich klarer, was in den gut sieben Monaten zuvor im Saal 165 C des Frankfurter Oberlandesgerichts passiert – oder eben: nicht passiert – war, als in den klugen und ungewöhnlich weitreichenden Gedanken der Bundesanwaltschaft.
Vieles blieb unterbelichtet
Trägt Markus H., der Lübcke durch das böswillig verkürzte Video einer Bürgerversammlung zur Geflüchtetenunterbringung im Oktober 2015 zum Feindbild von Rechten im ganzen Land werden ließ, der mit seinem langjährigen Freund und Neonazi-Kameraden Stephan Ernst die Wut auf den Regierungspräsidenten teilte, der mit ihm das Schießen übte und ihn zu Hetzkundgebungen der AfD begleitete, trägt dieser Mann wirklich keine Mitschuld am Mord? Oder war er, wie Ernst behauptet und wie auch die Angehörigen Lübckes überzeugt sind, vielleicht sogar unmittelbar an der Tat beteiligt?
Bemerkenswert wenige Erkenntnisse hat der Prozess über Markus H. erbracht. Dass er sich als überzeugter Neonazi eine Originaldose des Schoah-Giftgases Zyklon B auf den Schreibtisch gestellt hat, als Stiftehalter, so etwas erfuhr man. Viel mehr aber nicht. Das lag nicht nur daran, dass Markus H., anders als Ernst, klug genug war zu schweigen. Sondern vor allem daran, dass sich das Gericht für das Umfeld der beiden Angeklagten in Vergangenheit und Gegenwart kaum interessierte. Auch wenn es tatsächlich kein rechtsextremes Netzwerk mit weiteren Tatbeteiligten oder Eingeweihten hinter dem Mord an Lübcke gegeben haben mag, auch wenn Stephan Ernst und Markus H. sich schon länger aus der ersten Reihe des regionalen Rechtsextremismus zurückgezogen haben: Dass in dem Verfahren die Szene in Kassel und Umgebung nicht genauer ausgeleuchtet wurde, ist ein großes Versäumnis.
Bis zum Aufstieg der AfD gaben hier fast durchweg nicht Rechtsaußenparteien, sondern militant neonazistische Kameradschaften den Ton an. Das als „Anti-Antifa-Arbeit“ deklarierte Sammeln von Informationen über politische Gegner*innen war dabei über Jahre und Jahrzehnte hinweg ebenso eine Konstante wie die Bereitschaft, dem Ausspähen Gewalt folgen zu lassen. Erinnert sei an den bis heute unaufgeklärten Anschlag auf einen antifaschistisch engagierten Lehrer, den 2003 eine Pistolenkugel bloß um Haaresbreite verfehlte. An den Kasseler NSU-Mord an Halit Yozgat drei Jahre später, bei dem kaum vorstellbar ist, dass er ohne Unterstützung aus der örtlichen Szene begangen werden konnte. Oder an den brutalen Überfall auf ein linkes Zeltlager im Sommer 2008, bei dem eine 13jährige krankenhausreif geprügelt wurde. Stephan Ernst und Markus H. haben diese Szene mitgeprägt und sind von ihr geprägt worden. Und das soll egal sein, wenn es um den Mord an einem erst zum „Volksverräter“ gestempelten und dann jahrelang ausgespähten Politiker geht?
Ernsts Anwälte bemühten sich nach Kräften, ihren Mandanten zum auskunftsbereiten Aussteiger zu stilisieren. In seinem Plädoyer verstieg sich Verteidiger Mustafa Kaplan gar zu der Behauptung, wie der Lübcke-Attentäter im Prozess über die rechtsextreme Szene in Nordhessen ausgepackt habe, das sei „ungewöhnlich und in dieser Hinsicht wohl einmalig“. Tatsächlich aber spielte Ernst, wenn er Auskunft gab, seine eigene Rolle nach Kräften herunter, und er mauerte ausgerechnet immer dann, wenn es spannend wurde.
Keine Erinnerung an nichts und niemanden
Was er über den Mordanschlag auf den Lehrer wisse? „Nichts“, sagte Ernst. Warum er im selben Jahr mit einem Kameraden versucht haben soll, in einen Steinbruch einzubrechen, wo Sprengstoff gelagert wurde? „Da war gar nichts. Wir haben da mal vor dem Tor gestanden.“ Mit wem er ebenfalls in den Nullerjahren die Kasseler jüdische Gemeinde ausspioniert und rund 60 Anti-Antifa-Dossiers über politische Gegner*innen angelegt habe? Das wolle er nicht sagen, denn die Kameraden von damals übten jetzt „normale Berufe“ aus. Das Gericht hakte nicht weiter nach. Als einziger Zeuge, der etwas über die Szene-Einbindung der beiden Angeklagten hätte sagen können, wurde ihr gemeinsamer Bekannter Alexander S. vernommen, auch er ein langjähriger rechtsextremer Aktivist. Und der kam damit durch, sich partout an kaum etwas erinnern zu können.
Immerhin: Dass es am gemeinsamen Arbeitsplatz von Stephan Ernst und Markus H. noch einige Kollegen mehr gab, denen es offenbar völlig normal erschien, wenn gegen Geflüchtete gehetzt wurde, und die sich, in zwei Fällen, von Ernst sogar scharfe Schusswaffen verkaufen ließen, so weit wurde ermittelt. Doch als diese Kollegen von einer Art Betriebsausflug zur Kundgebung des Kasseler Pegida-Ablegers berichteten und davon, dass Ernst die Verantwortlichen der rassistischen Initiative zu kennen schien, folgte daraus: nichts. Dabei war die Information durchaus brisant, war doch jene von beiden Angeklagten besuchte und von Markus H. gefilmte Bürgerversammlung in Lohfelden bei Kassel, mit der alles seinen Anfang nahm, von Pegida-Aktivist*innen gezielt gestört worden.
„Psychische Beihilfe“ hatte die Bundesanwaltschaft Markus H. zur Last gelegt; er habe seinem Freund Ernst, ohne in den konkreten Tatplan eingeweiht zu sein, „Zuspruch und Sicherheit“ vermittelt. Das kann gut sein. Aber warum wurde dann nicht auch anderswo genauer hingeschaut? Gelohnt hätte sich das womöglich bei den zwei Schützenclubs, in denen die beiden Rechtsextremen das Schießen trainierten.
In dem einen Verein wurde sich, wie ein Vorstandsmitglied in einer ZDF-Dokumentation freimütig erklärte, kollektiv „aufgeregt“ über die liberale Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel – eine Politik, die vor Ort untrennbar verbunden war mit dem Namen Walter Lübcke. Im anderen Verein sah man darüber hinweg, dass sich Ernst mit wechselnden falschen Namen und Adressen ins Schießbuch eintrug. Anzunehmen, dass der Lübcke-Mörder sich durch beides bestärkt gefühlt haben könnte, liegt nicht fern. Im Prozess erörtert wurde es nicht.
Fehlende Rechtsextremismus-Kompetenz
Dass derart viel im Vagen und Ungefähren blieb, hat seinen Ursprung bereits in den Ermittlungen. Immer wieder wurde vor Gericht deutlich, dass die Polizei zwar über ein Heer an Fachleuten für technische Spezialgebiete verfügt, dass sie jedoch auffällig schwach auf der Brust ist, wenn es um Wissen über die extreme Rechte geht. Es sei ihnen sehr schwergefallen, Teilnehmer*innen der Versammlung in Lohfelden auf Fotos zu identifizieren, bekannte der Chefermittler. Es waren, wie erwähnt, stadtbekannte Pegida-Leute darunter. Sie saßen in der ersten Reihe. Bei Ernst stieß die Polizei unter anderem auf das rechtsextreme Standardwerk „Eine Bewegung in Waffen“, in dem zu bewaffnetem Kampf und „Feierabendterrorismus“ aufgerufen wird, sowie auf eine in Neonazi-Kreisen ähnlich populäre Anleitung zum Guerillakrieg mit dem Titel „Der totale Widerstand“. Nicht ganz uninteressant im Kontext eines Attentats, könnte man meinen. Ein Ermittler im Zeugenstand aber teilte nur lapidar mit, beides habe man sich nicht näher angesehen. Und zu den ebenfalls bei Ernst gefundenen „Protokollen der Weisen von Zion“ fiel dem erfahrenen Polizeibeamten nicht etwa ein, dass es sich bei dieser mehr als ein Jahrhundert alten Fälschung um so etwas wie die Bibel des weltweiten Antisemitismus handelt – sondern dass die Schrift als jugendgefährdend indiziert sei.
Nach dem Mordversuch an dem Geflüchteten Ahmed I. überprüfte die Polizei neben Personen, die durch Messerstechereien aktenkundig waren, auch etliche Rechtsextreme. Dass der wegen eines Messerangriffs auf einen Imam einschlägig vorbestrafte Ernst zugleich in beide Gruppen fiel, blieb dabei jedoch unbemerkt – oder hatte jedenfalls keine Konsequenzen. Nur sehr oberflächlich wurde der Neonazi überprüft. Dass er dreieinhalb Jahre später doch noch als Tatverdächtigen identifiziert wurde, war purer Zufall: In seiner ersten Vernehmung zum Lübcke-Mord hatte Ernst erzählt, wie er einmal einen vermeintlichen „Ausländer“ auf offener Straße angepöbelt habe, und dabei exakt das Datum des Mordversuchs genannt. Das bekam ein mit dem Fall Ahmed I. vertrauter Beamter zufällig mit und wurde hellhörig. Sonst wären die Akten wohl nie wieder geöffnet worden.
Jetzt werden sie wieder geschlossen, ohne Ergebnis. Für Ahmed I. ist das schwer zu verkraften, ähnlich schwer, wie es der Freispruch von Markus H. für die Familie Lübcke sein dürfte. Um hier nicht missverstanden zu werden: In einem Strafprozess geht es um die individuelle Schuld von Angeklagten, nicht um die Gefühle ihrer Opfer. Ein Urteil wird nicht dadurch richtiger, dass es Rücksicht nimmt auf die Wünsche und Erwartungen von Betroffenen oder ihren Angehörigen. Dennoch war auffällig, mit welch geringer Empathie der Frankfurter Staatsschutzsenat Ahmed I. und der Familie Lübcke begegnete.
Die Aussage der Witwe des Ermordeten wollte Richter Sagebiel spontan dazwischenklemmen, als gerade etwas Zeit war, und musste erst erklärt bekommen, dass eine so schmerzhafte Zeugenaussage mehr Raum und vor allem mentale Vorbereitung braucht. In der Urteilsbegründung endete sein halbherziger Versuch, Anteilnahme für die Familie Lübcke auszudrücken, mit einer Gleichsetzung, die für verständnisloses Kopfschütteln sorgte: „Das Verfahren war auch für uns schwer, das können Sie uns glauben.“
Ahmed I. wurde als Zeuge über Stunden regelrecht in die Mangel genommen, obwohl es auf seine Aussage am wenigsten ankam – er hatte nie behauptet, den Angreifer erkannt zu haben. Selbst intimste Tatfolgen musste er in aller Öffentlichkeit ausbreiten. In der Befragung setzte sich das Misstrauen fort, das dem Geflüchteten schon von der Polizei entgegengebracht worden war, mit Zweifeln an seiner Identität und geringschätzigen Aktenvermerken, in denen er nur „der Ahmed“ genannt wurde. Alexander Hoffmann, Anwalt des 27jährigen, sprach deshalb von „institutionellem Rassismus“. Es fällt schwer, dem zu widersprechen.
Die Akten also zu und alle Fragen offen? Die Hoffnung auf weitere Aufklärung ruht nun auf dem Untersuchungsausschuss, den der Hessische Landtag zum Lübcke-Mord eingesetzt hat. Und zumindest so viel Positives lässt sich über das Ende des Prozesses sagen: Der Ausschuss kann jetzt mit seiner Aufklärungsarbeit beginnen.