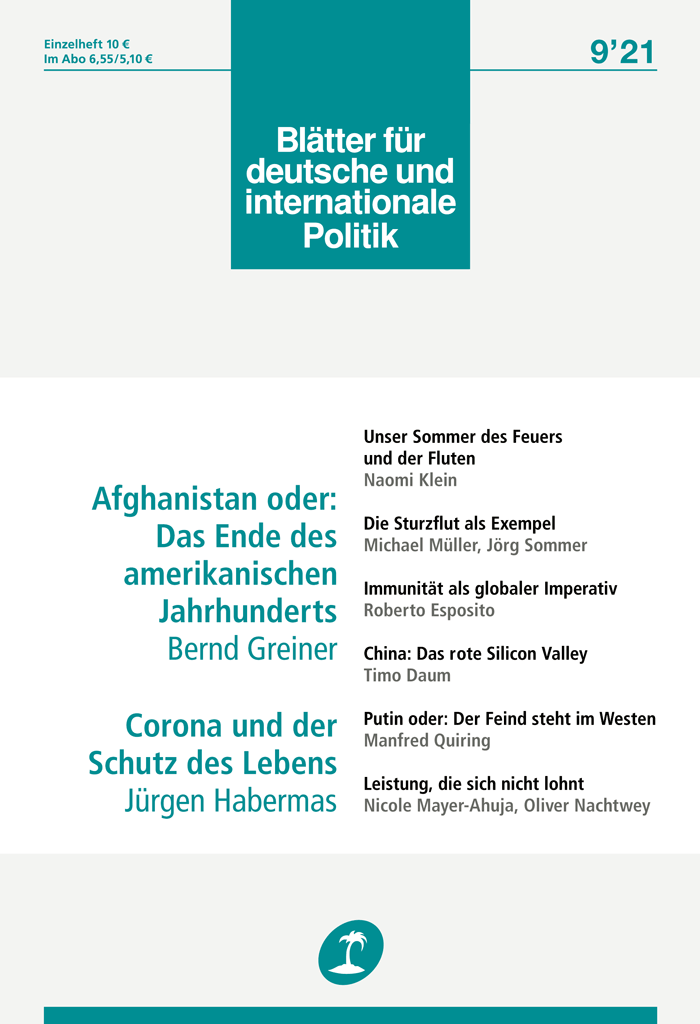In den zurückliegenden beiden Ausgaben der »Blätter« fand eine engagierte Debatte über die Rolle von Staatsschulden statt. Dazu positioniert sich im Folgenden »Blätter«-Mitherausgeber Rudolf Hickel.
Die deutschen Staatsschulden steigen und steigen auf breiter Front. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind die Schulden des öffentlichen Sektors Ende 2020 gegenüber dem Vorjahr um 14,4 Prozent auf 2,173 Bill. Euro angewachsen. Allein beim Bund wird bis ins nächste Jahr die Kreditaufnahme um knapp 460 Mrd. Euro angestiegen sein.
Zentrale Triebkräfte sind die Kosten der Coronakrise, der Wiederaufbaufonds infolge der Flutkatastrophe, aber auch aufgrund der Schuldenbremse aufgestaute Investitionen. Die Debatte, wie mit dieser expansiven Staatsverschuldung umgegangen werden soll, ist im Bundestagswahlkampf in vollem Gange. So werden von Grünen, SPD und Linkspartei Programme gegen die Erderwärmung sowie massive Infrastrukturinvestitionen gefordert, während Union und FDP dafür plädieren, die Schuldenbremse strikt einzuhalten.
Auch in der Wissenschaft sind die Positionen weit gefächert. Während in den „Blättern“ bisher für die „goldene Regel“ plädiert wurde,[1] wonach produktive und zukunftsstärkende öffentliche Investitionen über die Finanzmärkte finanziert werden dürfen, erteilt Axel Stommel dem in der letzten Ausgabe eine schroffe Absage – mit der Behauptung unvermeidbaren ökologischen Schrumpfens.[2] Auf der anderen Seite geht die von Dieter Ehnts eingeführte „Modern Monetary Theory“ weit über die „goldene Regel“ hinaus, getreu der Devise: „Geld ist genug da – der Staat muss es nur erzeugen“.[3] Mit dieser faktischen Einführung unbegrenzten Staatsgeldes hat die MMT inzwischen fast das Zeug zu einer neuen Heilslehre.
Doch beide Positionen werden, in unterschiedlicher Weise, der tatsächlichen Herausforderung nicht gerecht.
Ökologisch begründet Stommel seine Position wie folgt: Die Umweltkrise erzwinge eine generelle Schrumpfung der Wirtschaft, also auch den Abbau von Produktionskapazitäten auf breiter Front. Deshalb sei es dem Staat verboten, selbst mit ökologisch gut begründeten Investitionen neue Kapazitäten aufzubauen.
Zulässige Kreditfinanzierung wird von ihm am Beispiel der Coronakrise demonstriert. Hier wurden durch die Lockdown-Maßnahmen Produktionskapazitäten vorübergehend stillgelegt, ja sogar zum Teil vernichtet. Nur um zu den ausgelasteten Produktionskapazitäten der Vor-Corona-Zeit zurückzukehren, sollen öffentliche Kredite zur Finanzierung von Wiederbelebungsaktivitäten zulässig sein.
Stommel bestätigt hier Art. 115 Grundgesetz: Demnach wird das Verschuldungsverbot im Falle „außerordentlicher Notlagen“ und bei „Naturkatastrophen“ – siehe die jüngste Flut – bewusst ausgesetzt. Aber er übersieht eine wichtige Lehre aus der Coronakrise: Die Programme zur Stärkung der durch Corona belasteten Wirtschaft beinhalten ausdrücklich Projekte zur sozial-ökologischen Transformation. So dient das (in vielen Punkten durchaus zu kritisierende) Scholz’sche „Wumms“-Programm mit seinen über 130 Mrd. Euro einerseits der Stärkung der Konjunktur und damit der Auslastung der vorhandenen Produktionskapazitäten, aber andererseits auch den Investitionen in den ökologischen Umbau. Vorhandene Produktionskapazitäten sollen so gezielt ausgelastet und zugleich der ökologische Um- wie Neubau von Produktionsanlagen gefördert werden. Dafür steht die Förderung von umweltverträglicher Mobilität wie der Ausbau der Wasserstoff-Wirtschaft.
»Ökologisch geboten ist eben nicht ein allgemeines Schrumpfen, sondern der gezielte Um- und Ausbau zu einer nachhaltigen Wirtschaft.«
Stommels rein konjunkturelle Blickverengung auf die Sicherung vorhandener Produktionskapazitäten übersieht diese strukturell gewollten Wirkungen. Ökologisch geboten ist eben nicht ein allgemeines Schrumpfen, sondern der gezielte Um- und Ausbau zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Dazu dienen die staatlichen Investitionsprogramme, die wegen ihrer produktiven Nachhaltigkeit zwingend über Kredite und damit über eine höhere Staatsverschuldung zu finanzieren sind.
Ein Beispiel: Der Ausstieg aus der fossilen Energie durch den Einstieg in erneuerbare Energien verlangt immense private und öffentliche Investitionen, etwa in den Bau von Windrädern wie in den Ausbau umfassender Stromnetze. Selbstverständlich werden zugleich auch umweltbelastende Produktionskapazitäten, etwa in der Kohle, abgebaut. Bisher zeigen jedoch die meisten empirisch fundierten Studien im internationalen Vergleich, dass gegenüber den Verlusten an Arbeitsplätzen mehr neuer Jobs entstehen.[4] Nicht die Demontage der Wirtschaft, sondern Zukunftsinvestitionen dienen dem Umbau zum nachhaltigen Wirtschaften.
»Wer Staat sagt, muss auch Steuern sagen, wiederholt Stommel den weit verbreiteten Irrtum.«
Damit stellt sich die Frage, warum die von Stommel präferierte Steuerfinanzierung gegenüber der Kreditaufnahme über die Finanzmärkte volkwirtschaftlich überlegen sein soll. „Wer Staat sagt, muss auch Steuern sagen“, wiederholt Stommel den weit verbreiteten Irrtum. Das daraus abgeleitete Kreditfinanzierungsverbot für öffentliche Investitionen ist jedoch finanzwissenschaftlich schlicht nicht haltbar, da gerade Anschubinvestitionen zur Belebung der Wirtschaft und damit zu mehr Staatseinnahmen führen können und sollen, also keine Steuererhöhungen zur Folge haben müssen.
Jedenfalls lässt sich eine überzeugende finanzpolitische Begründung des Verschuldungsverbots bei Stommel nicht finden.
Weitergeholfen hätte hier auch der Griff in den Fundus der funktionalen Finanzwissenschaft („functional finance“). Denn bei öffentlichen Investitionen etwa gegen die Klimakatastrophe ist die intergenerative Wirkung entscheidend, die zwischen der aktuellen Finanzierung und den späteren ökologischen Wohlstandsgewinnen für künftige Generationen besteht.
Im Falle von Steuern finanziert die gegenwärtige Bevölkerung das Investment in die künftige Nachhaltigkeit des Wirtschaftens. Nutznießer ist also die künftige Generation, ohne dass diese für die Finanzierung aufkommen muss. Daraus erwächst die Gefahr, dass wichtige, später erst wirkende Infrastrukturinvestitionen verweigert werden. Denn der Druck, durch eine sofort wirksame, erhöhte Steuerlast die milliardenschweren Öko-Investitionen schultern zu müssen, bremst die Bereitschaft zu einer Politik der Nachhaltigkeit.
Allein mit dem Finanzierungsinstrument der Staatsverschuldung lässt sich der fiskalisch gebotene Kontext zwischen den Nutznießern von Zukunftsprogrammen und deren Finanzierung herstellen.
Durch den heutigen Einsatz von investiv verwendeten Staatsschulden werden künftige, ökologisch bessere Lebens- und Produktionsverhältnisse vererbt.[5] Diesen Grundgedanken zur Rechtfertigung von Staatsschulden mit der intergenerativen Wirkungskette bei öffentlichen Investitionen entwickelte der Nestor der funktionalen Finanzwissenschaft, Richard A. Musgrave, bereits 1959 in seinem epochalen Beitrag „Internal Debt in the Classical System“.[6]
Mit dieser intergenerativen Wirkung entpuppen sich die populistisch-neoliberalen Sprüche von den künftigen Generationen, denen heute die Schuldenlast vererbt würde, als ökonomischer Unfug. Stommels Schlüsselsatz „Wer Staat sagt, muss auch Steuern sagen“, ist daher schlicht falsch. Richtig ist vielmehr: Damit künftige Generationen überhaupt aus ökologisch nachhaltiger Wertschöpfung Steuern aufbringen können, müssen heute die dazu erforderlichen Transformationsinvestitionen per Staatsschulden finanziert werden.
»Die Botschaft der Modern Monetary Theory ist verblüffend simpel und im ersten Moment durchaus faszinierend.«
Axel Stommels unsinniges Investitionsverbot basiert, wie auch der Streit über die Schuldenbremse, auf dem bisher gültigen Mechanismus: Der Staat beansprucht öffentliche Kredite, die auf den Finanzmärkten angeboten werden. Grundsätzlich sind dafür aus dem Staatsbudget Zinsen sowie die Tilgung an die Gläubiger aufzubringen. Für diese Finanzierungsstruktur ist die systemische Abhängigkeit des Staates von den Finanzmärkten konstitutiv. Zu diesen budgetären Grenzen der Staatsverschuldung gesellen sich, über die Belastung durch Zinsen und Tilgungen hinaus, auch gesamtwirtschaftliche Grenzen. Die gängigen, allerdings kritisch zu überprüfenden Indikatoren dafür sind: Inflation, steigende Zinssätze und damit auch die befürchtete Verdrängung von Unternehmensinvestitionen.
Diesen sattsam bekannten Grenzen der Staatsverschuldung, die aus der Abhängigkeit des Staates von der Privatwirtschaft resultieren, sagt nun eine noch immer neue, teilweise durchaus provokative Theorie den Kampf an – die Modern Monetary Theory, kurz MMT. Ihre Botschaft ist verblüffend simpel und im ersten Moment durchaus faszinierend: Der (nationale) Staat kann sich mit seinem (nationalen) Währungsmonopol das Geld einfach schaffen, das er für die Finanzierung seiner Aufgaben braucht. Also, Geld für den Staat ist im Überfluss vorhanden, und zwar frei vom Ballast der Steuereintreibung und der damit verbundenen Frage nach der Verteilung der Steuerlasten. Daseinsvorsorge, Infrastrukturinvestitionen, Gemeinwohl-Projekte und neuerdings die „Green Deal“-Zukunftsprogramme müssen also nicht mehr an den begrenzten traditionellen Finanzierungsquellen, Steuern und Staatsverschuldung, scheitern.
Die bisher autonome Zentralbank, die autoritär als Bank der Banken für die optimale Geldversorgung zuständig war, oftmals auch gegen den Willen der Finanzpolitik, wird so zur bloßen Abteilung des nationalen Finanzministeriums degradiert, zuständig für die Abwicklung der Zahlungsanweisungen durch den Staat. Veranlasst also der Staat Zahlungen für notwendig gehaltene Ausgaben, dann bedarf es nicht mehr der Geldschöpfung durch die Zentralbank. Geld wird einfach auf Anweisung des Finanzministeriums erzeugt. Die MMT-Protagonisten sprechen durchaus auch von Grenzen der Geldschöpfung durch den sich finanzierenden Staat. Die Grenzziehung durch die „verfügbaren Ressourcen“ und die Gefahr der Inflation bleibt allerdings auffällig unpräzise. Auch deshalb wird MMT als die fabelhafte Story vom grenzenlosen Staatsgeld wahrgenommen.
Dieser fundamentalen Neuordnung der Staatsfinanzierung über das staatliche Währungsmonopol haftet durchaus etwas Theorie-Revolutionäres an. Die Politik entscheidet demnach frei über die Menge an Finanzen, die sie braucht. Die Aufgabe der Notenbank, die Geldmenge unter Nutzung des Geschäftsbankensystems unabhängig von der Politik zu steuern, entfällt. Auch werden die Finanzmärkte und die vormaligen Käufer von Staatsanleihen, also die Gläubiger, nicht mehr gebraucht und damit faktisch ausgeschaltet.
Die „Modern Monetary Theory“ ist allerdings nicht einmal so modern. Ihre Protagonisten verweisen explizit auf die „Staatliche Theorie des Geldes“[7] von Georg Friedrich Knapp, der das Geld bereits 1905 als eine reine „Schöpfung der Rechtsordnung“ beschrieb.
Wie aber ist dann der heutige rasante Aufstieg der Staatsgeld-Theorie zu erklären?
»Sowohl in den USA als auch in Deutschland wird die gut begründete Ausweitung der Staatsverschuldung immer noch über die Finanzmärkte abgewickelt.«
Eine der entscheidenden Triebkräfte ist der massive Zuwachs an öffentlichem Finanzbedarf und die verzweifelte Suche nach Finanzierungsinstrumenten. Mangels widerspruchsfrei möglicher Steuererhöhungen und ausreichender Spielräume beim Einsparen von Ausgaben wird die Staatsverschuldung zum Super-Rettungsanker.
Obwohl diese Monetär-Theorie bereits vor über 25 Jahren aus den USA vorangetrieben wurde, hat die Forderung nach staatlicher Geldschaffung insbesondere im Umfeld der US-Präsidentschaftskandidatur von Bernie Sanders bis tief in den wirtschaftswissenschaftlichen Diskurs hinein Verbreitung gefunden. Vor allem die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez hat MMT salonfähig gemacht; und Stephanie Keltons Buch „The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and How to Build a Better Economy“ von 2020 genießt mittlerweile weltweiten Kultstatus.[8] Auch in Deutschland findet heute kaum ein Seminar über „alternative Wirtschaftspolitik“ statt, ohne die neue Monetär-Theorie aufzurufen. Einer der publizistischen Treiber ist hier der Blog „Makroskop“, der die Kritiker dieser Staatsgeldlehre teilweise ziemlich skrupellos abkanzelt.
Im Unterschied dazu zeichnet sich der Chefdenker im deutschsprachigen Raum, Dirk Ehnts, als differenzierter Vertreter dieser durch ihn bezeichneten „kopernikanischen Wende“ aus.
In seinem Beitrag in den „Blättern“ lassen sich die Grundzüge gut nachvollziehen.[9] Allerdings wird bereits durch den Bezug auf Joe Biden mit seinen angekündigten Megaprogrammen über insgesamt 6,6 Billionen US-Dollar[10] der Eindruck geweckt, MMT gelte dem neuen US-Präsidenten als Richtschnur seiner Finanzpolitik. Das aber ist ein Trugschluss. Gleiches gilt für den Hinweis, die massiv gestiegenen Staatskosten der Coronakrise sowie die anstehende Finanzierung der „Green Deal“-Programme in Deutschland ebneten den Weg zur Geldschaffung über das Währungsmonopol.
Bei aller Sympathie für die MMT-Idee: Sowohl in den USA als auch in Deutschland wird die gut begründete Ausweitung der Staatsverschuldung immer noch über die Finanzmärkte abgewickelt, allerdings unter Nutzung der Programme der beiden Notenbanken zum Aufkauf von Staatsanleihen auf Basis deren unabhängiger Geldpolitik. Die MMT wendet sich dagegen von einer heute verantwortbaren Schuldenfinanzierung bei stabiler Wirtschaftsentwicklung radikal ab. Dabei gibt es genügend Spielraum für die wachsende Kreditaufnahme auf den Finanzmärkten. Das überschüssige Sparvermögen gegenüber den gesamtwirtschaftlichen Investitionen verhindert einen Inflationsanstieg auf breiter Front und zudem steigende Zinssätze. Zugleich nutzen die Anleger mit dem Kauf öffentlicher Anleihen weltweit den Staat als „sicheren Hafen“, und zwar selbst bei negativer Rendite. Unterstützt wird die erfolgreiche Expansion staatlicher Schulden auch durch die Europäische Zentralbank. Mit ihren allgemeinen und speziell gegen die Coronakrise gerichteten Programmen zum Ankauf von Staatsanleihen ist die EZB mit knapp 36 Prozent einer der wichtigsten Gläubiger gegenüber Deutschland. Die Idee der MMT, die Notenbank mit ihrem Währungsmonopol stärker einzubeziehen, ist daher auch ohne den revolutionären Umbau des gesamten Finanz- und Geldsystems möglich.
»Tatsächlich ist der Verzicht auf die Steuerpolitik der Dreh- und Angelpunkt der Kritik an der Theorie der staatlichen Gelderzeugung.«
Und ein zweites, noch wichtigeres Argument kommt hinzu: In den USA wie im Bundestagswahlkampf werden Pläne zur Steuererhöhung auch politisch diskutiert. Und das aus gutem Grund!
Tatsächlich ist der Verzicht auf die Steuerpolitik der Dreh- und Angelpunkt der Kritik an der Theorie der staatlichen Gelderzeugung. Laut MMT werden Steuern zur Finanzierung von Staatsausgaben nicht mehr gebraucht. Steuerpolitik reduziert sich so im Kern auf die Bekämpfung der rein nachfrageorientiert erklärten Inflation. Wird mehr nachgefragt, als die Angebotskapazitäten es zulassen, ist eine durch die Übernachfrage ausgelöste Inflation die Folge. Dann muss die Inflation über Steuererhöhungen gebremst werden, zur Drosselung der Nachfrage.
Auch die „Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik“ hat in ihrem jüngsten „Memorandum 2021“ das Für und Wider der Moderne Monetary Theory diskutiert.[11] Darin kritisieren wir unter anderem, dass die Steuerpolitik eben nicht nur zur Finanzierung von Staatsausgaben genutzt werden kann, sondern eben auch für eine sozial gerechte Umverteilung der Vermögen und Einkommen. Mit der links-progressiven Position „Geld ist genug da für die Finanzierung ökologisch und sozial nachhaltiger Politik, es muss allerdings über die stärkere Inpflichtnahme der Einkommens- und Vermögensstarken mobilisiert werden“, hat die MMT-Bewegung jedoch nichts mehr am Hut. Für staatliche Ausgaben steht ja schließlich das Staatsgeld zur Verfügung. Die Absage an die aktuelle Forderung nach einer einmaligen Vermögensabgabe zur Finanzierung der Tilgung der Corona-Schulden ist insoweit völlig eindeutig. Wenn aber wie nach unserer Auffassung genug Geld im Umlauf ist, dann muss dieses eben nicht durch Buchungsvorgänge im Finanzministerium erzeugt werden. Vielmehr müssen die staatlichen Finanzmittel durch Steuern und Staatsschulden mobilisiert werden. Damit rückt der Eingriff in die Verteilung von Einkommen und Vermögen zugunsten sozial gerechte Steuerlastverteilung ins Zentrum. Letztlich geht es dabei um die kapitalistischen Produktions- und die daraus folgenden Verteilungsverhältnisse. Indem sich die MMT dagegen ganz auf die lautlose Finanzierung des Staates über sein Währungsmonopol konzentriert, schottet sie sich krampfhaft gegenüber den Folgen krisenhafter Produktionswirtschaft ab. Mit der fatalen Konsequenz, dass konzentrierte Marktmacht das Wirken der MMT gar nicht berührt. So spielt für sie bei der Erklärung von Inflation und Arbeitslosigkeit die Gewinnerzielung und -verwendung durch monopolistische Unternehmensmacht keine Rolle. Verteilungskämpfe zwischen Kapital und Arbeit können ihre heile Sphäre der staatlichen Finanzierung über das Währungsmonopol nicht wirklich tangieren.
»Im Vordergrund steht bei der MMT die trügerische Sehnsucht nach ökonomisch-ökologischem Wohlstand ohne Verteilungskämpfe.«
Im Gegenteil: Die Aussagen zur produktivitätsorientierten Lohnpolitik schließen das Ziel der Umverteilung zugunsten der Arbeitsentlohnung aus. Im Vordergrund steht bei der MMT die trügerische Sehnsucht nach ökonomisch-ökologischem Wohlstand ohne Verteilungskämpfe. Insofern ist Dirk Ehnts klare Aussage, „Warum MMT keine ‚linke‘ Doktrin ist“, nicht wirklich überraschend, sondern schlicht ehrlich.[12] Kurzum: Die MMT übt eine durchaus wichtige Kritik am bisherigen Finanz- und Währungssystem. Allerdings bietet sie mit der Verabsolutierung des staatlichen Währungsmonopols eine offene Flanke und löst daher berechtigten Widerspruch aus. Gerade weil die MMT speziell in globalisierungs- und umweltkritischen Kreisen Hoffnungen auf die grenzenlose Schaffung von Staatsgeld weckt, gilt daher die Warnung: Ohne gesellschaftliche und ökonomische Konflikte, also quasi im Schlafwagen die Endstation ökologischen Wohlstands erreichen zu wollen, könnte sich ganz schnell als eine gefährliche Illusion entpuppen.
[1] Achim Truger, Schuldenbremse oder: Die Abkehr von einem Dogma?, in: „Blätter“, 2/2021, S. 5-8; Rudolf Hickel, Die Kosten der Coronakrise: Wer begleicht die Rechnung?, in: „Blätter“, 10/2020, S. 105-112.
[2] Axel Stommel, Modern Monetary Theory – Das Ende der Umverteilung?, in: „Blätter“, 8/2021, S.41-44.
[3] Dirk Ehnts, Vorbild Biden: Mit der Modern Monetary Theory aus der Krise?, in: „Blätter“, 7/2021, S. 114-120.
[4] Rudolf Hickel, Der Preis der Umwelt – Mythos: Umweltpolitik vernichtet Arbeitsplätze, in: Rudolf Hickel, Johann-Günther König und Hermannus Pfeiffer, Gewinn ist nicht genug – 21 Mythen über die Wirtschaft, die uns teuer zu stehen kommen, Hamburg 2020, S. 13-24.
[5] Zweifellos wird auch ein Verteilungsproblem zwischen den Zinszahlern und Zinsbeziehern in die kommenden Generationen hineingetragen. Dies ist jedoch auf dem Hintergrund nachhaltigen Wirtschaftens und durch eine gerechte Steuerpolitik lösbar.
[6] Richard A. Musgrave, Internal Debt in the Classical System, in: The Theory of Public Finance, New York 1959 (Deutsch: Finanztheorie, Tübingen 1974).
[7] Georg-Friedrich Knapp, Staatliche Theorie des Geldes, München und Leipzig 1905.
[8] Stephanie Kelton, The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and How to Build a Better Economy, New York 2020.
[9] Dirk Ehnts, a.a.O.
[10] Davon für den American Rescue Plan 1,9 Bill. Dollar, den Infrastrukturplan 1,2 Bill., den Plan für soziale Infrastruktur 3,5 Bill.; das sind insgesamt 28,7 Prozent des US-Bruttoinlandsprodukts, vgl. Torsten Ricke, US-Wirtschaft: Der richtige Showdown ist schon in Sichtweite, in: „Handelsblatt“, 12.8.2021.
[11] Siehe das 6. Kapitel in: Memorandum 2021: Corona – Lernen aus der Krise! Alternativen zur Wirtschaftspolitik, Köln 2021, S. 285-306.
[12] Dirk Ehnts, Warum MMT keine „linke Doktrin“ ist, in: „Makroskop“, 4.3.2019.