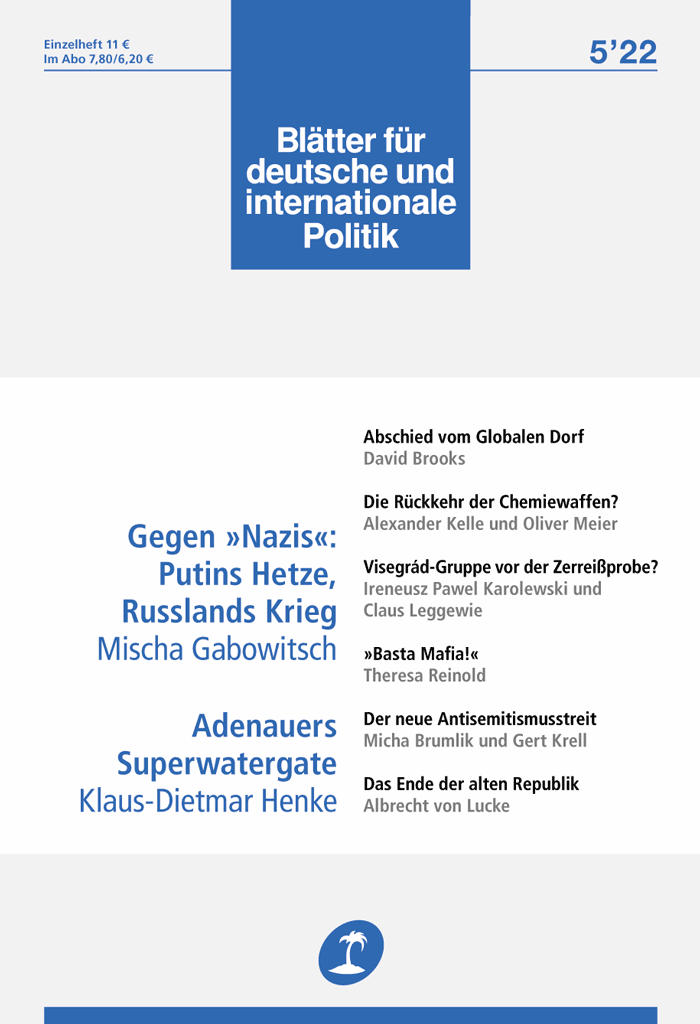Bild: Arbeiter im Kohleabbau in Dhanbad/Indien (IMAGO / Joerg Boethling)
Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine dauerte es nur wenige Tage, bis bei deutschen Autoherstellern viele Bänder stillstanden. Der Grund dafür: Zwei ukrainische Fabriken des Nürnberger Autozulieferers Leni konnten nicht mehr produzieren. Kurz darauf fehlten bei VW, BMW und Porsche die Kabelbäume, sozusagen das zentrale Nervensystem der Fahrzeuge. Auch ein großes Stahlwerk in Mariupol fällt als Lieferant aus. Noch mehr Kopfzerbrechen als die kriegsbedingten Lieferausfälle aus der Ukraine bereitet der deutschen Industrie die Abhängigkeit von Russland bei den Energierohstoffen Erdgas, Erdöl und Steinkohle sowie bei verschiedenen Metallen. Fieberhaft suchen deutsche Unternehmen und der Bundeswirtschaftsminister jetzt nach alternativen Rohstoffquellen, auch in Ländern, wo die Förderung mit massiven Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen einhergeht. Ein wirksames EU-Lieferkettengesetz ist deshalb dringlicher denn je, doch Wirtschaftsverbände wollen den gerade vorgelegten Entwurf unter dem Vorwand des Ukraine-Kriegs aushebeln.
Laut der Deutschen Rohstoffagentur (DERA) importierte Deutschland im Jahr 2020 Metalle im Wert von 2,8 Mrd. Euro aus der Russischen Föderation. Wertmäßig rangierten Palladium mit 608 Mio. und Kupfer mit 595 Mio. Euro ganz oben. Noch abhängiger ist die Bundesrepublik bei anderen Rohstoffen: 2020 importierte es Raffinadenickel zu 44 Prozent, Titan zu 41 Prozent und Eisenerzerzeugnisse zu 35 Prozent aus der Russischen Föderation. Nach Bekanntwerden der Gräueltaten in Butscha beschloss die EU in ihrem fünften Sanktionspaket zwar ein Steinkohleembargo, das Mitte August in Kraft tritt. Andere Rohstoffe sind bislang jedoch von den Sanktionen gegen Russland ausgenommen. Ob das so bleibt, ist ungewiss. Viele Unternehmen wollen zwar an bestehenden Lieferverträgen festhalten, aber möglichst keine neuen abschließen.
In der aktuellen Lage ist die Suche nach alternativen Rohstoffquellen ethisch durchaus geboten. Allerdings drohen hochproblematische Nebeneffekte, weil in vielen möglichen Lieferländern Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen mit der Förderung einhergehen. Teilweise befinden sich die Rohstoffe in fragilen Ökosystemen. Deutlich wird das am Beispiel Steinkohle: 2021 importierte Deutschland 56 Prozent seines Bedarfs aus Russland. Aufgrund der Sanktionen müssen deutsche Unternehmen diese Importe ab Mitte August komplett einstellen. Alexander Bethe, Vorstandsvorsitzender des deutschen Vereins der Kohleimporteure, hält dies für verkraftbar: „Steinkohleimporte aus Russland können in wenigen Monaten vollständig durch andere Länder ersetzt werden. Insbesondere aus den USA, Kolumbien und Südafrika.“ Aus Kolumbien – 2016 noch zweitwichtigster Lieferant – hatte Deutschland aufgrund von Preisentwicklungen und Qualität zuletzt nur noch fünf Prozent seines Bedarfs bezogen, aus Südafrika gar keine Steinkohle mehr.
Das Problem: Seit langem sind sowohl in Kolumbien als auch in Südafrika gravierende Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen im Kohlesektor bekannt. So verdrängt El Cerrejón, der größte Steinkohletagebau Lateinamerikas, – unter anderem Zulieferer von deutschen Energiekonzernen – die umliegenden Gemeinden der indigenen Wayuu und gräbt ihnen buchstäblich das Wasser ab. Sprengungen setzen große Mengen an Feinstaub frei und führen zu Atemwegserkrankungen, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen. Zwangsumsiedlungen sowie Mordanschläge auf Indigene und Gewerkschafter*innen sind im Umfeld von Kohleminen in Kolumbien keine Seltenheit. Auch in den südafrikanischen Provinzen Mpumalanga und Limpopo verseucht der Kohleabbau durch saure Grubenwässer Flüsse und Grundwasser, zerstört landwirtschaftliche Anbauflächen und verursacht durch Feinstaub massenhaft Staublungen, Herzerkrankungen und Krebs.[1]
Auch bei der Suche nach Alternativen für metallische Rohstoffe stehen Unternehmen vielfach vor der Wahl zwischen Pest und Cholera. Um Nickelimporte aus Russland zu ersetzen, fällt ihr Augenmerk zwangsläufig auf Indonesien und die Philippinen, wo sich fast die Hälfte der weltweiten Nickelproduktion konzentriert. Aktuell plant VW mit den chinesischen Unternehmen Tsingshan Group und Huayou Cobalt ein Gemeinschaftsunternehmen, um in Indonesien Laterit-Nickelerz zu verarbeiten. Ein gefährliches Terrain, denn beim Abbau und der Weiterverarbeitung von Nickel sind Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen weithin bekannt.[2] Ähnliches gilt für die Philippinen: Laut Global Witness wurden dort zwischen 2016 und 2020 unter dem martialischen Präsidenten Rodrigo Duterte 166 Landrechts- und Umweltverteidiger*innen ermordet, deutlich mehr als in jedem anderen Land der Erde.
Nicht besser sieht es beim Eisenerzabbau in Brasilien aus, den der VALE-Konzern dominiert, ein Schlüssellieferant für Thyssenkrupp und damit indirekt für die gesamte deutsche Industrie. Der Bergbaugigant hat mit den von ihm verantworteten verheerenden Dammbrüchen der Eisenerzminen 2015 in Mariana und 2019 in Brumadinho traurige Geschichte geschrieben. Sie gehören mit 19 bzw. 272 Toten zu den weltweit größten wirtschaftsbezogenen Menschenrechts- und Umweltverbrechen der letzten Jahrzehnte. Viele weitere Dämme gelten als höchst gefährdet. Auch beim Kupferabbau in Peru und Chile, beim Platinabbau in Südafrika und beim Bauxitabbau in Guinea – allesamt strategische Zulieferer der deutschen Automobilindustrie und mögliche Alternativen für Importe aus Russland – sind schwere Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen umfassend dokumentiert.[3] Durch den Ukraine-Krieg steigt der Druck, in diesen problematischen Abbauregionen noch mehr Rohstoffe abzubauen, und damit das Risiko für Umwelt und Bevölkerung.
EU-Lieferkettengesetz: Dringlicher denn je
Nicht minder problematisch ist das Vorhaben von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck, zur Sicherung von Flüssiggaslieferungen für die deutsche Wirtschaft eine Energiepartnerschaft mit dem Emirat Katar abzuschließen. Katar ist – nicht nur im Zusammenhang mit den Stadionbauten für die Fußballweltmeisterschaft – für Menschenrechtsverletzungen berüchtigt, insbesondere gegenüber Arbeitsmigrant*innen. Zur Rechtfertigung verweist Habeck auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das deutsche Unternehmen verpflichtet, auch bei Geschäftspartnern im Ausland die Einhaltung von Umwelt- und Menschenrechtsstandards sicherzustellen. Das Argument greift aber deutlich zu kurz, was Habeck wissen müsste. Nicht zuletzt die Grünen hatten die Verwässerung des Gesetzes durch seinen Amtsvorgänger Peter Altmaier angeprangert. Zu Recht, denn bei mittelbaren Zulieferern – also besonders im Rohstoffsektor – müssen deutsche Unternehmen paradoxerweise nur dann Risiken untersuchen, wenn sie darüber bereits zuvor „substantiierte Kenntnis“ haben.[4] Längst nicht in allen Fällen kann eine solche Kenntnis der Unternehmen vorausgesetzt oder belegt werden. Überdies begründen Verstöße deutscher Unternehmen gegen die Sorgfaltspflichten laut Gesetz explizit keine zivilrechtliche Haftung für die entstandenen Schäden. Umweltstandards werden ohnehin nur punktuell berücksichtigt.
Ein wirksames EU-Lieferkettengesetz, das die europäischen Unternehmen weltweit in die Pflicht nimmt, könnte Abhilfe schaffen. Es würde auch zur Nachbesserung der deutschen Regelung verpflichten. Just am Tag vor Beginn der russischen Invasion der Ukraine hat die Europäische Kommission am 23. Februar ihren Vorschlag für eine Richtlinie zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten im Bereich der Nachhaltigkeit vorgelegt. Positiv ist, dass diese nicht nur Menschenrechte, sondern auch Umwelt und Klima umfassen sollen. Neben behördlichen Sanktionen schlägt die Kommission außerdem eine zivilrechtliche Haftung für Schäden vor, wenn Unternehmen diese durch Missachtung ihrer Sorgfaltspflichten mitverursacht haben. Die EU-Gesetzgebung soll zudem nicht nur auf Unternehmen ab 1000 Beschäftigte Anwendung finden – wie im deutschen Lieferkettengesetz vorgesehen –, sondern bereits für Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten gelten. In bestimmten Hochrisikosektoren sinkt die Schwelle sogar auf 250. Allerdings enthält auch dieser Kommissionsvorschlag problematische Schlupflöcher. So sollen Sorgfaltspflichten prinzipiell zwar für die gesamte Wertschöpfungskette gelten, allerdings wird dies auf „etablierte Geschäftsbeziehungen“ begrenzt, die auf Dauer angelegt sind. Kurzfristige Geschäfte, beispielsweise an Spotmärkten, die Mensch und Umwelt ebenfalls schaden können, werden damit ausgeklammert. Unbefriedigend ist auch, dass Unternehmen zwar Klimapläne veröffentlichen müssen, die mit dem 1,5 Grad-Ziel kompatibel sind, sie zu ihrer Umsetzung aber nicht explizit verpflichtet werden.
Instrumentalisierung des Krieges
Während das Bündnis „Initiative Lieferkettengesetz“ und viele Abgeordnete des Europäischen Parlaments entsprechende Nachbesserungen fordern, laufen Wirtschaftsverbände aus gänzlich gegenläufigen Gründen Sturm gegen den Entwurf und mobilisierten dafür auch CDU und CSU. Diese instrumentalisieren für ihren Widerstand ausgerechnet die Lieferengpässe und explodierenden Rohstoffpreise in Folge des Ukraine-Krieges. So forderte Manfred Weber (CSU), Vorsitzender der Europäischen Volkspartei, am 10. März Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf, die Pläne zu einem EU-Lieferkettengesetz zu vertagen, „bis die Auswirkungen der Krise vollständig bekannt sind“. Und Gitta Connemann (CDU), Vorsitzende der Wirtschafts- und Mittelstandsunion (MIT), kritisierte: „Ausgerechnet jetzt wollen Deutschland und die EU die Lieferketten schärfer kontrollieren, während gleichzeitig in Osteuropa die Panzer rollen.“ Doch auch das schwerste rhetorische Geschütz vermag über die fehlende Substanz der Kritik nicht hinwegzutäuschen. Denn das EU-Lieferkettengesetz wird voraussichtlich erst in vier Jahren in Kraft treten, nach Beratungen zwischen Europäischem Parlament, Rat und Kommission. Es hat also aktuell auf die Unternehmen keinerlei Auswirkungen. Zudem zeigen alle seriösen Projektionen – Bundesregierung, EU-Kommission, London School of Economics, Ernst and Young – dass die Umsetzungskosten des Gesetzes für Unternehmen keine relevante Belastung darstellen werden. Das Lieferkettengesetz ist laut einer vom Handelsblatt so bezeichneten „Giftliste“ nur eines von 49 EU-Vorhaben, welche die Mittelstandsunion unter dem Vorwand des Ukraine-Krieges aufs Abstellgleis schieben will. Zum versuchten regulatorischen Rollback gehören auch die EU-Initiativen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, Taxonomie, zum CO2-Grenzausgleichsmechanismus, zur Luftqualität und globaler Mindestbesteuerung von Konzernen. Nahezu alles, was Klima, Umwelt, Menschenrechte und das Gemeinwohl schützen soll, wird dem Profit geopfert.
Nachhaltige Rohstoffwende
Dabei zeigt doch gerade der Fall Russland, wie kurzfristiges Profitstreben auch wirtschaftlich in die Sackgasse führt. „Der Handel mit Russland wurde ja gewollt aufgebaut. Alles war billig und unkompliziert“, sagte Jochen Kolb vom Thinktank „Industrielle Ressourcenstrategien“. Über den „Ostausschuss der deutschen Wirtschaft“ waren BDI, DIHK und führende deutsche Unternehmen seit Jahrzehnten die treibenden Kräfte. Dabei ließen sie sich weder von Umweltkatastrophen und Verletzungen der Rechte indigener Völker beim Abbau von Nickel und Steinkohle in Sibirien noch von der immer brutaleren Unterdrückung der Opposition durch Präsident Putin beirren. Auch geostrategische Warnungen vor der Abhängigkeit von russischem Gas und Erdöl und russischer Kohle wurden offenbar in den Wind geschlagen. Zugleich hat die Wirtschaftslobby nach Kräften die Energiewende ausgebremst und damit nicht nur die Klimakrise verschärft, sondern auch die Abhängigkeit von russischen Energierohstoffen zementiert, die uns heute auf die Füße fällt. Sollten wir ausgerechnet dem Rat derselben Wirtschaftslobby folgen, die jetzt den Ukraine-Krieg als Argument gegen Maßnahmen zum Schutz von Klima, Umwelt und Menschenrechten ins Feld führt?
Ganz im Gegenteil bestätigt sich erneut: Auch für die Wirtschaft gibt es keine Resilienz ohne Nachhaltigkeit. Ein wirksames EU-Lieferkettengesetz würde maßgeblich dazu beitragen, dass Unternehmen frühzeitig Risiken für Menschenrechte und die Umwelt, aber auch für die Versorgungssicherheit erkennen, in Russland wie anderswo. Darüber hinaus gilt aber auch: Nachhaltigkeit gibt es nicht ohne eine grundlegende sozial-ökologische Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Blick auf die fragwürdigen Alternativen zu russischen Rohstoffen macht deutlich, dass nachhaltige Rohstoffe ein äußerst knappes Gut sind. Oberstes Gebot der Stunde ist daher eine drastische Senkung des Verbrauchs energetischer wie auch metallischer Rohstoffe. Wirklich nachhaltig sind auch die Mobilitäts- und Energiewende nur dann, wenn sie mit einer Rohstoffwende einhergehen. Gerade eine „Fortschrittskoalition“ darf vor diesem Hintergrund keine strikten Vorgaben scheuen, die den Rohstoffverbrauch senken, das Recycling verbessern und mittelfristig das Prinzip einer Kreislaufwirtschaft zur Norm erheben.
[1] Vgl. Melanie Müller und Armin Paasch, Wenn nur die Kohle zählt – Deutsche Mitverantwortung für Menschenrechte im südafrikanischen Kohlesektor, www.misereor.de, 4.4.2016.
[2] Arianto Sangadji, Road Challenging the Sustainability of Nickel-based Production for Electric Vehicle Batteries, www.rosalux.de, 1.11.2019.
[3] Brot für die Welt, MISEREOR und PowerShift, Weniger Autos, mehr globale Gerechtigkeit. Warum wir die Mobilitäts- und Rohstoffwende zusammendenken müssen, www.misereor.de, 3.9.2021.
[4] Armin Paasch, Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: Hintergründe, Bewertung und Perspektiven, in: „Zeitschrift für Menschenrechte“, 2/2021, S. 176-195.