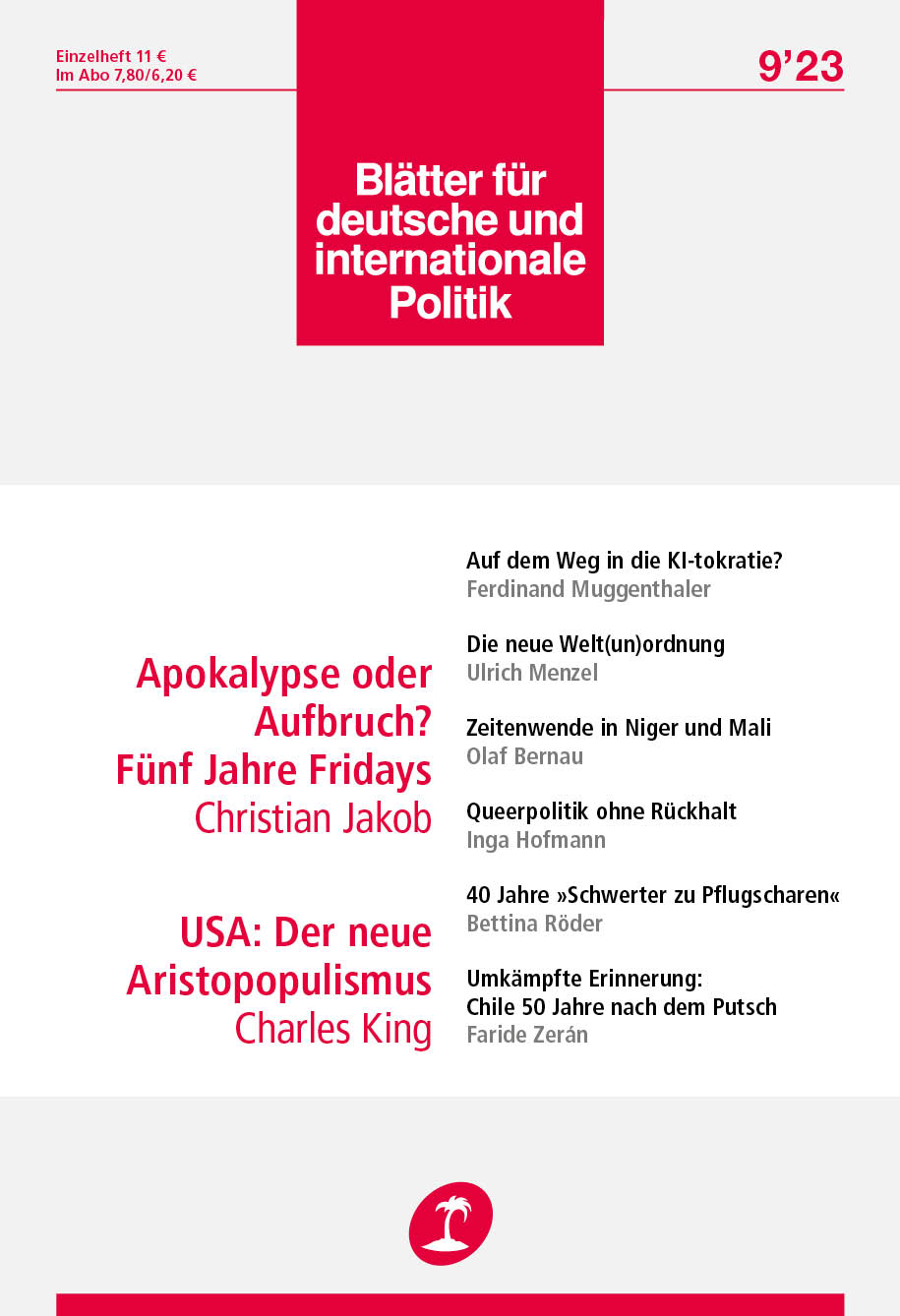Bild: Gegner:innen der Justizreform schwenken Israel-Fahnen bei einer Demonstration in Jerusalem, Israel, 5.7.2023 (IMAGO / ZUMA Wire / Eyal Warshavsky)
Ungeachtet der anhaltenden Massenproteste hat das israelische Parlament ein Kernelement der umstrittenen Justizreform verabschiedet. Es beschloss Ende Juli, die sogenannte Vernunft- oder Angemessenheitsklausel abzuschaffen. Diese gibt dem Obersten Gerichtshof das Recht, Regierungsentscheidungen als unangemessen zurückzuweisen. Jetzt liegt der Ball bei dem Gericht, das seine eigene Entmachtung als unvereinbar mit den Grundprinzipien der Demokratie erklären könnte. Es wird im September das erste Mal über den Beschluss beraten.
Hochrangige Regierungsmitglieder haben schon jetzt bekundet, dass sie ein derartiges Gerichtsurteil nicht respektieren würden. Premierminister Benjamin Netanjahu selbst gibt israelischen Medien keine Interviews; offenbar fühlt er sich nicht verpflichtet, den Bürgern gegenüber Rechenschaft abzulegen. Von ausländischen Sendern lässt er sich umso bereitwilliger interviewen und spielt dabei die Bedeutung der Gesetzesänderung herunter.
Darauf festlegen, dass er die Gerichtsentscheidung akzeptieren wird, will Netanjahu sich nicht. Obwohl das für einen Premier eines Landes, das sich als Rechtsstaat versteht, eigentlich selbstverständlich sein sollte. Aber was ist noch selbstverständlich bei dieser Regierung? Wir mussten uns in den letzten Monaten daran gewöhnen, dass sie völlig irrational agiert. Insofern ist es folgerichtig, dass sie die sogenannte Vernunft- oder Angemessenheitsklausel unbedingt abschaffen will.
Diese Klausel hat für die Demokratie in Israel eine wichtige Funktion. Die Prüfung bezieht sich nicht auf konkrete Rechtsverstöße der Regierung, sondern darauf, ob alle relevanten Faktoren berücksichtigt und angemessen gewichtet wurden. Das Gericht interveniert nur, wenn es eine Entscheidung für „extrem unangemessen“ hält. Salopp gesprochen: Wenn das Gericht zwar den klaren Eindruck hat, dass etwas faul ist und es illegale Motive für eine Entscheidung gibt, dies aber im Detail nicht beweisen kann, dann ist die Angemessenheitsklausel die einzige Möglichkeit einzuschreiten. Bei der aktuellen Regierung ist die Angst sehr begründet, dass sie üble Dinge tut und diese verschleiert, da sie gewohnheitsmäßig Falschinformationen verbreitet. Das Instrument, unvernünftiges Handeln der Regierung oder eines Ministers für illegal zu erklären, ist also dringend nötig.
Deshalb wird die Entscheidung des Gerichts von enormer Bedeutung sein, genauso wie die Reaktion, die darauf folgen wird. Wenn die Regierung das Urteil nicht befolgt, gerät Israel in eine verfassungsrechtliche Sackgasse. Wir können nur hoffen, dass sie nicht so weit gehen wird – auch aus wirtschaftlichen Gründen. Denn wenn sie sich über das Rechtssystem hinwegsetzt, hört Israel auf, ein Rechtsstaat zu sein. Und das hätte zugleich schwerwiegende ökonomische Folgen. Das dürfte Ministerpräsident Netanjahu bewusst sein. Weil wir hier aber über Leute sprechen, die nicht gerade rational handeln, können wir uns keineswegs sicher sein.
Wir können uns auch nicht sicher sein, wie das Gericht entscheidet. Um die Demokratie zu retten, muss das oberste Gericht auch tatsächlich aktiv und kreativ sein – was unseres nicht immer ist. Es neigt stattdessen dazu, konservativ und sehr auf die nahe Zukunft fixiert zu sein. Und wenn in Kürze drei der liberalen und kreativeren Richter, unter ihnen auch die Präsidentin Esther Hayut, in den Ruhestand gehen, wird es noch konservativer werden.
Die Innovationskraft des obersten Gerichts hängt aber auch vom gesellschaftlichen Klima ab. Eine seiner Aufgaben ist der Schutz der Menschenrechte, insbesondere von Minderheiten. Die wichtigste Minderheit, die in Israel geschützt werden muss, ist die arabische. Aber es geht auch um die Rechte der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland und von Geflüchteten. Ein Großteil der israelischen Bevölkerung hat allerdings nicht viel Interesse am Schutz dieser Rechte. Das Gericht hat also eine Agenda, die liberaler und progressiver ist als die Ansichten der Mehrheit der israelischen Öffentlichkeit. Hinzu kommt, dass die Regierung das Gericht seit mindestens zwanzig Jahren auf eine sehr bösartige Weise angreift. Es wird ihm also extrem schwergemacht, die Demokratie zu schützen.
Auch deshalb ist die Hartnäckigkeit der aktuellen Protestbewegung sehr wichtig, auch die der Reservistinnen und Reservisten, die lautstark ihren Freiwilligendienst verweigern angesichts des Abbaus der Demokratie. Hier hat die israelische Gesellschaft ihr schönes Gesicht gezeigt: die Bereitschaft, für die Demokratie zu kämpfen. Und Teil dieses Kampfes sind auch Aufrufe zu zivilem Ungehorsam.
Aber was heißt ziviler Ungehorsam? Ziviler Ungehorsam wird zum Thema, weil das Konzept der „wehrhaften Demokratie“ versagt. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben verschiedene Länder – darunter Deutschland und Israel – dieses Konzept eingeführt. Im Hinterkopf hatte man dabei die spöttischen Äußerungen des Nazi-Propagandisten Joseph Goebbels über die Demokratie als eine Regierungsform, die es ihren Gegnern ermöglicht, sich den Weg zur Herrschaft zu bahnen und sie von innen heraus zu zerstören. Nach dem Prinzip der wehrhaften Demokratie verfügt sie nun über Mittel, um für ihr Überleben zu kämpfen, insbesondere den Ausschluss von politischen Parteien und Kandidaten, die sie negieren. Gleichzeitig führt das Bekenntnis zur Demokratie aber dazu, dass die Disqualifizierung von Parteien und Kandidaten auf die extremsten Fälle reduziert wird.
Wehrlose Demokratie
Wehrhafte Demokratien befinden sich somit in der Zwickmühle eines fast nie angemessenen Timings: Wenn die politische Kraft, von der die Gefahr für die Demokratie ausgeht, noch klein ist, stellt sie vordergründig keine wirkliche Bedrohung dar, aber wenn sie zu einer bedeutenden Kraft wird, kann es bereits zu spät sein, um sie noch aufzuhalten. Die Wahl von Personen wie Itamar Ben-Gvir[1] in die israelische Knesset oder der Einzug der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) in den Deutschen Bundestag hat in diesem Sinne bewiesen, dass die wehrhafte Demokratie nicht funktioniert.
Es ist das Recht und vielleicht auch die Pflicht der Bürger in einem Rechtsstaat, dafür zu sorgen, dass sich ihre Vertreter gesetzeskonform verhalten.
Die Lehre des zivilen Ungehorsams – die in den Vereinigten Staaten entstand und auf Henry David Thoreau im 19. und John Rawls im späteren 20. Jahrhundert zurückgeht – war dagegen nicht darauf ausgerichtet, das demokratische System vor einer möglichen Zerstörung zu bewahren. Ihr Ziel war es, dort Abhilfe zu schaffen, wo ein grundlegender Fehler vorliegt – wie im Fall der Rassentrennung, die in den Vereinigten Staaten praktiziert wurde. Ziviler Ungehorsam in diesem Sinne umfasst gewaltlose Verstöße gegen das Gesetz, die darauf abzielen, andere von der Notwendigkeit zu überzeugen, eine staatliche Ungerechtigkeit zu korrigieren. Aber sie bleiben illegal. Staatstreue und der Rechtsstaatlichkeit verpflichtete Menschen begeben sich damit wissentlich in die Hände der offiziellen staatlichen Stellen, die berechtigt sind, rechtliche Schritte gegen sie einzuleiten. Gleichzeitig besteht die Erwartung, dass die positive Motivation, die sie zur Verweigerung des Gehorsams gegenüber dem Gesetz veranlasst hat, in dem Verfahren gegen sie als mildernder Umstand gewertet wird.
Gerechtfertigter Ungehorsam
In Israel ist heute klar, dass wir uns mit diesem Ansatz nicht begnügen können, um die Demokratie zu verteidigen. Zunächst einmal muss der Begriff „Rechtsbruch“ im Hinblick auf zwei Grundprinzipien einer demokratischen Ordnung genau definiert werden: das Prinzip der Allgemeinen Handlungsfreiheit der Bürger und das Prinzip der Rechtmäßigkeit des staatlichen Handels. Nach diesen Grundsätzen ist es den Bürgern erlaubt, alles zu tun, was nicht verboten ist, während der Staat nur aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung handeln darf. So kann beispielsweise eine Anweisung eines Polizeibeamten an Demonstranten, die ihrem Recht auf Protest widerspricht, rechtswidrig sein. Dann ist es wiederum nicht verpflichtend, ihr Folge zu leisten, und jeder, der ihr nicht gehorcht, ist nicht kriminell.
Man kann sich viele andere Fälle vorstellen, in denen etwas den Anschein hat, legal zu sein, aber in Wirklichkeit illegal ist und daher nicht zur Einhaltung verpflichtet. Dies gilt für sogenannte Bildungsprogramme, die dem nationalen Bildungsgesetz widersprechen – wie die Anweisung, öffentlich kontroverse Themen nicht zu diskutieren –, oder wenn sie die Menschenwürde oder das Recht auf Gleichheit verletzen. Ebenso ist es nicht rechtmäßig, die staatliche Kunstförderung nur zu gewähren, wenn die Künstler die Regierung nicht kritisieren. Wer sich solchen illegalen Anweisungen widersetzt, handelt nicht illegal. Er leistet also genau genommen auch keinen zivilen „Ungehorsam“.
Es ist das Recht und vielleicht auch die Pflicht der Bürger in einem Rechtsstaat, dafür zu sorgen, dass sich ihre Vertreter gesetzeskonform verhalten. Umgekehrt liegt es in der Natur der Regierungsfunktion, dass sie dazu neigt, für sich selbst Befugnisse zu begehren, die über die hinausgehen, mit denen sie gesetzlich ausgestattet ist. Im Fall der aktuellen israelischen Regierung ist der Appetit auf solche Abweichungen grenzenlos. Ein Regime, das sich so verhält, untergräbt die Grundfesten des Rechtsstaates, und die Bürger müssen auf der Einhaltung des Rechts beharren. Das aber reicht in der aktuellen Situation nicht aus. Kurz gesagt: Die Bewahrung der Demokratie könnte Handlungen erfordern, die unter normalen Umständen nicht gerechtfertigt wären.
Die Idee, die dieser Möglichkeit zugrunde liegt, ist die des „rechtfertigenden Notstands“, die auf den deutschen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel zurückgeht. Demnach kann es notwendig sein, ein legitimes Interesse zu opfern, um ein anderes legitimes Interesse zu retten. Dies ist dann der Fall, wenn das zu rettende Interesse erheblich schwerer wiegt, wenn es keine andere vernünftige Möglichkeit gibt, es zu verteidigen, ohne das kollidierende Interesse zu schädigen, und wenn es sich bei den eingesetzten Mitteln um geeignete Mittel handelt.[2]
Unter diesen Bedingungen ist ein Gesetzesbruch gerechtfertigt und zulässig. Wenn es in einer Wohnung brennt und aus dieser Wohnung Hilferufe zu hören sind, darf jeder in die Nachbarwohnungen eindringen und aus ihnen alles mitnehmen, was zur Rettung der Eingeschlossenen beitragen könnte. Diese Handlungen, die normalerweise als illegal angesehen werden, sind durch die besonderen Umstände gerechtfertigt und erlaubt.
Israel auf dem Weg in einen nationalistisch-religiösen Staat
Es ist schwierig, sich das Horrorszenario auszumalen, das sich in Israel abspielen wird, wenn es der Regierung gelingen sollte, ihre Justizreform, die einem Staatsstreich von oben gleicht, auch gegen das Oberste Gericht umzusetzen. In einem solchen Szenario wird ein Regime geschaffen, das über unbegrenzte Möglichkeiten verfügt, um korrupt, willkürlich und tyrannisch zu handeln. Es wird nicht das öffentliche Wohl im Auge haben, sondern das Wohl der Herrschenden, ihrer Mitarbeiter und ihrer Anhänger. Um seine eigene Existenz zu sichern, wird es unter anderem die Rede- und Meinungsfreiheit beseitigen. Diese Maßnahmen werden von der parlamentarischen Mehrheit ergriffen – also unter dem Deckmantel der „Rechtsstaatlichkeit“.
Israel wird ein nationalistisch-religiöser Staat werden, der Gleichheit und Menschenwürde negiert. Er wird diejenigen, die in seinem öffentlichen Dienst kompetent sind, durch unqualifizierte, regimetreue Leute ersetzen. Der Staat wird mit offenen Augen in den Konflikt mit seinen Nachbarn marschieren – und in den diplomatischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Ruin. Ein solches Regime wird eine greifbare Gefahr für Israels Sicherheit und seine Existenz darstellen. Das Ausmaß dieser Gefahr kann bestimmte Gesetzesverstöße rechtfertigen – wie Verkehrsverstöße, die keine Gefahr für Leib und Leben darstellen, verbotene Versammlungen und mehr –, deren Ziel es ist, den Eintritt des Verderbens zu verhindern, sowie auch Verstöße gegen Disziplinarvorschriften, wie das unerlaubte Fernbleiben vom Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst, um an einer Demonstration teilzunehmen.
Damit ein derartiger Rechtsbruch als gerechtfertigt anerkannt werden kann, muss er vier Kriterien erfüllen: Erstens muss er auf die Wahrung der Demokratie abzielen, das heißt, er muss die (als Konservative getarnten) Revolutionäre dazu bringen, von ihren Plänen Abstand zu nehmen. Es muss deutlich gemacht werden, dass deren Schritte nicht legitim sind. Zweitens dürfen die Verstöße gegen das Gesetz keine Gewalt oder Verletzung der Menschenwürde nach sich ziehen.
Drittens sind nur solche Gesetzesverletzungen zulässig, die begangen werden, nachdem die gesetzlich zulässigen Mittel des Protests und des Widerstands ausprobiert wurden und nicht in der Lage waren, die demokratie-zerstörenden Maßnahmen zu verhindern. Viertens schließlich muss der Schaden, der durch die Verstöße entstanden ist, etwa für die Wirtschaft oder die Öffentlichkeit, deutlich geringer sein als der Schaden, der entstanden wäre, wenn die Gesetze nicht verletzt worden wären.
Die Gerichte wiederum sind befugt, die Grenzen des strafrechtlichen und disziplinarischen Verschuldens festzulegen. Sie können beispielsweise in bestimmten Fällen von der Verfolgung von Disziplinarverstößen absehen, wenn sie aufgrund außergewöhnlicher Umstände zustande gekommen sind. Insofern erlebt das israelische Justizsystem gerade zwei historische Prüfungen seiner Demokratietreue: Das oberste Gericht muss seine eigene Entmachtung zurückweisen und die Justiz insgesamt anerkennen, dass Gesetzesbruch zur Verteidigung der Demokratie gerechtfertigt sein kann.
[1] Ben-Gvir wurde 2007 von einem israelischen Gericht wegen rassistischer Aufhetzung und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Seit Dezember 2022 ist er Minister für die Nationale Sicherheit Israels.
[2] Im deutschen Recht ist dieser Rechtsgedanke in Art. 20 Abs. 4 des Grundgesetzes verankert: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“