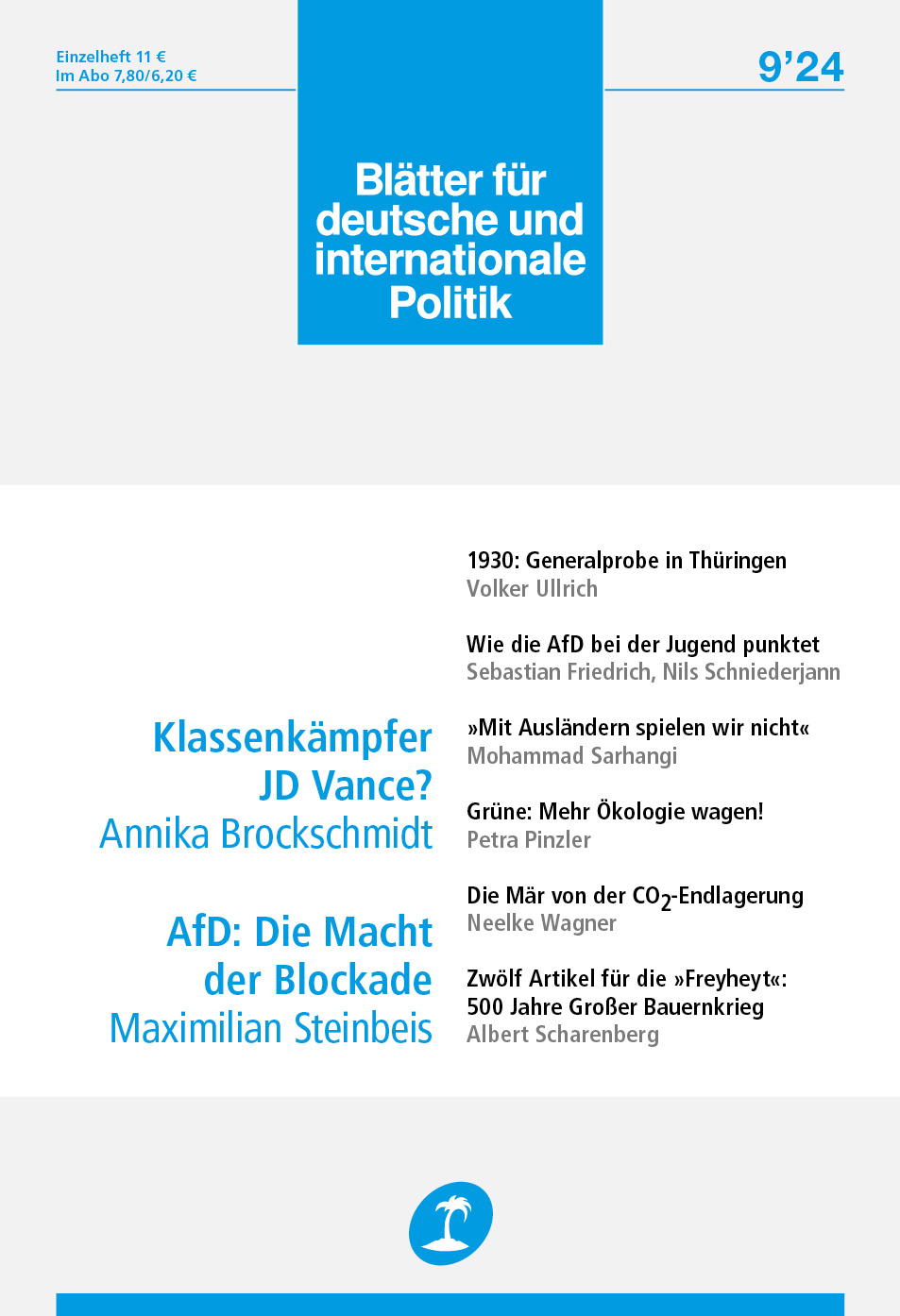Wie sich das Ausgeschlossensein in den Körper einschreibt

Bild: Ein Kind läuft über einen menschenleeren Platz, 22.5.2024 (IMAGO / Rolf Poss)
Im Juni 1986 reisten wir aus der Islamischen Republik Iran in den „Geltungsbereich des Asylverfahrensgesetzes“ ein, wie es auf dem Bescheid des Bundesamts für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFL) steht, der viele Jahre die Wände meiner wechselnden Arbeitszimmer schmückte, bis ich entschied, dass die Zeit gekommen war, ihn abzuhängen. Diesem Dokument ist zu entnehmen, dass meine Eltern im September 1986 „die Anerkennung als Asylberechtigte“ beantragten. Während ihr Antrag im September 1988 bewilligt wurde, lehnte das BAFL meinen Antrag (ich war damals acht Jahre alt) und den meines zweijährigen Bruders ab. Die Ablehnung folgte einer bürokratischen Logik. Unsere „Asylanträge stützen sich“, wie es in dem Bescheid heißt, „auf das Verfolgungsschicksal“ unserer Eltern und erfüllten daher „nicht die Voraussetzungen des Artikels 16 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes“, wonach nur diejenigen asylrechtlichen Schutz genießen, die gemäß der Genfer Konvention vom 28. Juli 1951 „begründete Furcht vor Verfolgung“ aufgrund ihrer „Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe“ oder aufgrund ihrer „politischen Überzeugung“ haben. Mein zweijähriger Bruder und ich verfügten demnach nicht über ein eigenes Verfolgungsschicksal, und daher drohte uns in unserem Herkunftsland auch keine Gefahr für Leib und Leben oder die Beschränkung unserer persönlichen Freiheit. Die Entscheidung im Wortlaut des Bundesamtes: „Da die Anerkennung eines Ausländers als Asylberechtigter stets eine eigene Verfolgung voraussetzt, kann auch die familiäre Verbundenheit der Antragsteller mit ihren Eltern allein nicht zu ihrer Anerkennung als Asylberechtigte führen.“
Was haben meine Eltern gefühlt, als sie diesen Bescheid erhalten haben? Konnten sie ihn verstehen oder mussten sie jemanden bitten, ihn zu übersetzen? Woher wussten sie, dass sie dagegen Einspruch erheben konnten? Was sie dann auch taten. Wir zogen nach Hamburg, wohnten in verschiedenen Unterkünften und warteten auf den neuen Bescheid, der allerdings erst im November 1991 eintraf. Die Klage meiner Eltern hatte Erfolg, meinem Bruder und mir wurde die „Rechtsstellung von Asylberechtigten gewährt“.
Oft erzählte mir mein Vater – an jenen sonnengetränkten Tagen meiner Kindheit, an denen ich ihn auf kürzeren Touren im LKW begleiten durfte –, von den schillernden Abenteuern, die er als Lastwagenfahrer in Iran erlebt hatte, – während ich, gebannt lauschend, in dem riesigen Beifahrersitz versank. Es waren Geschichten von unberührten Landschaften, gastfreundlichen Fremden und filmreifen Schlägereien. Heldengeschichten voller Mut und Verwegenheit. Mein Vater, so schien es mir damals, war der Inbegriff von Furchtlosigkeit und seine Fahrerkabine der Angst fernster Ort. Vielleicht war es aufgrund dieser Erinnerungen für mich so schwer fassbar, als mir mein Vater seine Angst vor deutschen Behörden gestand – und mir von jenen Momenten erzählte, in denen sein Magen bebte, wenn er sich dem Briefkasten näherte. Diese bestimmte Angst kannte er in Iran nicht, erst in Deutschland lernte er sie kennen, erst hier schrieb sie sich allmählich in seinen Körper ein. Emotionen haben immer mit dem Körper zu tun. Sie wirken im Körper, sie wirken auf den Körper, sie werden durch den Körper ausgedrückt. Daher ist Emotionsgeschichte in gewisser Hinsicht immer auch Körpergeschichte.
Meine Eltern verbrachten vier Jahre zwischen Angst und Hoffnung. Die Hoffnung auf ein neues, besseres Leben, vor allem für ihre Kinder, und die Angst davor, dass all ihre Mühen umsonst gewesen sein könnten. Und obwohl die Anerkennung als Asylberechtigte anfangs eine große Erleichterung darstellte, wirkte die Angst fort, denn es bestand die Gefahr, dass wir irgendwann wieder zurückkehren mussten. Angst und Hoffnung begleiten meine Eltern noch heute, obwohl wir alle längst die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben. Mein Vater gestand mir erst kürzlich, dass sein Magen noch immer „bebt“, wenn er den Briefkasten öffnet.
Mein Balkonmoment
Ich kann nicht mehr mit Sicherheit sagen, ob es im Jahr 1987 oder 1988 gewesen ist, als wir – meine Eltern, mein jüngerer Bruder und ich – eine befreundete Familie, die wir bei einem unserer Aufenthalte in diversen Heimen und Unterkünften kennengelernt hatten, in ihrer neuen Wohnung besuchten. Woran ich mich jedoch erinnern kann, ist, dass es ein besonderer Anlass gewesen sein muss. Schließlich gehörte der Auszug aus dem Heim und der darauf folgende Einzug in die erste eigene Wohnung zu den ersten Höhepunkten des Lebens der Eingewanderten. Nach mehr als dreißig Jahren kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie der Tag abgelaufen ist, nur eine Episode hat in meinem Gedächtnis überdauert. Ich muss mich gelangweilt haben. Ich ging die Wohnung ab und landete am Ende auf dem Balkon, der auf einen Spielplatz zeigte, auf dem einige Kinder meines Alters umherliefen und sich amüsiert rauften. Nach kurzem Zaudern fragte ich sie, ob ich mitspielen dürfte. Die Antwort: „Nein, mit Ausländerkindern spielen wir nicht.“
Ich weiß nicht mehr, was ich damals empfunden habe. Vielleicht Scham, Traurigkeit oder Zorn? Was ich jedoch heute sagen kann: Es muss sich um die erste Erfahrung sozialer Exklusion gehandelt haben. Denn mir wurde damals klar, dass mein Anderssein, mein Fremdsein der Grund dafür war, dass ich von einer Aktivität und aus einer Gruppe ausgeschlossen wurde. Es muss eines der ersten Erlebnisse gewesen sein, in denen ich – ob nun bewusst oder unbewusst – eine Verbindung zwischen dem Gefühl der Zurückweisung, des Ausschlusses und dem Begriff „Ausländer“ hergestellt habe. Künftig würde ich in den Spiegel sehen und einen Ausländer erkennen. Didier Eribon würde dieses Erlebnis mit Rückgriff auf Sigmund Freud als „gesellschaftliches Spiegelstadium“ deuten: Bewusstwerdung und „Erkenntnis der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Milieu“.
Der Initiationsritus für »Ausländerkinder«
Diese und ähnliche Erfahrungen sind Teil eines Initiationsritus, den wohl jedes „Ausländerkind“ erlebt. An einem bestimmten Punkt in unserem Leben sagt uns jemand, dass wir anders sind und dass diese Andersartigkeit mit einem großen Makel behaftet ist – so groß, dass andere nicht mit uns spielen oder reden möchten. Ich möchte diese Tatsache vorerst weder bewerten noch normativ einordnen. Viel interessanter und produktiver ist an dieser Stelle die Frage, welche Gefühle aus solchen Erfahrungen entstehen und wie sie sich durch mehrmalige Wiederholung in unseren Körpern festschreiben. Um diese Gefühle und ihren Einfluss auf unseren Habitus ergründen zu können, sind weitere Beispiele nötig. Ich möchte daher ein wenig ausholen und verschiedene Formen sozialer Exklusion zusammentragen und voneinander differenzieren. Beginnen möchte ich mit einer Szene, die mich beim erstmaligen Lesen an die oben geschilderte Balkonepisode erinnerte.
Giorgio Bassanis 1958 veröffentlichter Roman „Die Brille mit dem Goldrand“ handelt von den Erfahrungen eines Arztes aus dem Bürgertum, der aufgrund seiner Homosexualität von der faschistischen Gesellschaft Italiens geächtet wird. Bassanis sensibler, jedoch nicht sentimentaler Erzählstil ermöglicht es den Leser:innen, die Erfahrungen des Protagonisten Doktor Fadigati nachzufühlen. Besonders eine Stelle des Romans ist aufgrund der darin beschriebenen Emotionen noch heute von hoher Relevanz. In dieser Szene sitzt Doktor Fadigati, der gezwungen ist, seine Homosexualität zu verbergen, in einem Zug, in dem sich auch der Erzähler des Romans befindet: „Blickte man im Vorübergehen auf den haltenden Zug, Abteil um Abteil, entdeckte man plötzlich Doktor Fadigati hinter der dicken Fensterscheibe seines Abteils, wie er die Menschen beobachtete, die über die Gleise liefen und auf die Wagen der dritten Klasse zueilten. Nach dem Ausdruck gramvollen Neids in seinem Gesicht, nach den sehnsüchtigen Blicken, mit denen er der kleinen ländlichen Menge, die uns so unerträglich schien, folgte, hätte man auf einen Häftling schließen können: einen prominenten Verbannten auf dem Transport nach Ponza oder Isole Tremiti, wo er wer weiß wie lange bleiben mußte.“ Das Urteil, das die (damalige) Gesellschaft über ihn, seine Liebe und Sexualität gefällt hatte, zwang ihn, seine Liebe geheim zu halten. In Bassanis Roman ist Fadigati dazu verdammt, mit gramvollem Neid und Sehnsucht auf all jene zu blicken, die in ihrer Liebe frei sind.
Habe auch ich damals als Kind vom Balkon aus mit gramvollem Neid und Sehnsucht auf jene Gruppe und Szene geschaut, von der ich ausgeschlossen war? Vermutlich ja, obwohl es nicht meine sexuelle Orientierung war, die mich der Ausgeschlossenheit preisgab, sondern meine ethnische Herkunft. Ich denke jedoch, dass sich die Gefühle – trotz der unterschiedlichen Gründe des Ausschlusses – ähneln oder sogar gleichen.
»Flüchtling« – kein Name für einen Menschen
Wie es sich anfühlt, seine Liebe geheim zu halten, hat auch Bashar Taha erlebt, der 2017 aufgrund seiner Homosexualität aus der Autonomen Region Kurdistan (Irak) nach Deutschland geflohen ist. Taha lebte und studierte Schauspiel und Maskenbild in Dohuk. In seinem Interview für das Archiv der Flucht[1] erzählt Taha, wie er und die Liebe seines Lebens sich zwar offen zeigten, jedoch ihre Liebe füreinander in der Öffentlichkeit geheim hielten bzw. maskierten. Sie lebten zusammen und reisten zusammen, jedoch wurden sie als Brüder oder heterosexuelle Freunde wahrgenommen – und, um sich zu schützen, hielten sie dieses Schauspiel in der Öffentlichkeit aufrecht. In Deutschland lernte Bashar Taha eine andere Form der Exklusion kennen, die ihn nicht nur zu einem anderen Umgang zwang, sondern auch andere Emotionen hervorrief. Auf die Frage seiner Interviewerin Carolin Emcke, was das Etikett „Geflüchteter“ genau für ihn bedeute, erzählt Taha von seinen Schwierigkeiten auf dem deutschen Wohnungs- und Arbeitsmarkt, ohne sich jedoch in eine Opferrolle stecken zu lassen. Was folgt, ist eine differenzierte Betrachtung der Dynamiken von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierungen. „Geflüchteter“ oder „Flüchtling“ führt Taha weiter aus, sei „kein Name für einen Menschen“, sondern nur eine Bezeichnung für die Unterlagen deutscher Behörden.
Wie sich solche und andere Formen der Exklusion auf den Körper des exkludierten und letztendlich diskriminierten Subjekts auswirken, beschreibt Didier Eribon in seinem Buch „Grundlagen eines kritischen Denkens“ anhand einer persönlichen Geschichte. Eines Tages beschließen Eribon und sein Partner, eine eingetragene Lebensgemeinschaft einzugehen. Für die Eintragung müssen sie sich zum Zivilgericht begeben und nicht, wie bei Trauungen üblich, zum Standesamt. Diese Trennung – eine politische Entscheidung – sollte, wie Eribon schreibt, von Beginn an verhindern, dass die eingetragene Lebensgemeinschaft homosexueller Menschen „im Entferntesten an die Ehe erinnert“. In Paris, wo sich in vielen Arrondissements die Zivilgerichte im selben Gebäude befinden wie die Standesämter, betraten Eribon und sein Partner das Gericht, gingen die Gänge entlang, vorbei an einer standesamtlichen Trauung – einer „pompösen Feierlichkeit“, wie Eribon schreibt –, und gelangten schließlich „zu der Abstellkammer“, in der sie empfangen wurden. Dieser Gegensatz war, wie Eribon weiter ausführt, „so krass, dass uns dieses Dekor der zivilen Liturgie auf brutale Weise vergegenwärtigte, worauf wir kein Anrecht hatten und was so viele tapfere Menschen in ihrem Streben, die Zivilisation zu retten, auf ewig vor unseren Ansprüchen schützen wollten. Ich hatte noch nie Gefallen an Zeremonien gefunden und habe mich auch nie nach dem ganzen Hochzeitstheater gesehnt. Doch für einen kurzen Augenblick haben wir beide die ganze Macht der gesellschaftlichen und rechtlichen Exklusion und ihrer Unterdrückungsmechanismen gespürt.“ Diese rechtliche, institutionelle und architektonische Ausgrenzung ließ Eribon „die allgegenwärtige Gewalt der Exklusion spüren“.
Tief in unserem Körper, kaum wahrnehmbar unter unserer Haut
Das Gefühl, ausgeschlossen zu sein (und schon immer ausgeschlossen gewesen zu sein), schreibt sich schon früh, also mit den ersten Erlebnissen der Exklusion, tief in unseren Körper ein. Es schlummert kaum wahrnehmbar unter unserer Haut und wartet auf eine Gelegenheit, um wieder mit Gewalt an die Oberfläche unseres Bewusstseins zu drängen. Dabei kann meist, wie Eribon schreibt, eine „einzige kurze und unerwartete Szene des Alltagslebens […] ausreichen, um all das zu erwecken, was in uns schlummert. Sie kann alle Nervenstränge in unserem Körper zum Vibrieren bringen.“
Eine Erfahrung, die auch Dilek Güngör in ihrem Roman „Ich bin Özlem“ beschreibt. In einem der dramaturgischen Höhepunkte sitzt die titelgebende Hauptfigur Özlem mit ihrem deutschen Mann und ihren deutschen Freund:innen beim Abendessen, als das Gespräch über die angemessene Schule für ihre Kinder in dem Moment entgleist, als sie auf eine „Brennpunktschule“ zu sprechen kommen, in der, wie einer der Freunde erklärt, „80 Prozent der Kinder […] nichtdeutscher Herkunft [sind] und viele aus schwierigen Familien“ stammen. Ein Mann namens Ralf äußert sich am lautesten dazu: „Ja, erst finden es alle ganz klasse, multikulti und so, aber dann, wenn die Kinder in die Schule kommen, ziehen sie weg, dahin, wo die guten Schulen sind.“ Johanna, die gute Freundin Özlems, ergänzt: „Wenn die ganze Klasse nur Arabisch und Türkisch spricht, ist es auch nicht so toll für die Kinder.“
Nur Özlem bleibt stumm und spricht in sich hinein: „Wieso reden meine Freunde so? Wieso reden sie so, wenn ich mit am Tisch sitze? Statt zu fragen, grolle ich stumm in mich hinein. Ich fühle mich wie versteinert. Mir laufen die Tränen über die Wangen, ich bin unfähig, den Mund aufzumachen.“ Die Stimmung kippt vollends, als Özlem versucht, ihre Gedanken und Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Ihre Freunde verlieren die Geduld und fühlen sich angegriffen. Sie seien, so ihre Freunde, schließlich keine Rassisten, und sie, Özlem, würde sich als Opfer inszenieren. Özlem muss sich in diesem Moment wie in Treibsand gefühlt haben: Je mehr sie sich bewegt, je unruhiger sie agiert, desto tiefer versinkt sie. Am Ende bleibt nur vibrierende Resignation. Die Freundschaft zwischen ihr und den anderen kühlt im Laufe des Romans ab. Auch ein erneuter Versuch der Klärung, in dem sich Özlem darum bemüht, ihr Gefühl des Fremdseins offenzulegen, bewirkt letztendlich das Gegenteil: „Ich bin die, die nicht dazugehört, die anders ist, die anders aussieht, anders heißt, 39 bin ich jetzt und fühle mich dennoch wie das kleine Mädchen im Kindergarten, das sich nicht verständlich machen kann und nicht mitspielen darf. Das Angst hat, dass es stinkt.“ Ihre Freundinnen begegnen ihren Erklärungsversuchen mit Unverständnis: „Jeder ist doch unsicher und ängstlich. Das geht jedem von uns so, das hat mit deiner Geschichte gar nichts zu tun.“
Die Scham des Gastarbeiterkindes
Hat es das wirklich nicht? Und können sich die deutschen Freundinnen, die alle weiß und bürgerlich (aufgewachsen) sind, auf die gleiche Weise ausgeschlossen fühlen wie Özlem? Lassen sich ihre Kindheitserlebnisse mit denen Özlems vergleichen? Hatten sie auch ein „Balkonerlebnis“ oder wollten Kinder nicht mit ihnen spielen, weil sie „stinken“? Anstatt sofort auf diese Fragen zu antworten, möchte ich zunächst Özlem bzw. Güngör zu Wort kommen lassen: „Als Kind hatte ich keinen Namen für das Gefühl, das mich quälte. Ich hielt es für Bauchweh. Es macht tatsächlich Bauchschmerzen. Jetzt habe ich Namen dafür, aber Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind große Worte. Die Scham des Gastarbeiterkindes hat einen festen und gut geschützten Platz in meinem Herzen. Manchmal rührt sie sich Tage nicht, und dann macht sie sich unvermittelt breit und verdüstert alles.“
Özlems Freundinnen mögen auch Erfahrungen des Ausschlusses gemacht haben, beispielsweise weil sie nicht sportlich genug waren, nicht die angemessene Kleidung oder eine Brille getragen haben. Und natürlich können solche Exklusionserfahrungen schmerzhaft sein und das Selbst infrage stellen, wie Joan Didion in ihrem Essay „Über Selbstachtung“ festgehalten hat. Darin beschreibt sie, was die Nichtaufnahme in eine Studentinnenverbindung mit ihrem neunzehnjährigen Ich gemacht hat: „Ich verlor die Überzeugung, dass die Ampel für mich immer auf Grün springen würde.“ Didion wuchs mit einer Selbstverständlichkeit auf, mit der wahrscheinlich auch Özlems Freundinnen aufgewachsen sind, die jedoch Özlem selbst, als Kind aus einer mi-grantischen Arbeiterklasse, verwehrt geblieben ist: die Überzeugung, dass die Ampeln für sie immer auf Grün springen würden.
Was unterscheidet die geschilderten Exklusionserfahrungen voneinander? Die einfache Antwort: Diskriminierungsrealitäten. Der kleine Junge auf dem Balkon, das kleine Mädchen im Kindergarten, Fadigati und Eribon, sie alle eint die Erfahrung und die Emotion der Exklusion aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Klasse (hier Arbeiterklasse), ihrer sexuellen Orientierung und ethnischen Herkunft. Im Gegensatz zu Didion und den Freundinnen Özlems wurden sie im Laufe ihres Lebens immer wieder mit verschiedenen Formen der Diskriminierung konfrontiert – einige seit ihrer Kindheit.
Von diesen Erfahrungen erzählt auch die Psychologin Lucía Muriel in ihrem Interview im Archiv der Flucht. Muriel migrierte als Kind mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Anfang der 1970er Jahre aus Ecuador in die DDR. Ihre Erinnerungen ähneln den Erzählungen Özlems: „Ich war das erste, glaube ich, dunkle Kind weit und breit. Man hat wirklich gar keinen Umgang mit mir gefunden. Die Kinder haben sich alle geweigert, mit mir zu spielen. Sie haben alle, auch Erwachsene, überall, überall, ich kann mich wirklich erinnern, überall haben die Leute, auch auf der Straße sind manchmal die Leute stehen geblieben und haben gesagt: ‚Du bist aber schmutzig, geh dich mal waschen.‘ Und ich hab mich immer angeguckt, wo habe ich mich, wo bin ich schmutzig, wo bin ich schmutzig?“
Die Erfahrung und Emotion der Exklusion haben dazu geführt, dass Lucía Muriel als Kind für eine gewisse Zeit ganz damit aufgehört hat, außerhalb der Wohnung zu sprechen. Im Laufe des Interviews wird immer wieder sicht- und hörbar, wie sehr solche Erfahrungen der Ausgrenzung, die mit der Mi-gration einhergehen, Muriel geprägt haben – und welch zentralen Platz die Beschäftigung mit rassistischer Diskriminierung in ihrem Leben eingenommen hat. Es ist die Erfahrung sozialer (gefühlter) Exklusion, und es sind die Gefühle, die von derartigen Erfahrungen geprägt werden, die Lucía Muriel, Özlem und unzählige andere von ihren weißen Freundinnen trennen.
Gefühlswelten der Migration und Exklusion
Die Regeln der Migration prägen und produzieren die Gefühlswelt und das Gefühlswissen von Migrant:innen auf tiefgreifende Weise. Ihre Gefühlswelten werden durch die Erfahrungen der Migration, des Exils, der Fremdheit und der Alltagsdiskriminierung tief geprägt. Gefühle, die wir mit Begriffen wie Verzweiflung, Sehnsucht oder Hoffnung zu beschreiben versuchen, jedoch nicht immer fassen können. Gefühle, die häufig als wiederkehrendes Motiv in den Geschichten von Geflüchteten geschildert werden und in literarischen sowie in filmischen Fiktionalisierungen auftauchen, wie etwa in Philippe Liorets Spielfilm „Welcome“ aus dem Jahr 2009, in welchem ein 17-jähriger kurdischer Junge mit allen Mitteln versucht, nach England zu gelangen, um mit seiner großen Liebe vereint zu sein. Seine verzweifelte Sehnsucht treibt ihn dazu, sein Leben aufs Spiel zu setzen und durch den Ärmelkanal von Calais nach England zu schwimmen.
Einen ähnlichen Zustand beschreibt Tahar Ben Jelloun in seinem Roman „Verlassen“: „Das Land verlassen. Es wurde zu einer Obsession, einer Art Wahn, der ihn Tag und Nacht beschäftigte. Wie sollte er es schaffen, wie der Demütigung entkommen? Weggehen, die Erde verlassen, die ihre Kinder verstößt, diesem schönen Land den Rücken kehren.“ Und in Dadaab, dem größten Flüchtlingslager der Welt, hat die Realität die Fiktion schon längst eingeholt. Dort haben somalische Geflüchtete für ein komplexes Gefühl den Begriff „Buufis“ geprägt. Dieser bezeichnet eine geistige Erschöpfung, mehr noch eine geistige Erkrankung: „Es ist eine Art Depression, die in der unauslöschlichen Hoffnung nach einem Leben anderswo wurzelt und gleichzeitig einen Schatten auf das derzeitige Leben wirft.“ Wie heißt es in Dadaab? Die Erkrankung ist wie HIV, du wirst sie nicht mehr los – ein Leben lang.
Wie wandelt sich dieses Gefühl, wenn sich die Hoffnung auf den ersten Blick erfüllt hat? Wenn sie – wie meine Familie – nach einem quälend langen Verfahren „aufgenommen“ wurden und vielleicht auch den deutschen Pass bekommen haben? Wenn sie also auf der Sachebene inkludiert sind in die deutsche Gesellschaft? Dann setzen sich angesichts der erlebten sozialen Exklusion allzu oft Gefühle wie Schwermut und Zorn in ihren Körpern fest. Dabei kann ein Zorn, der die politischen Kämpfe begleitet, durchaus produktiv sein, wenn er sich mit der Hoffnung verbindet. Zorn kann aber auch ins Ressentiment kippen, gerade wenn er auf erfahrenen Kränkungen basiert.
Kränkungen sind ein Resultat sozialer Exklusion. Unter diesem Begriff lassen sich verschiedene Formen der Ausgrenzung zusammenfassen, wobei zu beachten ist, dass es sich hierbei weniger um eine Ausgrenzung aus der Gesellschaft handelt, sondern vielmehr um eine Ausgrenzung in der Gesellschaft, denn die Ausgegrenzten sind Teil der Gesellschaft, auch wenn sie nicht an ihr teilhaben. Diese Erfahrung machte der Junge, der ich damals war, zum ersten Mal auf dem Balkon der befreundeten Familie. Zu der Erfahrung, als „Ausländerkind“ nicht mitspielen zu können, konstruierte mein Gehirn das dazugehörige Gefühl: „ausgeschlossen, weil ich Ausländer bin“. Diese Emotion schrieb sich mit jeder neuen Erfahrung der Exklusion aufgrund meiner Herkunft tiefer in meinen Körper ein. Die Migrantengruppen im Fokus der Politik, im Fadenkreuz rechter und rechtsextremer Gruppen und Parteien, haben in den vergangenen 60 Jahren viele Bezeichnungen bekommen: „Gastarbeiter“, „Ausländer“, „Türken“, „Muslime“.[2] Mit den Feindbildern entwickelten sich auch meine Erfahrungen und meine Exklusionsgefühle weiter.
So wurde in gewisser Weise aus dem Ausländerkind ein Muslim. Dabei befolge ich keine religiösen Regeln, ich bete nicht. Aber wenn ich gefragt werde, sage ich oft, ich sei Muslim, schließlich bin ich in einer muslimischen Familie aufgewachsen und trage den Namen des Propheten – und einen dichten, dunklen Vollbart. Daran erkennt man doch einen muslimischen Mann, oder? Ich habe gelernt, Muslim zu sein, auch wenn ich es eigentlich nicht bin. Ich habe gelernt, mich angesprochen zu fühlen, wenn von „Muslimen“ gesprochen wird. Ich habe gelernt, mich dieser konstruierten Gruppe zugehörig zu fühlen. Und ich habe gelernt, dass „Muslim sein“ gleichbedeutend ist mit „anders sein“, „Ausländer sein“, „Migrant sein“ – und schließlich: ausgeschlossen zu sein.
Der Text basiert auf „Jahre der Angst, Momente der Hoffnung. Eine Gefühlsgeschichte der Migration“, dem jüngsten Buch des Autors, das soeben im S. Fischer Verlag erschienen ist. Dort finden sich auch ausführliche Quellennachweise.
[1] Beim Archiv der Flucht handelt es sich um ein Oral-History-Projekt zur Geschichte der Flucht und Migration nach Deutschland. Für nähere Informationen siehe: hkw.de/de/programm/projekte/2021/archiv_der_flucht.
[2] Der antimuslimische Rassismus hat seine eigene Emotionsgeschichte, in der starke „Verneinungsgefühle“ wie Zorn, Hass, Ekel und Angst eine große Rolle spielen. Vgl. Uffa Jensen, Zornpolitik, Berlin 2017.