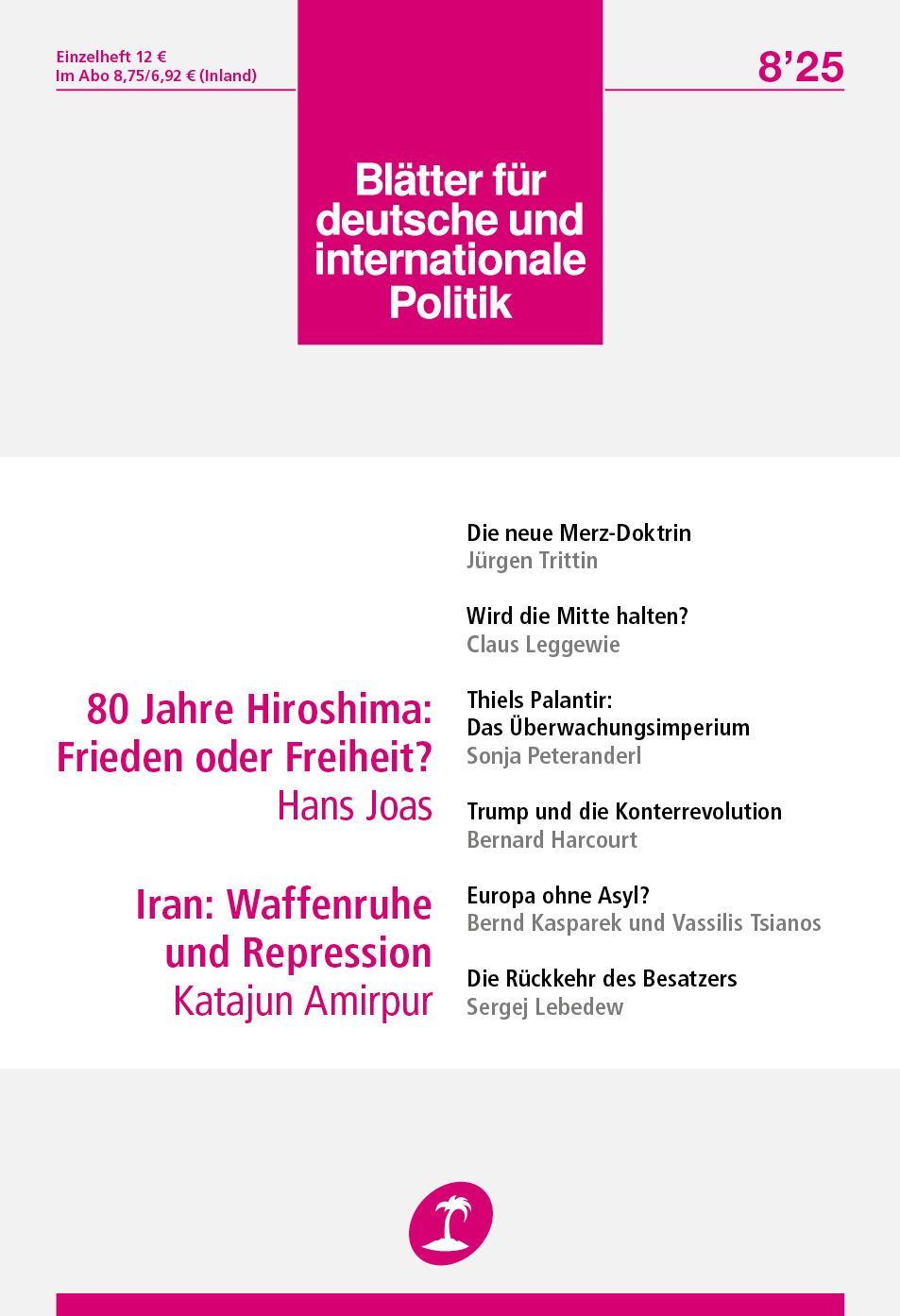Bild: Eine Person demonstriert mit Orbán-Maske auf der Budapester Pride-Parade, 28.6.2025 (IMAGO / TT / Stefan Jerrevang)
Am 28. Juni erlebte Budapest etwas, was Ministerpräsident Viktor Orbán um jeden Preis verhindern wollte: den größten Protestmarsch in der Geschichte Ungarns. Trotz Verbotsgesetz, trotz Androhung von Geldstrafen für die Teilnehmenden, trotz des Einsatzes von Gesichtserkennungstechnologie und trotz einer monatelangen Einschüchterungskampagne strömten die Menschen zu Hunderttausenden auf die Straßen der Hauptstadt. Was als „30. Budapest Pride“ geplant war, verwandelte sich in eine machtvolle Demonstration gegen das autoritäre Regime.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Mindestens 200 000 Menschen nahmen am Pride teil, manche Schätzungen gehen sogar von bis zu 370 000 aus. Zum Vergleich: Die Proteste gegen das Internetsteuergesetz von 2014 brachten etwa 100 000 Menschen auf die Straße, die Demonstrationen von 2017 für die Central European University, die Orbáns Regierung aus politischen Gründen aus dem Land drängte, rund 80 000. Selbst die historischen Massendemonstrationen vom März 1989 mit geschätzten 100 000 bis 150 000 Teilnehmenden, die damals das Ende des realsozialistischen Systems einläuteten, wurden zahlenmäßig deutlich übertroffen.
Was sich am 28. Juni in Budapest ereignete, markiert nichts weniger als einen Wendepunkt. Nach 15 Jahren systematischer Einschüchterung unter der Dauerregentschaft Orbáns und obwohl die regierende Fidesz einen mächtigen Propagandaapparat aufgebaut und sämtliche demokratischen Institutionen unterwandert oder ausgehöhlt hat, zeigt sich nun: Die Angst ist gewichen. Die Menschen haben genug.
Die Symbolkraft dieses Moments kann kaum überschätzt werden. Orbán hatte die Pride zur Nagelprobe seiner Macht erkoren. Im März ließ er ein Gesetz verabschieden, das LGBTIQ+-Demonstrationen unter dem Vorwand des „Kinderschutzes“ verbietet. Teilnehmende können mit Geldstrafen von umgerechnet bis zu 500 Euro belegt werden – das entspricht in Ungarn in etwa zwei Drittel des monatlichen Mindestlohns. Die Polizei erhielt die Befugnis, Gesichtserkennungstechnologie einzusetzen, um die Teilnehmenden zu identifizieren. Es war ein kalkulierter Versuch der Regierung, die sichtbarste und international beachtete Oppositionsveranstaltung des Landes zu ersticken. Doch der Schuss ging spektakulär nach hinten los. Die drakonischen Maßnahmen mobilisierten nicht nur die LGBTIQ+-Community, sondern wurden auch zum Kristallisationspunkt für alle, die unter Orbáns System leiden: Lehrer:innen, deren Gehälter seit Jahren stagnieren; Ärzt:in-nen und Krankenschwestern, die aus dem maroden Gesundheitssystem fliehen; Eltern, die mit ansehen müssen, wie ihre Kinder in zerfallenden Schulgebäuden unterrichtet werden, während das Regime Milliarden Forint in Fußballstadien pumpt.
Die Teilnahme internationaler Gäste – darunter mindestens vier Busse mit Unterstürzer:innen aus Deutschland – verstärkte die Botschaft: Ungarn ist nicht allein. Die Anwesenheit von über 70 EU-Abgeordneten und ausländischen Journalist:innen machte deutlich, dass die Welt zuschaut.
Besonders bemerkenswert war die Rolle von Budapests Oberbürgermeister Gergely Karácsony von der grünen Partei Párbeszéd, dessen plötzliche Entschlossenheit und Kampfbereitschaft selbst seine politischen Verbündeten überraschte.[1] Als die Polizei dem Pride die Genehmigung verweigerte, erklärte er die Veranstaltung kurzerhand zu einem städtischen Event, für das keine Genehmigung erforderlich sei. Orbáns Justizminister drohte ihm daraufhin mit bis zu einem Jahr Gefängnis, doch Karácsony ließ sich nicht einschüchtern. Wenige Tage nach dem Pride erhielt er im Europäischen Parlament minutenlange stehende Ovationen für seinen mutigen Einsatz für Demokratie und Menschenrechte. Er unterstrich auf der Pride nachdrücklich die Bedeutung des Protests über Ungarns Grenzen hinaus und mahnte zugleich die Verantwortung der EU an: „Wenn ein Pride in einem Mitgliedstaat verboten werden kann, dann ist kein Bürger in Europa mehr sicher.“[2]
Die Macht bröckelt
Aktuelle Umfragen bestätigen, was der Pride sichtbar machte: Orbáns Fidesz verliert auf breiter Front.[3] Die neue Oppositionspartei Tisza unter Péter Magyar liegt in manchen Erhebungen bereits 15 Prozentpunkte vor der Regierungspartei.[4] Die Mitte-rechts-Partei um den populären ehemaligen Fidesz-Insider Magyar hatte schon bei den Europawahlen im vergangenen Jahr mit über 29 Prozent aus dem Stand ein gutes Ergebnis erzielt. Magyar war es damals gelungen, die Massenproteste, die sich zu Beginn des Jahres an einem Skandal um sexualisierte Gewalt an Kindern entzündet hatten und in den die obersten Fidesz-Kreise verwickelt waren, in eine Wahlalternative gegen Orbán zu transformieren. Doch entscheidender als die für Tisza günstigen Umfragewerte ist der Erosionsprozess in Orbáns Machtbasis: den ländlichen Gemeinden.
Hier zeigt sich die fatale Schwäche von Orbáns System: Seine Macht beruhte nie primär auf der ideologischen Überzeugung seiner Anhänger:innen, sondern auf einem ausgeklügelten Patronagenetzwerk. Lokale Multiplikator:innen – Ladenbesitzer:innen, Gastwirt:innen, Ärzt:innen, Pastor:innen – wurden mit EU-Geldern bei der Stange gehalten. Doch seit Brüssel Ungarn wegen Verstößen gegen das Rechtsstaatsprinzip den Geldhahn zugedreht hat, funktioniert diese Maschinerie nicht mehr.
Die Parallelen zum Niedergang der Sozialisten (MSZP) zwischen 2007 und 2010 sind frappierend. Damals verlor die MSZP ihre ländliche Basis, weil die lokalen Eliten nicht mehr daran glaubten, dass die Partei die Kontrolle über die Fleischtöpfe behalten würde. Genau das Gleiche geschieht jetzt mit Fidesz.[5] Aktuelle Studien zeigen, dass die Regierungspartei gerade in ihren ehemaligen Hochburgen – den Dörfern und Kleinstädten – dramatisch an Unterstützung verliert und selbst dort von Tisza ein- oder überholt wird.[6]
Der Pride hat auf eindrucksvolle Weise sichtbar gemacht, dass der Würgegriff des Autokraten nicht mehr hält: Wenn das Regime nicht einmal imstande ist, seine eigenen Verbote durchzusetzen, wenn eine Viertelmillion Menschen ungestraft gegen es aufbegehren darf, wer garantiert dann, dass es morgen noch die Pfründe verteilen kann? Die Verunsicherung in den Fidesz-Reihen ist mit Händen zu greifen. Selbst regimetreue Medien konnten die Bilder der Menschenmassen nicht ignorieren. Die schiere Größe der Demonstration vermittelte eine unmissverständliche Botschaft: Der König ist nackt.
Das Ende der Angst
Was bedeutet das für die Parlamentswahl im April 2026? Entscheidend wird sein, wen die Menschen am Vorabend der Wahl als wahrscheinlichen Gewinner erachten. Der Pride hat in dieser Hinsicht das Momentum verschoben. Er hat der Opposition Selbstvertrauen und der Bevölkerung Mut gegeben.
Orbán wird sicher nicht kampflos abtreten. Die Frage ist nicht, ob er zu schmutzigen Tricks greifen wird, sondern zu welchen. Die Optionen reichen von der Verschiebung der Wahl über die Änderung des Wahlrechts bis zum administrativen Ausschluss der Opposition. Selbst Moskauer Methoden – inszenierte Anschläge, gekaufte Provokateur:innen, gefälschte Flüchtlingswellen – sind nicht auszuschließen.
Aber auch hier hat der Pride eine klare Botschaft gesendet: Die Zeit der Angst ist vorbei. Orbán mag die Wahl manipulieren können, aber er kann nicht mehr darauf zählen, dass die Menschen es schweigend hinnehmen werden. Der Geist ist aus der Flasche. Wer eine Viertelmillion Menschen auf die Straße bringt, obwohl Gesichtserkennung und Geldstrafen drohen, der hat eine kritische Masse mobilisiert, die sich nicht mehr einschüchtern lässt.
Die Geschichte lehrt uns, dass autoritäre Regime genau dann am gefährlichsten sind, wenn sie schwach werden. Doch sie lehrt uns auch, dass ihr Sturz oft schneller kommt als erwartet. Slobodan Miloševic´ schien 1999 in Belgrad noch fest im Sattel zu sitzen, ein Jahr später war er Geschichte. Viktor Janukowitsch musste 2014 Hals über Kopf aus Kiew fliehen. Nicolae Ceausescu tanzte noch Ende November 1989 auf dem Parteitag der Rumänischen Kommunistischen Partei, einen Monat später war er tot.
Orbán kennt diese Ereignisse. Er weiß, dass die Alternative zu einem geordneten Machtwechsel das Chaos ist. Der Pride hat ihm vor Augen geführt, dass er sich zwar noch zwischen beiden Optionen entscheiden kann – aber nicht mehr lange. Die schiere Masse der Demonstrant:innen, ihre Entschlossenheit und die breite gesellschaftliche Unterstützung zeigen: Dies ist keine Bewegung, die sich noch unterdrücken ließe.
Was in Budapest geschah, strahlt damit weit über Ungarns Grenzen hinaus. In einer Zeit, in der autoritäre Bewegungen weltweit auf dem Vormarsch sind, in der Donald Trump zurück im Weißen Haus ist und rechtspopulistische Parteien in ganz Europa Erfolge feiern, sendet der ungarische Widerstand ein kraftvolles Signal: Der Kampf ist nicht verloren.
Die mutigen Menschen, die am 28. Juni durch Budapest zogen, haben gezeigt, dass Solidarität stärker ist als Spaltung, dass Liebe mächtiger ist als Hass, dass Freiheit sich nicht dauerhaft unterdrücken lässt. Sie haben bewiesen, dass selbst das ausgefeilteste Überwachungssystem, die perfideste Propaganda und brutale Einschüchterung an ihre Grenzen stoßen, wenn Menschen gemeinsam für ihre Würde einstehen. Für die demokratischen Kräfte in den USA, in der Türkei, in Indien und überall dort, wo Autokrat:innen die Macht an sich reißen, kann jener Tag in Budapest als ein Leuchtfeuer der Hoffnung dienen.
Für Ungarn selbst bedeutet der Erfolg des 28. Juni einen Moment kollektiver Katharsis. Zum ersten Mal seit Jahren spürten die Menschen wieder ihre eigene Macht. Die Bilder erinnerten viele unweigerlich an 1989, als die Ungar:innen das kommunistische Regime hinwegfegten. Doch während damals die Hoffnung auf eine bessere Zukunft die Menschen antrieb, ist es heute der Zorn über eine gestohlene Gegenwart. Orbán, der einst als junger Aktivist auf dem Budapester Heldenplatz die Sowjets zum Abzug aufforderte, ist selbst zum Diktator geworden, gegen den sich das Volk erhebt.
Orbáns Zeit läuft ab
Orbán hat einen fatalen Fehler begangen. Er dachte, die Gesellschaft so weit eingeschüchtert und gespalten zu haben, dass er ungestraft selbst fundamentale Rechte angreifen kann. Die Pride hat diese Illusion zerschlagen. Der politische Instinkt, für den Orbán so oft gelobt wird, hat ihn offenbar verlassen. Er glaubte, mit dem Kulturkampf gegen die Pride die Opposition spalten zu können. Sein Kalkül war simpel: Magyar sollte zum Bekenntnis für oder gegen die Veranstaltung gezwungen werden und dadurch entweder seine progressiven oder seine konservativen Unterstützer:innen verprellen.
Doch Magyar wich dieser Falle geschickt aus. Bis zum Schluss äußerte er sich nicht direkt zur Pride. Erst am Tag des Marsches veröffentlichte er einen vorsichtig formulierten Social-Media-Post – ohne die Veranstaltung oder LGBTIQ+-Rechte zu erwähnen. Stattdessen schrieb er allgemein: „Wir bauen gemeinsam ein Land für alle Ungarn, in dem es keine Rolle spielt, aus welcher Familie jemand stammt, woran er glaubt und wen er liebt.“ Und er rief die Polizei auf, „alle ungarischen Staatsbürger vor der Willkür der gefallenen Macht zu schützen”. Die Botschaft war klar genug für seine progressiven Unterstützer:innen, aber vage genug, um konservative Wähler:innen nicht zu verschrecken.
Die meisten, die am 28. Juni durch Budapest gezogen sind, verstehen die politische Arithmetik: Bei den Wahlen 2026 ist das Kreuz für Tisza das taktisch einzig Richtige, um das Regime loszuwerden.
Hier zeigt sich, dass Orbán keineswegs der unbezwingbare politische Mastermind ist, als der er oft dargestellt wird. Seine Stärke speiste sich schon immer aus der Schwäche seiner Gegner:innen. Jetzt, wo es eine oppositionelle Kraft gibt, hinter der sich alle versammeln können, die ihn loswerden wollen, versagen seine altbewährten Rezepte. Orbán und die gesamte Fidesz-Machtmaschinerie agieren zusehends im Panikmodus.
Die Tage seiner Herrschaft sind gezählt – nicht weil Brüssel es so will, nicht weil die Opposition plötzlich geeint wäre, sondern weil die Menschen in Ungarn genug haben. Sie haben genug von der Korruption, genug von der Hetze, genug von einem System, das ihre Kinder in marode Schulen zwingt, während es Milliarden in die Taschen der Oligarchen schaufelt – und in die der Familie Orbán.[7]
Der 28. Juni 2025 wird als Wendepunkt in die ungarische Geschichte eingehen – als der Tag, an dem das ungarische Volk Nein sagte. Nein zu Orbán, Nein zur Angst, Nein zur Unterdrückung. Mit einer Viertelmillion Menschen auf den Straßen Budapests begann der Countdown für das Ende des Orbán-Regimes. Die Regenbogenfahnen, die an diesem Tag über Budapest wehten, künden von einem möglichen neuen Morgen.
Orbán mag noch im Amt sein, aber seine Zeit läuft ab. Der Pride, den er zerschlagen wollte, ist der erste große Erfolg für jene Ungar:innen, die ihn zu Fall bringen wollen. Vielleicht können wir schon im nächsten Frühjahr sagen: Die Geschichte hat ihr Urteil gesprochen – in den Farben des Regenbogens.
[1] Vgl. „Das war ein historischer Moment“: Ungarns Bürgermeister Karácsony über die Budapest Pride, taz.de, 4.7.2025.
[2] Bódog Bálint, Karácsony Gergely: „Vagy együtt vagyunk szabadok, vagy egyikünk sem az”, 444.hu, 28.6.2025.
[3] Zsuzsanna Végh, Will Fidesz Stop Tisza’s Tide? The year ahead Hungary’s 2026 parliamentary election, gssc.lt, 22.5.2025.
[4] Vgl. Tisza ahead of Fidesz by 15 percentage points among decided voters, telex.hu, 18.6.2025.
[5] Vgl. New opposition party takes a page out of Orban‘s playbook to build rural network, english.atlatszo.hu, 23.1.2025.
[6] Vgl. Minden településtípusban visszaszorult a Fidesz 2019-hez képest, 24.hu, 1.7.2025.
[7] András Petho, Kamilla Marton und Dániel Szoke, „The Dynasty“ – here is Direkt36’s documentary about the economic empire of the Orbán family, direkt36.hu, 7.2.2025.