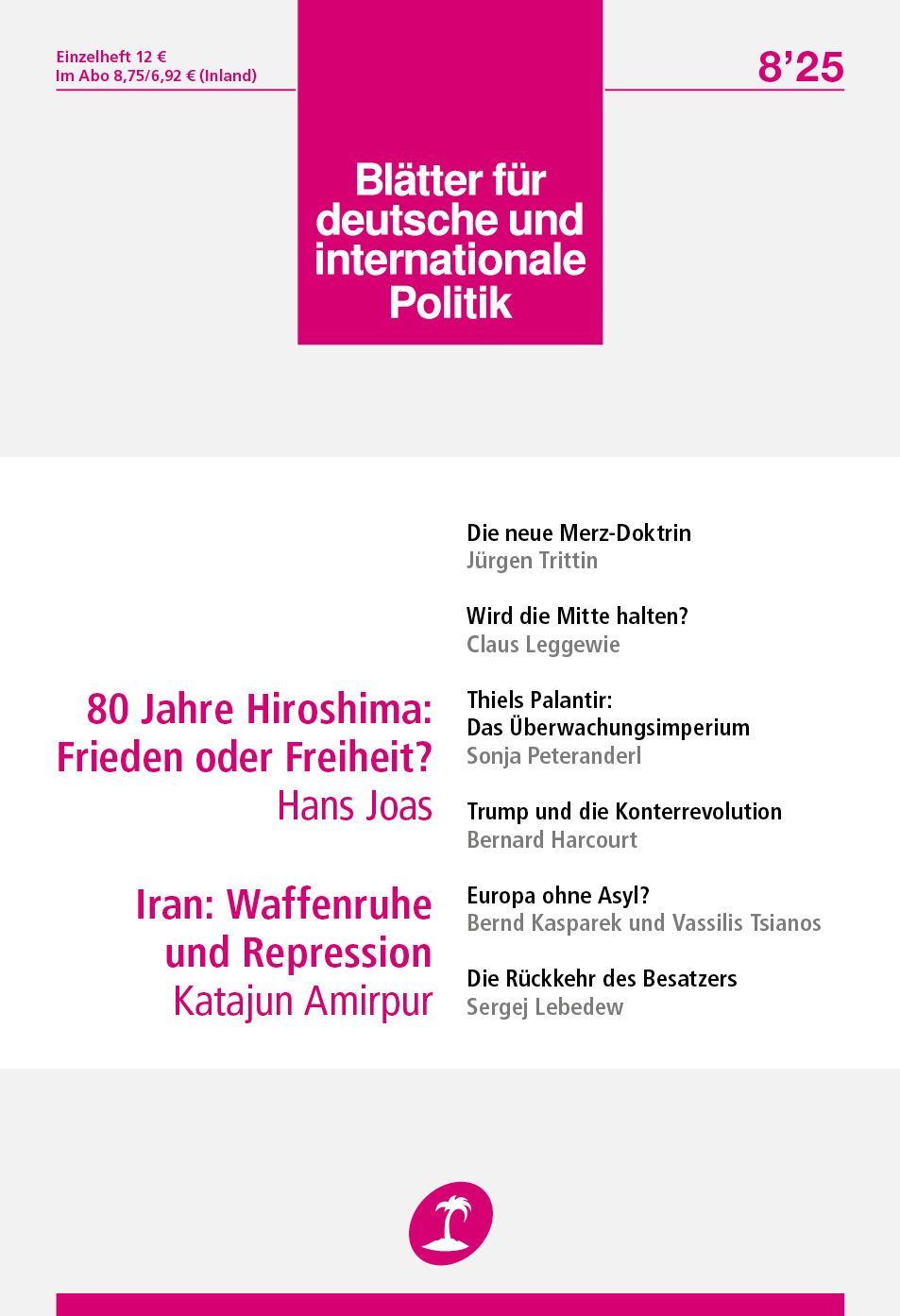Wie der Westen die iranische Opposition allein lässt
![Iranische Journalisten vor einem Gebäude des Evin-Gefängnisses, das bei israelischen Angriffen zerstört wurde. Das Gefängnis ist für die Inhaftierung[2] und Hinrichtung politischer Gefangener Irans berüchtigt. Foto vom 1.7.2025 (IMAGO / NurPhoto / Morteza Nikoubazl) Iranische Journalisten vor einem Gebäude des Evin-Gefängnisses, das bei israelischen Angriffen zerstört wurde. Das Gefängnis ist für die Inhaftierung[2] und Hinrichtung politischer Gefangener Irans berüchtigt. Foto vom 1.7.2025 (IMAGO / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)](/sites/default/files/styles/article_mainimage/public/images/2025/07/amirpur-iran-evin-opposition.jpg?itok=sTf6Fu-Z)
Bild: Iranische Journalisten vor einem Gebäude des Evin-Gefängnisses, das bei israelischen Angriffen zerstört wurde. Das Gefängnis ist für die Inhaftierung[2] und Hinrichtung politischer Gefangener Irans berüchtigt. Foto vom 1.7.2025 (IMAGO / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)
Die Schadenfreude in der iranischen Bevölkerung über die Tötung einiger verhasster Anführer der Revolutionsgarden währte nur kurz. Denn als Israel am 13. Juni unter dem Codenamen Operation Rising Lion Anlagen des iranischen Atomprogramms, militärische Einrichtungen und hochrangige Kommandeure der iranischen Militärführung angriff, wurde schnell klar: Benjamin Netanjahu hielt nicht, was er versprochen hatte. Er hatte erklärt, die israelische Offensive richte sich nicht gegen Irans Bevölkerung, sondern gegen das Regime. Doch schon bald gab es Berichte über zivile Opfer, kurz danach tauchten Videos auf. Eines zeigte Raketen, die an einer Straßenkreuzung in Teheran einschlugen. Auf dem Tajrish-Platz im Norden der Stadt zerstörte eine Bombe die Wasserleitung; die austretenden Wassermassen schwemmten Menschen den Berg hinunter. Zu den bekanntesten Opfern der ersten Stunden zählte Parnia Abbassi, eine Dichterin der „Generation Z“, aus der sich die Protestbewegung „Frau, Leben, Freiheit“ speist, die das iranische Regime existenziell herausfordert. Dementsprechend schnell machte die Nachricht von ihrem Tod auf Social Media die Runde. Und entsprechend perfide und zynisch wirkte es in Iran, dass Netanjahu den Slogan der Protestbewegung kaperte, indem er diesen auf Persisch in ein Mikrofon posaunte.
Zwar hält die am 26. Juni ausgerufene Waffenruhe bislang, aber es bleibt unklar, wie stark das Atomwaffenprogramm Irans getroffen wurde. Ungewiss ist auch, wie eine dauerhafte Verhandlungslösung erreicht werden kann. Klar ist hingegen, dass Netanjahu der Opposition in Iran einen Bärendienst erwiesen hat. Glaubte er wirklich, die Menschen würden auf die Straße gehen, um ihr Regime zu stürzen, wenn sie dabei Gefahr laufen, dass ihnen Bomben auf den Kopf fallen? Setzte er auf den im amerikanischen Exil lebenden Sohn des letzten Schahs, Reza Pahlavi, der sich laut Medienberichten in jüngster Zeit häufig mit israelischen Regierungskreisen getroffen hatte? Auch Pahlavi rief jedenfalls zum Aufstand auf, als die Raketen in Iran einschlugen.
Sicher, angesichts der Tatsache, dass man mit der Revolution 1978/79, die seinen Vater gestürzt hatte, vom Regen in die Traufe gekommen war, werden zuweilen auch in Iran selbst wieder „Hoch lebe der Schah“-Rufe laut.[1] Doch über eine Anhängerschaft verfügt Pahlavi vor allem im Ausland, wo die Monarchist:innen eine gut geölte PR-Maschinerie betreiben. In Iran selbst erinnert man sich hingegen deutlich besser daran, dass die Revolution durchaus aus gutem Grund stattgefunden hat, nämlich um die Diktatur seines Vaters zu beseitigen. Von dieser hat sich der Sohn, der sich gern auch Reza Pahlavi II. nennen lässt, nie klar distanziert. Pahlavis ohnehin geringfügiger Rückhalt ist in Iran vermutlich noch weiter geschwunden, als er Israel verteidigte, anstatt die Bombardements zu verurteilen, die über tausend Menschen das Leben kosteten. Sehr plausibel scheinen die Sätze der monarchistischen Iran-Novin-Partei zumindest nicht, die nach den Angriffen schrieb: „Israel hat sehr präzise das Regime geschwächt. Dies ist eine große Unterstützung auf unserem Weg in die Freiheit. Dafür danken wir.“ Nicht bedankt haben sich dagegen die politischen Gefangenen des Evin-Gefängnisses, die nach einem israelischen Angriff unter demütigenden Bedingungen auf andere, noch schlimmere Gefängnisse der Stadt verteilt worden sind. Unter ihnen befand sich auch Reza Khandan, einer der bekanntesten Menschenrechtler des Landes, der nach seiner Verlegung schrieb: „Hier haben wir nicht mal sauberes Wasser.“ Als die Zerschlagung eines Biotops des Widerstandes bezeichnete Omid Nouripour, Vize-Präsident des Bundestages, diesen Vorgang.
Bomben und lauwarme Worte statt Cash und sichere Kommunikation
Die Forderung der Monarchist:innen und anderer, man dürfe mit dem Regime nicht reden, weil es nicht vertrauenswürdig sei, ist politisch naiv. Sicher, man möchte sich lieber die Hand abhacken, als diese blutbesudelten Hände zu schütteln. Aber Verträge werden nicht gemacht, weil man dem Gegenüber vertraut. Im Gegenteil, sie werden geschlossen und mit Drohungen und Anreizen begleitet, weil man sich eben nicht vertraut. Zugleich war schon immer klar, dass nur Bombardements bleiben würden, wenn das iranische Atomprogramm nicht durch Verträge und Kontrollen der IAEA eingehegt werden kann. Das gilt auch jetzt noch. Schließlich haben Israel und die USA das Programm nicht vernichtet, sondern nur verzögert. Nie verfolgt wurde dagegen die dritte Möglichkeit: nämlich die Protestbewegung so zu unterstützen, dass sie es schafft, das verhasste Regime von innen heraus zu stürzen und dann eine Regierung zu bilden, die Israel nicht bedroht. Stattdessen gab es für sie nur lauwarme Worte, auch aus Berlin, auch als dort mit Annalena Baerbock die Vertreterin einer vorgeblich feministischen Außenpolitik Deutschland repräsentierte. Dabei hatte die iranische Zivilgesellschaft deutlich formuliert, welche Unterstützung sie aus dem Westen erwartet, um dieses Regime stürzen zu können. Sie forderte beispielsweise, die Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen. Ein solcher Schritt mag zwar nur symbolisch sein, aber Symbolpolitik signalisiert eben eine Haltung und an einer klaren Haltung gegenüber dem iranischen Regime hat es der Bundesregierung immer gemangelt. Aufgrund ihrer israelfreundlichen Staatsräson hat sie sich in den Verhandlungen mit Iran, die 2015 in den Joint Comprehensive Plan of Action mündeten, zusammen mit Frankreich und Großbritannien sowie China, den USA und Indien darauf konzentriert, dass Iran keine Atomwaffen haben darf, da diese Israel bedrohen und nebenbei zu einem gefährlichen Wettrüsten in der Region führen würden. Soweit, so richtig. Dass dieses Abkommen Israel nicht wirklich schützte, weil es das ballistische Raketenprogramm Irans außer Acht ließ, war das Argument des damaligen US-Präsidenten Donald Trump, als er es 2018 einseitig aufkündigte. Auf gewisse Weise hatte er tatsächlich recht: Dieses Abkommen hatte wesentliche Fragen nicht einmal gestreift. Nur traf das auch auf den neuen Deal zu, den Trump abschließen wollte. Auch dieser ließ das Raketenprogramm Irans außen vor.
Vor allem jedoch wurde in Trumps Verhandlungen – wie auch in allen anderen zuvor, einschließlich dem sogenannten kritischen Dialog der Bundesregierung in den 1990er Jahren – die Frage der Menschenrechte in Iran ausgespart. Das ist der gewichtigste Vorwurf der iranischen Zivilgesellschaft. Eine weitere, nicht erfüllte Forderung der Protestbewegung an unsere Regierungen, die vielleicht zum Ziel hätte führen können, ist die nach Cash und VPNs. Cash meint: Wege zu schaffen, dass Geld nach Iran überwiesen werden kann. Zurzeit ist das nicht möglich, weil das Land vom internationalen Bankensystem ausgeschlossen ist. Dabei wären viele der acht Millionen Iraner:innen im Ausland, von denen viele vermögend, manche sogar sehr vermögend sind, nur zu gerne bereit, die Streikkassen der iranischen Protestbewegung zu füllen. Für sie hätte man Umwege schaffen können. Denn nur Streiks können das Regime wirklich in die Enge treiben. VPN, Virtual Privat Networks, sind wiederum zur sicheren Kommunikation im Internet und zur Umgehung geografischer Beschränkungen nötig, damit die Protestbewegung kommunizieren kann. In Iran wird das Internet gewohnheitsmäßig lahmgelegt, wenn es zu Protestwellen kommt. Mit VPN ließen sich diese Blockaden umgehen. Elon Musk hatte dazu für einen kurzen Moment ein paar gute Ideen, wie er mit seinem Satellitennetzwerk Starlink dazu hätte beitragen können.
Ein demokratischer Iran ist keine Bedrohung für Israel
Auch der deutschen Politik sollte klar sein, dass letztlich nur ein komplett anderes Regime Israels Sicherheit nachhaltig gewährleisten würde. Aus einer inneriranischen Perspektive heraus muss dieses Regime allerdings nicht nur deswegen verschwinden, weil es Israels Sicherheit bedroht. Die Menschen in Iran würden gerne hören, dass sich die Welt auch um sie sorgt. Stattdessen befürchteten sie schon zu Beginn der israelischen Angriffe, am Ende mit dem Terrorregime wieder alleingelassen zu werden. Tatsächlich könnte es ihnen so ergehen wie 1991 der Bevölkerung in Irak. Dieser hatte George W. Bush damals versprochen, an ihrer Seite zu stehen, wenn sie sich gegen Saddam Hussein erheben würde. Das tat sie, doch der US-Präsident überlegte es sich anders, und Hussein nutzte die Gelegenheit, um seine Bevölkerung abzuschlachten. Ähnliches sehen wir heute in Iran. Am ersten Tag der Waffenruhe ging eine Karikatur viral, die Irans mächtigsten Mann, Ajatollah Ali Khamenei, zeigt, wie er aus einem Erdloch kriecht. Er fragt: „Waffenruhe?“ Die Antwort: „Ja.“ Er erwidert: „Gut, dann los, holt sie euch.“ Und sie holen sie sich: Omid Rezaee hat für „Die Zeit“[2] nachgezeichnet, wie das Regime nun vor allem auf die iranischen Juden und die Bahais losgeht. Die Juden gelten quasi automatisch als Spione Israels, obwohl die noch etwa 10 000 Mitglieder zählende Gemeinde sich auch jetzt, wie schon immer, verzweifelt bemüht, Loyalität mit Iran zu zeigen, indem sie Kritik am zionistischen Gebilde übt, wie Israel im offiziellen Sprech in Iran heißt. Da aber vermutlich jede Jüdin und jeder Jude in Iran Verwandte unter den rund 250 000 iranischstämmigen Israelis hat, bestehen natürlich Kontakte in das Land. Und genau die werden vielen jetzt zum Verhängnis.
Die Bahais, Anhänger einer Religion, die im 19. Jahrhundert aus dem schiitischen Islam entstand, trifft es noch stärker. Sie sind ohnehin verfolgt und gelten nicht als religiöse Minderheit, sondern als politische Sekte. Dass ihr religiöses Zentrum im israelischen Haifa liegt, macht es doppelt leicht, sie als Spione zu brandmarken. Neben den Bahais und Juden verfolgt das Regime nun auch wieder verstärkt Kurden und Belutschen, die man des Separatismus verdächtigt und ihnen deshalb unterstellt, sie seien offen für Einflussnahme von außen. Doch auch gegen Frauen, die ihr Kopftuch nicht vorschriftsmäßig tragen, wird wieder verstärkt vorgegangen. 900 Personen wurden in den ersten Wochen der Waffenruhe festgenommen. Zugleich wird gerade das Spionagegesetz überarbeitet, um Menschen noch leichter als bisher der Spionage für Israel bezichtigen und sie unter dem Anklagepunkt „Krieg gegen Gott“ zum Tode verurteilen zu können.
Für die iranische Zivilgesellschaft wirkt es wie die Wiederholung der traumatischen Ereignisse von 1988. Damals, am Ende des iranisch-irakischen Krieges, wurden innerhalb weniger Tage 8000 politische Häftlinge hingerichtet. Auch deshalb schrieb Nargess Mohammadi, die Friedensnobelpreisträgerin des Jahres 2023, schon in den ersten Tagen der Angriffe zusammen mit den bekannten Regisseuren Mohammad Rasoulof und Jafar Panahi: „Krieg hilft uns nicht.“ Mit Rasoulofs Film „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ war Deutschland dieses Jahr angetreten, um den Oscar für den besten internationalen Film zu gewinnen. Darin erzählt der Regisseur die Geschichte einer Familie, deren Vater als Richter arbeitet, während die Töchter sich der „Frau, Leben, Freiheit“-Bewegung anschließen. Fast interessanter noch als der Film ist die Geschichte, wie der Regisseur auf die Idee für den Film kam. Er saß – wieder einmal – im Gefängnis und einer der Wärter sagte zu ihm: „Danke, dass Sie uns in Ihrem Film ‚Das Böse gibt es nicht‘ so porträtiert haben, wie Sie es getan haben. Sie zeigen, dass auch wir in diesem System gefangen sind, aber eigentlich raus wollen.“ Der Wärter habe ihm dann erzählt, so Rasoulof, dass seine Töchter ihn jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit fragen: „Wie kannst Du nur für dieses System arbeiten? Wie kannst Du die unterstützen, die uns die Zukunft rauben?“ Er würde sich am liebsten jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit selbst erschießen, fügte der Wärter hinzu. Das sind die Risse im System, die man nicht quantifizieren, sondern nur erspüren kann. Es gibt natürlich keine Erhebungen dazu, aber schon in seinem nach den Protesten 2009 entstandenen Film „Green Wave“ bekam Ali Ahadi Samadi einige Bassidschi vor die Kamera. Und diese Milizionäre, deren Aufgabe es ist, Protestierende niederzuknüppeln, sagten dem Regisseur: „Wir wollen das nicht mehr tun.“ Solche Aussteiger gab es in den vergangenen Jahren immer mehr, Menschen, die nicht länger auf die eigenen Landsleute einschlagen und sie nicht mehr ins Gefängnis bringen wollen.
Kluge Politik muss den iranischen Nationalstolz einkalkulieren
Ob sich jetzt die Risse ausweiten oder ob sich die Reihen des Regimes eher schließen, wird von Expert:innen sehr unterschiedlich bewertet. Was es jedenfalls nicht gab, war ein allgemeines rally around the flag, ein Versammeln um die Flagge der Islamischen Republik, das einige vorhergesagt hatten. Diese Flagge wollen die meisten Iraner:innen auch jetzt nicht hochhalten. Was es dagegen gibt, ist ein „Versammeln“ um die Nationalfarben – grün, weiß und rot – und um die Landkarte Irans, deren Umrisse an eine liegende Perserkatze erinnern. Deren Krallen werden in solchen Fällen ausgefahren. Denn so verhasst die eigene Regierung auch sein mag, noch verhasster ist arrogante Einmischung von außen. In dem Selbstbild, das sich in diesen Symbolen zeigt, geht es zuvorderst um Unabhängigkeit. Spätestens seit dem sogenannten Tabakboykott im Jahr 1891 ist der iranische Patriotismus von einer starken antiimperialistischen Stoßrichtung geprägt: Aus Protest gegen eine Tabaklizenz, die der Schah den Briten gegeben hatte, hörte damals fast das ganze Land auf zu rauchen – inklusive der Frauen des Schahs. Und so musste dieser die als „Kapitulation“ empfundene Lizenz zurücknehmen. Die Iraner:innen sind stolz darauf, dass die Grenzen ihres Landes nicht von Kolonialstaaten wie Frankreich und England gezogen wurden. Der heutige Nationalstaat Iran geht zurück auf das Großreich der Perser, wie es in Deutschland genannt wird. Aus dieser jahrtausendealten Geschichte speist sich ein bisweilen durchaus unangenehmer Chauvinismus. Im Selbstbild von uns Iraner:innen lebte Gott nicht in Frankreich, sondern in Iran: Denn wir kochen den besten Reis, unsere Küche ist die feinste, wir haben die schönste Sprache der Welt, die prächtigsten Moscheen, großartige vorislamische Architektur und der persische König Kyros hat 539 v. Chr. der Welt die erste Charta der Menschenrechte gegeben, in der festgehalten ist, dass alle Menschen das Recht haben, ihre Religion frei zu wählen und zu leben. Unser Kino ist so gut, dass Deutschland mit unserem Film ins Oscar-Rennen geht. Und schon Goethe hat gesagt, dass er in Hafez, unserem Nationaldichter, seinen Meister gefunden hat.
Eine kluge Politik muss mit diesem Nationalstolz rechnen und darf die Bevölkerung nicht indirekt als Dreck bezeichnen. Eine Rhetorik, die Angriffe, die auch die Zivilbevölkerung treffen, als „Drecksarbeit“ bezeichnet, ist für viele Iraner:innen unerträglich. Dutzende prominente iranischstämmige Deutsche haben deswegen gegen Bundeskanzler Friedrich Merz Strafanzeige erstattet. Auch Regimegegner nehmen die westliche Politik seit Jahrzehnten als schlecht wahr, genauer seit dem Jahr 1953, als die USA den Putsch gegen den einzig wirklich demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Irans, Mohammad Mossadegh, einfädelten.[3] Im Anschluss errichtete der wieder eingesetzte Schah sein Terrorregime. Das war der Sündenfall westlicher Iranpolitik, der letztlich zur Revolution von 1978/79 führte, denn diese war weit mehr antiimperialistisch denn islamisch.
Wer diese nationalen Traumata bei der Frage, was nun kommen könnte, nicht berücksichtigt, der ist nur eines: politisch naiv. Dabei gibt es genug Literatur zu dem Thema. Man könnte das neueste Buch von Vali Nasr, einem langjährigen Politikberater der Demokraten, lesen, um zu wissen, mit welchem Gegner man es zu tun hat. Oder auch Amir Hassan Cheheltan, den großen Schriftsteller, der mehr noch als Nasr über die Zivilbevölkerung nachdenkt. Er hat Iran nie verlassen und kann seine Bücher seit Jahrzehnten nur noch in deutscher Erstveröffentlichung herausbringen, weil er in Iran keine Druckgenehmigung erhält. Ende Juni veröffentlichte Cheheltan im „Spiegel“ einen Essay mit dem Titel „Israel hat seinen einzigen Freund in der Region verloren“.[4] Darin erinnert er daran, dass sich große Teile der iranischen Bevölkerung nach dem terroristischen Angriff der Hamas mit Israel solidarisierten. Es stimmt: Damals gingen Videos viral, auf denen man Studierende sah, die die israelische Flagge, die vor Seminargebäuden als Fußabtreter ausliegt, übersprangen oder umliefen, um sich eben nicht die Schuhe daran abzutreten. Dass das Regime die Hamas und die Hizbollah unterstützt, trägt die Bevölkerung schon lange nicht mehr mit. Seit 2009 ist der am kontinuierlichsten gerufene Slogan auf Demonstrationen: „Weder Gaza noch Libanon, mein Herz gehört Iran.“ Gemeint ist damit: Warum gebt ihr unser Geld zur Stärkung eurer Achse des Widerstands aus, die nur eurem Systemerhalt dient?
Viele dieser Sympathien hat Israel mit seiner Art der Kriegsführung zerstört. Aber so weit wie Cheheltan würde ich nicht gehen: Unrettbar verloren ist die Freundschaft nicht. Immerhin sind die Verbindungen biblisch. Die Sätze aus Kyros‘ Menschenrechtscharta bezogen sich auf die Juden, die der König aus der babylonischen Gefangenschaft errettet hatte. Gemeinsame Geschichte verbindet. Iranischstämmige Freunde aus Israel berichten, sie würden nicht nur von der Angst um die iranische Bombe umgetrieben, sondern wollten auch endlich wieder ihre iranische Heimat besuchen. Viele hätten jedoch die Hoffnung aufgegeben, ein Regimewechsel könne allein aus der iranischen Gesellschaft heraus erfolgen. Und so sind auch die iranischstämmigen Israelis gespalten. Einige zählen zu den 84 Prozent der Israelis, die den Krieg befürworten. Andere halten es mit Golshifteh Farahani. Sie ist eine der bekanntesten iranischen Schauspielerinnen und eine Ikone der „Frau, Leben, Freiheit“-Bewegung. Farahani lebt inzwischen im französischen Exil und hat kürzlich auf die Frage, ob sie noch Familie in Iran habe, um die sie sich sorge, geantwortet: Ja, Mutter und Vater – und weitere 92 Millionen Menschen. Ihre Sorge ist allzu berechtigt.
[1] Vgl. Katajun Amirpur, Die Sehnsucht nach dem Schah, Über die Geschichtsvergessenheit bei den iranischen Protesten, in: „Blätter“, 5/2023, S. 57-63.
[2] Sündenböcke eines gescheiterten Systems, zeit.de, 3.7.2025.
[3] Vgl. Katajun Amirpur, Iran und die Religion: 70 Jahre Putsch gegen Mossadegh, in: „Blätter“, 8/2023, S. 103-110.
[4] Vgl. spiegel.de, 29.6.2025.