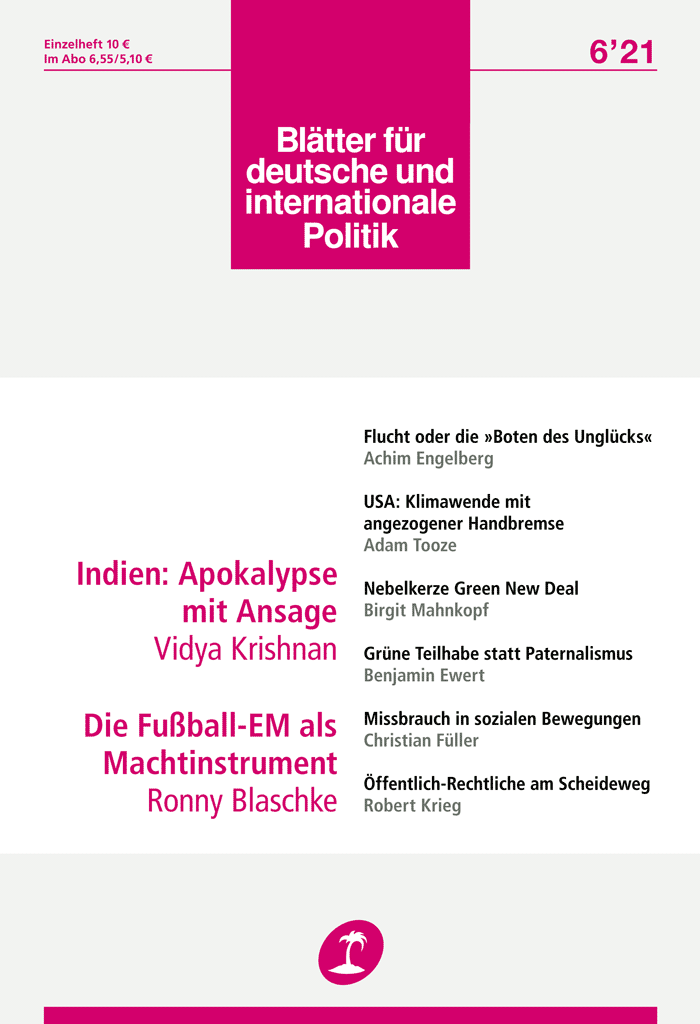Bild: Fridays-For-Future-Aktivist*innenen demonstrieren in Karlsruhe für ein ausreichendes Klimaschutzgesetz und bringen eine symbolische Klimaklage 2.0 zum Bundesverfassungsgericht, 12. Mai 2021 (IMAGO / Nicolaj Zownir)
Historische Entscheidung“, „Zeitenwende“, „neues Kapitel“: In der Tat, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach das vor zwei Jahren beschlossene Klimaschutzgesetz in Teilen verfassungswidrig ist, wird sich in die Geschichte einschreiben.
Am 29. April, dem Tag der Urteilsverkündung, verstand ganz Deutschland schlagartig, dass Klimapolitik kein Hobby für Ökos oder ein moralischer Impetus ist, sondern Gesetz. Und Gesetze müssen verfassungskonform sein und unter Androhung von Strafen befolgt werden. Vor allem Fridays for Future, Umweltbewegung, aber auch die Grünen, die Linkspartei und sogar Teile von Union und SPD feierten daher die Karlsruher Entscheidung.
Dabei war es die große Koalition selbst, die sich im September 2019 auf ein „Klimapaket“ verständigt hatte, das auch das Klimaschutzgesetz enthielt. Dies kam damals einer politischen Revolution gleich: Erstmals verankerte die Regierung Klimaschutz gesetzlich, womit die Ziele von unverbindlichen Richtlinien zu einem einklagbaren Recht avancierten. Ohne das Klimaschutzgesetz hätte es das Urteil aus Karlsruhe nicht geben können – das für die Bundesregierung dennoch eine schallende Ohrfeige bedeutet.
Zwar begrüßten viele Klimaaktivistinnen und -aktivisten vor zwei Jahren grundsätzlich den damaligen Beschluss. Zugleich aber kritisierten sie, dass die Ziele selbst nicht ambitioniert genug ausfielen. Nachdem der Bundestag das Klimaschutzgesetz im November 2019 verabschiedet hatte, reichten einige von ihnen daher Verfassungsbeschwerde gegen die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung ein. Die Kläger stammen aus der Klimabewegung, aber auch aus Forschung und Wissenschaft sowie aus Umweltverbänden. Ihrer Beschwerde hat Karlsruhe nun in Teilen recht gegeben. Das von Union und SPD erlassene Klimaschutzgesetz greife zu kurz, urteilten die Richter. Die Politik müsse daher beim Klimaschutz erheblich nachbessern.
Historisch ist auch die Begründung des Ersten Senats: Die teils sehr jungen Kläger würden durch einige Bestimmungen des Klimaschutzgesetzes in ihren Freiheitsrechten verletzt. Erstmals erkannten die Karlsruher Richter damit Schutzpflichten aufgrund drohender Freiheitseinschränkungen an, die sich durch den Klimawandel ergeben – und begründeten diese mit dem Grundgesetz. Demnach bestehe die Gefahr, dass die Freiheit des Einzelnen durch künftig sehr umfassend nötige Emissionseinsparungen „potentiell betroffen“ ist und drastische Einschränkungen damit die kommenden Generationen bedrohen. Denn was heute nicht eingespart werde, müssten die heute noch jungen Leute umso mehr schultern – mit allen gesellschaftlichen Konsequenzen. Ein Verschieben der Verantwortung könnte dann in zehn oder zwanzig Jahren zu erheblichen Eingriffen in deren Grundrechte führen. „Zur Wahrung grundrechtlich gesicherter Freiheit“ müsse der Gesetzgeber daher entsprechende Vorkehrungen treffen und die nötigen Emissionseinsparungen gerechter verteilen, urteilten die Richter. Konkret bedeutet dies: Um die im Pariser Klimaabkommen festgelegte Begrenzung der Temperaturerhöhung gegenüber vorindustriellen Werten zu erreichen, müssten die dann noch notwendigen Minderungen kurzfristiger und weitgehender erbracht werden als bislang im Klimaschutzgesetz vorgesehen. Von diesen Pflichten sei potentiell jede Freiheit betroffen, weil die Emission von Treibhausgasen in nahezu allen Lebensbereichen erfolge. Damit weisen die Richterinnen und Richter nachdrücklich darauf hin, dass Klimaschutz nicht länger ein Nischenthema ist, sondern vielmehr in alle Lebensbereiche eingreift und einen fundamentalen gesellschaftlichen Umbau bedeutet. Allerdings komme es darauf an, so lässt sich der Urteilsspruch deuten, dass dieser Wandel sozialverträglich erfolgt.
Das Karlsruher Urteil hat damit unmittelbar Auswirkungen auf die Politik. Wenn die Bundesregierung etwa zu niedrige CO2-Preise ansetzt, dann erhalten Verbrennungsmotoren zwar noch eine Gnadenfrist. Allerdings müssen folglich in fünfzehn Jahren auf einen Schlag sämtliche Verbrenner verschrottet werden, um die bereits heute festgesetzten Klimaziele noch zu erreichen. Die gesellschaftliche Auseinandersetzung, der komplizierte Prozess des Austarierens zwischen sozialem Ausgleich, dem Wegbrechen bestimmter Wirtschaftszweige und dem Aufkommen neuer Technologien, dürfe die Regierung aber nicht in die fernere Zukunft verschieben. Stattdessen müssen die Konflikte innerhalb der nächsten zehn Jahre gelöst werden.
Und das Gericht geht noch weiter: Aus dem Grundgesetz folge, dass Treibhausgasemissionen gemindert werden müssten. Denn die aus Art. 2 GG folgende „Schutzpflicht des Staates“ umfasse auch die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen. Und diese Schutzpflicht könne, so das Urteil, „eine objektivrechtliche Schutzverpflichtung auch in Bezug auf künftige Generationen begründen.“ Für die angepeilte Klimaneutralität, die laut dem ursprünglichen Klimaschutzgesetz bis zum Jahr 2050 erreicht werden soll, genügten die Regelungen im Klimaschutzgesetz nicht, bemängelten die Richterinnen und Richter. Deshalb muss die Regierung für die Zeit ab 2031 ebenfalls einen Fahrplan vorlegen.
Regierung im Klimanotstand
Seit dem Urteil befindet sich die Bundesregierung geradezu im Klimanotstand. Union und SPD liefern sich plötzlich ein Wettrennen um die klimapolitischen Maßnahmen. Keine der beiden Parteien will sich im Wahlkampf vorwerfen lassen, verfassungswidrige Gesetze zu erlassen oder die kommenden Generationen über Gebühr zu belasten. Dass die Regierung gerade einmal 13 Tage nach der Urteilsverkündung ein novelliertes Klimaschutzgesetz vorlegte und im Kabinett absegnete, ist ebenfalls vor allem dem Wahlkampf geschuldet.
Insofern hätte der Karlsruher Urteilsspruch auch zu kaum einem besseren Zeitpunkt erfolgen können – und er hat geradezu einen Dominoeffekt zur Folge. Denn was die Regierung bislang als alternativlos verteidigte, musste sie so wohl oder übel innerhalb weniger Tage kippen. Laut der nun beschlossenen Novelle muss die Bundesrepublik bis 2030 statt 55 nun 65 Prozent weniger Treibhausgase gegenüber 1990 ausstoßen. Außerdem soll die Klimaneutralität bereits 2045 statt 2050 erreicht sein. Und auf Betreiben der Richter gibt es außerdem ein weiteres Zwischenziel: Im Jahr 2040 sollen bereits 88 Prozent weniger Treibhausgase produziert werden als 1990.
Die Regierung gebe „Ziele mit Zähnen“ vor, erklärte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) Anfang Mai bei der Vorstellung der Novelle. In der Tat verknappt der neue Klimaschutzgesetzentwurf die zulässigen Emissionsmengen für Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und den Abfallsektor. In all diesen Bereichen und darüber hinaus müssen bis 2030 schrittweise größere Mengen an Treibhausgasen eingespart werden. Die größte Last trägt der Energiesektor: Konnte er laut dem ursprünglichen Gesetz bis 2030 noch 175 Mio. Tonnen ausstoßen, sollen es nun nur noch 108 Mio. Tonnen sein. Damit geht die Debatte um einen früheren Kohleausstieg in eine neue Runde. Bisher darf das letzte Kohlekraftwerk hierzulande bis 2038 laufen.
Das Urteil der Verfassungsrichter zwingt die Politik, sich klar zum Klimaschutz zu bekennen. Ein Parallelsystem des stillen Protegierens fossiler Energien und nur einiger Anreizsysteme für erneuerbare Energien hat fortan keine Chancen mehr. Stattdessen muss die Gesellschaft nun klare Entscheidungen treffen: Wenn sie Klimaschutz will, dann muss sie aus der Kohle raus. Außerdem muss sie anerkennen, dass Diesel- und Benzinmotoren als veraltete Technologie ersetzt werden und die Menschen insgesamt weniger Auto fahren müssen.
Keinen Prozentpunkt mehr als nötig
Bis sich solche Erkenntnisse aber letztlich auch überall durchsetzen, ist es noch ein langer Weg, nicht zuletzt in Berlin. Denn tatsächlich hat sich die Bundesregierung zugleich nicht weiter bewegt als unbedingt nötig.
So twitterte Peter Altmaier (CDU) zwar kurz nach dem Urteil: „Fühle mich durch BVerfG jetzt bestätigt. Das müssen wir umsetzen.“ Allerdings galt gerade das Bundeswirtschaftsministerium in den Verhandlungen um das erste Klimaschutzgesetz eher als Bremser denn als Vorreiter. Nicht zuletzt der damals festgelegte niedrige CO2-Preis und die hohen Abstandsregeln für Windräder gehen auf Altmaiers Konto. Aber auch die anderen Kabinettsmitglieder taten so, als hätte man sehnsüchtig auf das Urteil aus Karlsruhe gewartet, um endlich aus voller Kraft Klimapolitik betreiben zu dürfen. Doch bei genauerem Hinsehen fällt auch die Bilanz des so bejubelten novellierten Gesetzes mehr als gemischt aus: So hätte die Bundesregierung das neue 65-Prozent-Ziel ohnehin erreichen müssen – und zwar auf Druck von Brüssel. In zwei Monaten wird die EU-Kommission, die ihre eigenen Klimaziele bereits im Dezember strenger fasste, die Lasten innerhalb der Union neu verteilen. Die Bundesrepublik muss dann mehr schultern: „Die jüngste Verschärfung des EU-Klimaziels wird ohnehin dazu führen, dass sich auch die deutschen Ziele bis 2030 verschärfen werden“, kommentierte Hans-Martin Henning, Leiter des Klima-Expertenrats der Bundesregierung Anfang Mai. Der Rat errechnete, dass die neue EU-Vorgabe voraussichtlich auf ein deutsches Klimaziel von 62 bis 68 Prozent für 2030 hinauslaufe – je nach Aufteilung zwischen den Ländern. Wenig überraschend hat sich Deutschland nun exakt die in der Mitte liegenden 65 Prozent herausgepickt.
Ob dieses Ziel für den nötigen Klimaschutz ausreicht, ist nach wie vor umstritten. Uneinig ist man sich darüber, wie verbindlich die errechneten „Restmengen“ an Treibhausgasen sind. Mit dem Urteil aus Karlsruhe bezogen sich die Richter auf den bei Klimaforschern und Ökonomen unterschiedlich bewerteten Ansatz des „begrenzten Klimabudgets“. Es bezeichnet die maximale Menge an klimaschädlichen Emissionen, die noch in die Atmosphäre gehen dürfen, ohne dass Dürren und andere Wetterextreme zur Regel werden. Die Budgets werden aus den Daten des aktuellen Berichtes des Weltklimarates abgeleitet und beziehen sich auf die Temperaturziele von 1,5 bis 2 Grad globaler Durchschnittserwärmung, wie sie im Pariser Abkommen festgehalten sind.
Das Bundesverfassungsgericht bezieht sich in seinem Urteil einerseits auf das Pariser Klimaabkommen, das jedoch offenlässt, welche Begrenzungen die einzelnen Länder vornehmen müssen. Jedes Land kann somit seine eigenen Klimapläne erstellen. Und laut Klimaexperten hat bislang kein einziges Land einen Plan vorgelegt, der dem 1,5-Grad-Ziel gerecht wird.
Andererseits rekurriert das Urteil aber auch auf das deutsche Klimabudget, das der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) bereits vor zwei Jahren errechnete. Demnach verfügte Deutschland ab 2020 nur noch über eine Restmenge von 6,7 Mrd. Tonnen CO2, die es bis 2050 ausstoßen darf, um den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf unter zwei Grad zu begrenzen. Dieses Budget schmilzt zusehends zusammen.
Greenpeace errechnete auf Grundlage der SRU-Zahlen und den neuen „Sektorzielen“ im Klimagesetz, dass auch mit der nun beschlossenen Novelle 91 Prozent des CO2-Restbudgets schon im Jahr 2030 aufgebraucht sein werden. Danach würde die Bundesrepublik mehr ausstoßen, als laut dem Verfassungsgerichtsurteil zulässig ist, und auch die Ziele des Weltklimavertrages könnte sie damit nicht einhalten.
Allerdings bewerten Experten solche Berechnungen unterschiedlich, auch weil sich die Rohdaten etwa des Weltklimarats im Laufe der Jahre immer wieder verändern. Festnageln kann man die Regierung damit also nicht – und auch Karlsruhe nutzte die Zahlen nur als ein Beispiel. Dennoch lassen sie sich ebenso wenig vom Tisch wischen wie das Urteil aus Karlsruhe.
Das dämmert offenbar auch der AfD. Deren Vize-Sprecherin Beatrix von Storch zeigte sich nach der Urteilsverkündung überaus erzürnt. Sie wetterte, dass nun auf lange Sicht die Freiheiten der Deutschen eingeschränkt würden, was ihrer Ansicht nach gegen das Grundgesetz verstoße. Die AfD hält nun umso verbitterter an ihrer abstrusen These fest, es sei angeblich nicht erwiesen, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Doch immerhin: Obwohl die AfD den Klimawandel weiter leugnet, hat sie verstanden, dass mit dem Klimaschutz nicht mehr zu spaßen ist. Denn das Gericht hat am Ende nicht das Klimaschutzgesetz als verfassungswidrig eingestuft, sondern dessen lasche Umsetzung – was von Storch natürlich nicht erwähnte. Im Ergebnis hat sich die AfD mit ihrer Rhetorik der Klimawandel-Leugnung in eine Sackgasse manövriert. Wenn nämlich Klimaschutz fortan zur Schutzpflicht des Staates gehört, setzt sich die AfD der Kritik aus, dass sie das deutsche Volk den Folgen eines galoppierenden Klimawandels schutzlos aussetzt. Dennoch macht der „Klimaschutz-Widerstand“ aus der rechten Ecke eines deutlich: Sollte es wirklich zu den sozialen Härten kommen, vor denen das Verfassungsgericht warnt, wenn der Klimaschutz in die 2030er Jahre aufgeschoben wird, dann könnten diese Kräfte erheblichen Zulauf erhalten.
Immer wieder versuchten reaktionäre Kräfte gesellschaftlichen Fortschritt hinauszuzögern. Wurden die entsprechenden Forderungen aber erst einmal rechtskräftig, ließen sich die gesellschaftlichen Veränderungen nicht mehr aufhalten – etwa bei der Einführung des Frauenwahlrechts oder den Gleichstellungsrechten. Dies könnte sich nun beim Klimaschutz wiederholen. Allerdings sind entsprechende Gerichtsurteile nicht immer erfolgreich, geschweige denn so wegweisend wie das jüngste aus Karlsruhe. Erst Ende März erklärte der Europäische Gerichtshof die Klage von zehn Familien für strengere EU-Klimaziele für unzulässig, weil Einzelpersonen nicht gegen EU-Gesetze klagen könnten, die alle Unionsbürgerinnen und -bürger betreffen. Zwei Jahre zuvor hatte das Oberste Gericht in den Niederlanden hingegen bereits ein Urteil gefällt, das die Regierung in Den Haag zu strikteren Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet.
Höchste Zeit also, dass statt der Gerichte die Politik selbst das Steuer in die Hand nimmt und den klimapolitischen Kurs für die heutigen und künftigen Generationen bestimmt.