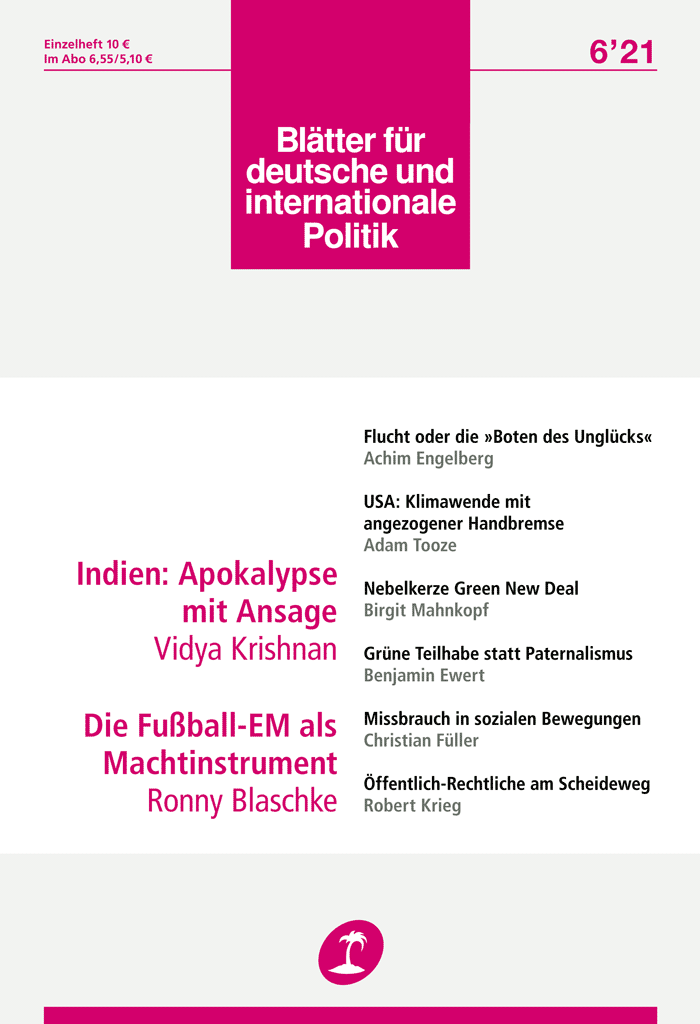Bild: US-Präsident Joe Biden hält eine Rede mit dem Klimabeauftragten des Weißen Hauses, John Kerry, während des virtuellen »Leaders Summit on Climate« im Weißen Haus in Washington DC, 23. April 2021.
Der Earth Day, „Tag der Erde“, ist nach der bislang größten Umweltdemonstration benannt, die vor 51 Jahren in den Vereinigten Staaten stattfand. Zu Ehren dieses Tages hatte die Biden-Administration am 22./23. April zu einem Weltklimagipfel eingeladen. So feierte, während Joe Bidens erste hundert Tage im Amt sich ihrem Ende näherten, dieser Gipfel die Rückkehr der USA in die globale Umweltpolitik. Für die neue Administration, die der Klimakrise zentrale Bedeutung beimisst, handelte es sich zugleich um eine erste Bewährungsprobe. Darüber hinaus markierte der Earth-Day-Gipfel eine bedeutsame Akzentverschiebung in Bidens Agenda. Zuvor hatte diese nämlich ganz im Zeichen des Katastrophenmanagements gestanden. Es ging erst einmal darum, den von Donald Trumps Operation Warp Speed geerbten Impfstoff unter die Leute zu bringen sowie amerikanischen Firmen und Haushalten eine gewaltige dritte Runde finanzieller Hilfsleistungen zukommen zu lassen. Mit Blick auf die Klimaverhandlungen wird der Präsident sich nun längerfristig festlegen – und „liefern“ müssen: eine glaubhafte Verpflichtung nämlich, die amerikanischen CO2-Emissionen bis 2030 mindestens zu halbieren und bis 2050 die net-zero-Marke, die Klimaneutralität, zu erreichen.
Die Krisenbekämpfung hat funktioniert. Nach Startschwierigkeiten zeigt die Impfkampagne inzwischen eine beeindruckende Breitenwirkung, die Amerikas Blick auf das Virus verändert. Das Gesetz über weitere 1,9 Bill.US-Dollar Covid-Hilfen wurde am 11. März gegen den geschlossenen Widerstand der Republikaner durchgepeitscht. Zusammen mit den vorherigen Runden summiert die ökonomische Covid-Hilfe sich damit zum größten staatlichen Finanzpaket der Geschichte – es macht mehr als 25 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus und stellt einen schroffen Bruch mit der Finanzorthodoxie der Clinton- und der Obama-Administration dar. Entsprechend scharf fiel die Kritik von Veteranen der Clinton-Ära wie Larry Summers aus.
Dieser Bruch ist von so entscheidender Bedeutung, dass sogar von einer neuen Ära, von „Bidenomics“ gesprochen wird. In wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht liegt dem eine fundamentale Neubewertung des Risikos zugrunde, dass zu hohe Staatsausgaben zu Konjunktur-Überhitzung und Inflation führen könnten. Zugleich geht er aber auch auf die Erkenntnis zurück, dass die größte Gefahr für die liberale Demokratie in den USA nicht von makroökonomischer Instabilität, sondern von der gesellschaftlichen Polarisierung und der Politik der Republikaner ausgeht. Soll es den Demokraten gelingen, das Land vom Abgrund wegzusteuern, dürfen sie keinesfalls die Zwischenwahlen im kommenden Jahr verlieren, wie es Obama 2010 und Clinton 1994 widerfuhr. Somit hat der doppelte Schock der Trump-Wahl und der Covid-19-Pandemie zentristische Politiker wie Biden und Technokraten wie Finanzministerin Janet Yellen dazu gebracht, sich in Sachen Wirtschaftspolitik einen Ruck zu geben. Und wenn das Biden-Team die weltweite Umstellung auf saubere Energie vorantreiben will, wird es sich in Sachen Klimapolitik einen vergleichbar energischen Ruck geben müssen. Die neue Administration muss nicht allein mit Trumps Leugnung des Klimawandels, seiner Begeisterung für fossile Brennstoffe und seiner Kulturkriegspolitik brechen, sondern auch mit dem klimapolitischen Erbe Obamas und Clintons.
Das ist keine Kleinigkeit! Schließlich sind die Demokraten lange Zeit Amerikas Klimapartei gewesen. Die Clinton-Administration war an der Aushandlung des Kyoto-Protokolls von 1997 führend beteiligt, des ersten internationalen Abkommens, das die Teilnehmerstaaten auf verbindliche Ziele bei der Bewältigung des Klimawandels verpflichtet. Al Gore war im Jahr 2000 schon quasi als Klimapräsident gesalbt, doch der Oberste Gerichtshof stahl ihm den Wahlsieg. Die Obama-Administration schließlich pumpte Geld in die amerikanische Solarenergiebranche und vermittelte das Pariser Abkommen von 2015. Es war allerdings dieselbe Obama-Administration, die – von einem republikanischen Kongress in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt – die Grenzen des Pariser Abkommens so eng zog, dass dieses letztlich kaum mehr darstellte als die Zusammenfassung mehr oder weniger angemessener nationaler Pläne. In Obamas nationaler Energiepolitik dominierten nicht etwa die Erneuerbaren, sondern die Marktmacht des Fracking-Gases – des „saubersten“ der fossilen Brennstoffe. Da Gas nun einmal so viel billiger ist, gelang es nicht einmal Trump, das Land zur Kohle zurückzuführen. Doch nun haben die USA ein gewaltiges Ensemble von Gasfazilitäten – Fracking-Einrichtungen, Pipelines, Kraftwerke und an diese angeschlossene petrochemische Industrien –, für die es langfristig keine Verwendung geben kann, wenn anspruchsvolle Emissionsziele erreicht werden sollen.
Wenn jetzt ins Auge gefasst wird, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, gibt es keinerlei Spielraum mehr für Schummeleien. Die Biden-Administration muss in der Energiepolitik einen radikalen Kurswechsel vollziehen, weg von Obamas energetischem Sammelsurium und hin zum systematischen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Sie muss sowohl ökonomische als auch technische Lösungen finden, die ein grünes Energiesystem praxistauglich machen. Sie muss aber auch die politische Auseinandersetzung gewinnen. Während die technologischen Ungewissheiten und die wirtschaftlichen Hindernisse der Planung für eine emissionsfreie Zukunft alle Welt betreffen, steht Amerika vor einem spezifischen Problem: vor der politischen Frage nämlich, wie es um die Verbindlichkeit der eingegangenen Verpflichtungen steht. Dekarbonisierung braucht einen langen Atem. In der US-Politik kann aber von einem Konsens über die Notwendigkeit zu handeln nicht einmal annähernd die Rede sein. So ernst es der Biden-Administration mit der Bewältigung der Klimakrise auch sein mag, ob sie dies leisten kann, hängt nun einmal vom Kräfteverhältnis im Kongress ab, und das könnte sich schon bei den Zwischenwahlen 2022 verschieben – oder im Jahr 2024 oder 2026. Ohne eine breitere Übereinkunft in der Gesellschaft wird man bei jeder US-Wahl den Atem anhalten, weil alles entgleisen könnte.
Die Biden-Administration muss in der Energiepolitik einen radikalen Kurswechsel vollziehen – hin zum systematischen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen.
In jeder fortgeschrittenen Volkswirtschaft gibt es ökonomische Interessen, die einer tiefgreifenden, schnellen Dekarbonisierung entgegenstehen, Interessen gewisser Branchen, von Verbrauchergruppen und von einigen Gewerkschaften. Aber allein die USA stehen vor dem Problem, dass eine der beiden staatstragenden Parteien – und mit ihr ein erheblicher Teil der Öffentlichkeit – sich einer prinzipiellen Leugnung der Klimakrise verschrieben hat. Wenn sich das nicht ändern lässt, wird Amerika bei allen Bemühungen, die Erderwärmung aufzuhalten, ein unzuverlässiger Partner bleiben.
Der Verzicht auf einen CO2-Preis
Zumindest in einer Hinsicht zieht die Klimapolitik der Biden-Administration offenkundig Lehren daraus, dass sowohl Clinton als auch Obama auf diesem Feld im Wesentlichen gescheitert sind. So taucht das Instrument, das die meisten Ökonomen als essentiell für eine umfassende Dekarbonisierung der US-Wirtschaft betrachten, in der Agenda 2021 gar nicht erst auf: das Carbon Pricing – die Belastung von CO2-Emissionen mit Kosten, die ausreichend hoch sind, um Umweltverschmutzer zu veranlassen, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu mindern oder ganz zu beseitigen. Dass die Emissionsbepreisung jetzt ausgelassen wird, ist eine der Ironien der Geschichte. In den ersten Anfängen einer globalen Klimapolitik, Ende der 1980er Jahre, war es der US-Umweltverteidigungsfonds (EDF), der den damaligen Präsidenten George H. W. Bush davon überzeugen konnte, dass die Vergabe von Emissionsrechten durch Zertifikate, die man kaufen und verkaufen kann, die effektivste Methode zur Drosselung des CO2-Ausstoßes sei. In Europa wurde dieses Modell 2005 widerstrebend übernommen, als die EU, unterstützt vom EDF, das Emissionshandelssystem ETS einführte. Mittlerweile setzen steigende Preise im ETS große Umweltverschmutzer in Europa tatsächlich unter Druck. China folgt dem europäischen Vorbild und entwickelt sein eigenes System der CO2-Bepreisung. In den USA hatten sowohl die Clinton- als auch die Obama-Administration die CO2-Bepreisung auf ihrer Agenda – unter Clinton durch Besteuerung, unter Obama durch Emissionshandel. Beide Präsidenten verfügten über Kongressmehrheiten, aber in beiden Fällen schmolzen diese Mehrheiten während der qualvollen Auseinandersetzungen dahin, die jedes wichtige Gesetzesvorhaben in den USA begleiten. Diese Niederlagen haben die US-Klimabewegung gezeichnet. Eine der verblüffenden Fehlanzeigen in der 2019 von den Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez und Ed Markey im Kongress eingebrachten Entschließung zum Green New Deal betrifft die CO2-Bepreisung, die Kritikern mittlerweile eher als neoliberales Placebo denn als wirksames Politikinstrument gilt. In Kalifornien gibt es ein eigenes Bepreisungsverfahren, das aber unter Parteilinken sehr unbeliebt ist. Sie erachten es als diskriminierend und rückschrittlich, weil es Unternehmen und Wohlhabenden Emissionsrechte verschaffe. Zwar betonen Experten, wenn die Erträge der CO2-Bepreisung ärmeren Haushalten zugute kämen, könnte dies ein wirksames Umverteilungsinstrument sein, doch das Biden-Team schreckt vor einem derart komplizierten Deal zurück. Die hierfür erforderlichen CO2-Preise müssten exorbitant hoch ausfallen, besonders, wenn die Umstellung aus dem Stand heraus erfolgen soll. Anders als in Europa wird in den USA nicht einmal Benzin hoch besteuert. Eine Art amerikanischer Gelbwesten-Bewegung wäre das Letzte, was die Biden-Administration brauchen kann.
Doch mit welchem Verfahren lassen sich die fossilen Brennstoffe dem System austreiben, wenn es nicht irgendeine Form der Bepreisung gibt? Statt Preise als Anreiz dafür zu nutzen, dass Umweltverschmutzer ihren Verbrauch fossiler Brennstoffe reduzieren und dass Nachfrage und Angebot sich auf sauberere Energiequellen verlagern, hat sich die Biden-Administration zunächst auf Regulierungsmaßnahmen und die Bepreisungsstandards konzentriert, die staatliche Behörden bei internen Kalkulationen anwenden. Das ist nicht neu. Dieser Methode bediente man sich in der zweiten Amtszeit Obamas, nachdem der Oberste Gerichtshof der Umweltschutzbehörde EPA das Recht zugesprochen hatte, die CO2-Emissionen zu kontrollieren. Zwar ist die Methode angreifbar, weil gegen sie geklagt werden kann, aber sie markiert den ersten Schritt der Biden-Administration auf dem Weg zu einer CO2-freien Elektrizitätsversorgung ab 2035.
Schon heute gibt es immer ausgereiftere Technologien für saubere Energie, doch angesichts des gewaltigen Energieverbrauchs der USA handelt es sich um ein sehr anspruchsvolles Vorhaben. Der Übergang von Gas und Kohle zu unbeständigen Energiequellen wie Wind und Sonne erfordert enorme Extrakapazitäten und zugleich ein neues, landesweites Transmissionssystem, um sicherzustellen, dass die saubere Energie von den wind- und sonnenreichen Staaten im Zentrum des Landes zu den küstennahen Ballungsgebieten gelangt, deren Bedarf am größten ist. Dass Verkehrswesen und Heizungssysteme sowohl in der Wirtschaft wie in den Haushalten auf Elektrizität umgestellt werden müssen, wird der Nachfrage nach Erneuerbaren ebenfalls Grenzen setzen. Woher aber werden die Investitionen kommen? Am 31. März beantwortete die Biden-Administration diese Frage mit der Vorstellung des auf zwei Bill. Dollar veranschlagten American Jobs Plan – nach dem ersten, 1,9 Bill. Dollar starken Impulspaket das zweite von drei Programmen, die die Regierung auflegt. Als drittes wird ein Familienprogramm folgen, das auf die Verbesserung der ganz und gar unzureichenden Kinderbetreuung abzielt. Vorgestellt wurde der Jobs-Plan mit großem Tamtam als dreigliedrige Investition in die Bekämpfung der Übel, die die US-Gesellschaft plagen – von der Ungleichheit und der Arbeitslosigkeit bis zur verrottenden Infrastruktur. Gleichzeitig geht es aber auch um die Herausforderung durch die chinesische Autokratie und die Klimakrise. Wer sich durch die Dutzende von Unterprogrammen durcharbeitet, kann nicht umhin, den Einfallsreichtum des Ganzen zu bewundern: Da fehlt nichts, von der Altenpflege bis zur Finanzierung der Labore von traditionell schwarzen Colleges gibt es alles – ein wahrer Zauberwürfel der Intersektionalität!
Kein visionärer Paradigmenwechsel
Doch so bewundernswert ausgeklügelt das Programm auch wirkt, bleibt die große, alles entscheidende Frage, ob sein Investitionsvolumen ausreicht und ob es die Emissionen tatsächlich reduzieren wird. Die Zwei-Billionen-Überschrift liest sich eindrucksvoll. Zählt man die diversen Versprechungen zusammen, die bei der ursprünglichen Vorstellung gemacht wurden, landet man sogar bei einem Volumen von fast 2,7 Bill. Dollar. Aber auf die großartige Gesamtsumme kommt es weniger an als auf das Timing. Anders als das erste, 2,2 Bill. schwere Covid 19-Hilfsprogramm, der CARES-Act von März 2020, und die 1,9 Bill. Dollar von Bidens Relief Act verteilt sich dieses Infrastrukturprogramm nämlich über acht Jahre, während die beiden ersten Gesetze die Auszahlung der Billionensummen binnen weniger Monate vorsahen.
Großzügig geschätzt, ist etwa die Hälfte der zwei bis 2,7 Bill. für die Bewältigung der Klimakrise bestimmt. Verteilt man eine bis 1,3 Bill. über acht Jahre, kommt man auf etwa 0,5 Prozent des derzeitigen Bruttoinlandsprodukts jährlich. Das liegt weit unter jeder vernünftigen Schätzung des für die Dekarbonisierung benötigten Investitionsvolumens. Das Lager von Bernie Sanders verlangte, unterstützt von der 350.org-Kampagne des Aktivisten Bill McKibben, 16,3 Bill. Dollar. Die Thrive-Act-Initiative, die von Gruppen aus dem Umfeld des Green New Deal unterstützt wird, fordert zehn Bill. Dollar, von denen achtzig Prozent vor allem der Klimapolitik zufließen sollen.
Die Dimension der genannten Vorschläge spiegelt die beispiellose Größenordnung der Herausforderung wider. Doch anders als die finanzpolitische Reaktion der USA auf Covid-19, in deren Zuge angesichts eines Schocks von historischen Ausmaßen Billionen von Dollars für Konsumschecks und Kreditprogramme für Privathaushalte bzw. Kleinbetriebe bereitgestellt wurden, setzt Bidens Infrastrukturprogramm, so ausgeklügelt es politisch sein mag, die vorgesehenen Mittel nur kleckerweise ein. Wenn man sich die einzelnen Posten des Pakets näher anschaut, wird klar, wie bescheiden es in Wahrheit ist. Was den Personenverkehr auf der Schiene betrifft – ein Bereich, in dem die USA weit hinter China und anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften hinterherhinken –, sieht der Jobs-Plan die über acht Jahre gestreckte Investition von 10 Mrd. per annum vor. Wie aus dem Kleingedruckten hervorgeht, soll dies Amerika in die Lage versetzen, dem „Nachholbedarf“ der Eisenbahngesellschaft Amtrak abzuhelfen, „den stark befahrenen Nordost-Korridor zu modernisieren“ sowie „bestehende Korridore zu verbessern und neue Städteverbindungen zu schaffen“. Zweifellos wird das Programm gute Arbeitsplätze schaffen. Doch was es nicht leisten wird, ist, die Vereinigten Staaten in ein Zeitalter des Hochgeschwindigkeits-Schienenverkehrs zu katapultieren, das mit den Pionierleistungen Japans und Chinas mithalten kann. Die Volksrepublik verfügt gegenwärtig über ein Hochgeschwindigkeitsnetz von 19 000 Meilen – Amerika rühmt sich, 500 Meilen zu besitzen.
Es ist bezeichnend für den Mangel an reformerischem Elan, dass die für Elektroautos vorgesehenen Ausgaben höher sind als die für öffentliche Verkehrssysteme. Die Autokultur als eines der symbolischen Kernelemente des American Way of Life ist offenkundig nicht verhandelbar. Für die Elektrifizierung des Fahrzeugsektors sollen insgesamt 174 Mrd. Dollar ausgegeben werden, unter anderem für die Autoindustrie, für Elektroauto-Kaufprämien und für die Lade-Infrastruktur. Das Programm sieht die Schaffung von 500 000 Ladepunkten bis 2030 vor. Zum gleichen Zeitpunkt gedenken Deutschland eine Million und China mindestens drei Millionen Ladestationen fertiggestellt zu haben. Nun besagen die jüngsten Vergleichszahlen, dass Amerikaner jährlich fünfmal so viele Meilen im Auto zurücklegen wie Deutsche. Zwar wird es Steueranreize für den Kauf neuer Elektrofahrzeuge geben, aber der Plan sieht keinerlei Aufwendungen dafür vor, die inländische Verbrennerflotte von der Straße zu holen. Dabei waren 2020 in den USA rund 287 Millionen Fahrzeuge registriert, die praktisch alle schnellstmöglich aus dem Verkehr gezogen werden müssten. Eben deshalb sah der Sanders/McKibben-Plan vor, zwei von insgesamt siebzehn Mrd. Dollar für ein gigantisches „cash for clunkers“-Programm auszugeben, zur Subventionierung der „Rostlauben“-Verschrottung also. Tag für Tag keucht eine Flotte dieselbetriebener gelber Schulbusse über unsere Straßen, um fünfundzwanzig Millionen Kinder zur Schule zu bringen. Das ist einer der Initiationsriten amerikanischer Kindheit. Zusammengenommen legen diese Schüler Jahr für Jahr vier Mrd. Meilen in solchen Bussen zurück, deren Auspuffe ununterbrochen Dieselqualm ausstoßen. Die Biden-Administration rühmt sich, zwanzig Prozent dieser Flotte bis 2030 elektrifizieren zu wollen. Doch was ist mit dem Rest?
Der American Jobs Plan ist gewiss kein visionärer Paradigmenwechsel. Dieser Eindruck verfestigt sich, wenn wir die Finanzierungsseite betrachten. Zwar ist beachtlich, dass der Jobs-Plan überhaupt eine Finanzierungskomponente aufweist – der Relief and Cares Act beschränkte sich schlicht und einfach darauf, das Geld zu borgen. Im Gegensatz dazu ist der Jobs-Plan unmittelbar mit Steuererhöhungen verknüpft. Seine Gegenfinanzierung besteht in der Einstellung, Verschiebung oder Kürzung anderer Staatsvorhaben.
Nimmt man das Narrativ der „Bidenomics“, das den Eintritt in ein neues Zeitalter verkündet, so wirkt die Realität ernüchternd. Wenn man von der Bilanz amerikanischer Finanzpolitik der letzten Jahrzehnte ausgeht, die eine Abfolge gewaltiger Defizite ohne schädliche Folgen verzeichnet, fällt es schwer zu verstehen, wie irgendwer für ein Gleichgewicht von Steuereinnahmen und Staatsausgaben plädieren kann. Wenn es so etwas wie „Bidenomics“ tatsächlich gibt, beruht diese Herangehensweise ganz im Gegenteil auf der Zurückweisung einer solchen Gleichung und auf der Devise: Geben wir aus, was gebraucht wird, um die US-Wirtschaft wieder auf volle Touren zu bringen – um die Finanzen kümmern wir uns später. Man muss kein Radikaler sein, um die Finanzierung eines Investitionsprogramms auf Pump vernünftig zu finden. Schließlich verfährt jedes Gewerbe, jeder Haushalt, das oder der kreditwürdig ist, genauso. Schuldenaufnahme jetzt, Rückzahlung später, sobald die Investition sich bezahlt macht.
Doch genau so verkauft die Biden-Administration ihr Investitionsprogramm eben nicht. Nach der anfänglichen Welle nicht gegenfinanzierter Hilfszahlungen verknüpft sie jetzt Investitionen und Steuereinnahmen. Die zugrunde liegende Logik ist nicht ökonomischer, sondern politischer Natur: Der ausgerechnet im Trump-Country West-Virginia gewählte Demokrat Joe Manchin stellt sich haushaltspolitisch auf die Hinterbeine, weshalb die Sozialtechnokraten der Biden-Administration folgenden Plan aufgelegt haben: Man verknüpfe die langfristigen Investitionen des Infrastrukturprogramms mit gerechtfertigten Steuererhöhungen und stelle die Unternehmenssteuersätze der Vor-Trump-Zeiten wieder her. Die progressive Logik des Vorschlags liegt auf der Hand: Steuern sind zweifellos ein Hauptinstrument zur Beeinflussung der Einkommens- und Vermögensverteilung. Doch angesichts der wütenden Lobbyschlacht, die solche Steuererhöhungen mit sich brächten, hat die Logik des Vorschlags lediglich bewirkt, dass das Investitionsprogramm insgesamt enger geschnürt wurde. Wenn es vor allem darum geht, den Energieumstieg so schnell und mit so wenig Widerstand wie möglich voranzutreiben, ist eine Erhöhung der Unternehmensbesteuerung – die Big Business zu einem wahren Proteststurm anstacheln würde – nicht eben ratsam.
Die ursprüngliche Vision des Green New Deal lag hier richtig: Investieren wir in der Größenordnung, die der Klimanotstand gebietet, und kümmern wir uns um die Finanzierungsfrage, wenn das makroökonomische Gleichgewicht es erfordert. Sollten hohe Defizite Inflationsdruck bewirken, so kann dem durch erhöhte Zinssätze oder Steuererhöhungen, die Einkommen und Nachfrage dämpfen, begegnet werden. Machen wir das Niveau unser Klimainvestitionen nicht vom Steueraufkommen abhängig, gleichgültig, wie progressiv etwaige Erhöhungen ausfallen könnten.
Die Neufassung des Green New Deal im Geiste von BlackRock
Die meisten Pläne für einen raschen Energie-Umstieg gehen davon aus, dass Klimaneutralität sich bis 2050 erreichen lässt, wenn jährlich zwischen fünf und sieben Prozent des Bruttosozialprodukts dafür investiert werden. Nur zwischen einem Viertel und einem Drittel dieser Beträge müssten zusätzlich aufgebracht werden – der Rest wäre schnellstmöglich von weiteren Investitionen in Systeme abzuziehen, die noch mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Wie Jörg Haas von den deutschen Grünen gerne sagt, müssen wir gleichzeitig das Gas- und das Bremspedal durchtreten, wie man es macht, wenn man einen Sportwagen bei hohem Tempo um eine scharfe Kurve reißt. Doch bei Investitionen gibt der Biden-Plan nur ganz vorsichtig Gas. Wenn die CO2-Preise nicht drastisch steigen, gibt es keinen Marktanreiz, die Investitionen in fossile Brennstoffe zu senken. Es ist unklar, wie die Biden-Administration diese Kurve nehmen will, außer durch Regulierungsmaßnahmen.
Wie also soll man sich die bescheidenen Dimensionen des Bidenschen Klimaplans erklären? Eine Antwort lautet, Amerika – und speziell die amerikanische Wirtschaft – habe ja jetzt immerhin erst mal die richtige Richtung eingeschlagen. Angesichts der dramatischen Rhetorik, mit der das Programm daherkommt, klingt das allerdings paradox. Doch vielleicht haben wir es mit einer ziemlich tiefsitzenden Überzeugung zu tun, die Bidens Team insgesamt erfüllt: Die Situation mag schlimm sein, die Trump-Krise war schrecklich, dennoch ist Amerika eine zutiefst gutartige und dynamische Gesellschaft, auf der Gottes Blick wohlgefällig ruht. Solch patriotischer Voluntarismus ist der Basso Continuo der gesamten Biden-Administration. „Es gibt nichts, das unsere Möglichkeiten übersteigt, nichts, das wir nicht schaffen würden, solange wir es gemeinsam tun“, so der Präsident anlässlich der ersten gemeinsamen Kongresssitzung am 28. April.
Patriotischer Voluntarismus ist der Basso Continuo der gesamten Biden-Administration.
Vielleicht am deutlichsten zeigt sich das im Hinblick auf Wissenschaft und Technik. Der Jobs-Plan sieht vor, viel Geld in die Universitäten zu investieren. Doch was Forschung und Entwicklung zum Thema saubere Energie angeht, verspricht er hauptsächlich, 35 Mrd. Dollar „in das gesamte Spektrum der Lösungen“ zu investieren, „deren es bedarf, um technologische Durchbrüche bei der Bewältigung der Klimakrise zu erzielen“. Es gelte, Amerika in Sachen saubere Energie technologisch und beschäftigungspolitisch „als den global leader zu positionieren.“ Diese 35 Mrd. Dollar sind allerdings weniger, als die Amerikaner alljährlich ausgeben, um ihre Haustiere zu füttern. Zudem sollen diese Mittel über acht Jahre verteilt werden. Entweder man wagt nicht, mehr zu fordern, oder man unterschätzt die Größenordnung der technologischen Herausforderung und glaubt, dass „das gesamte Spektrum der Lösungen“, deren es bedarf, damit die USA diese Durchbrüche schaffen und global leader werden, so unkompliziert ist wie Tierfutter zu kaufen.
Allerdings könnte der Jobs-Plan auch eine ganz andere Annahme implizieren, nämlich dass es sich bei dem Investitionsprogramm der Bundesregierung lediglich um den Startschuss handelt. Tatsächlich wird mehr Geld aus anderen Quellen fließen. Die staatlichen Mittel werden durch private Finanzakteure vervielfacht werden. Brian Dreese, der weithin als der Kopf hinter dem Programm und als der maßgebliche Klimaexperte in Bidens wirtschaftspolitischem Team gilt, hat seine Auszeit vom Staatsdienst bei der Investmentgesellschaft BlackRock verbracht. Vielleicht sollten wir das im Hinterkopf behalten, wenn wir lesen, dass Präsident Biden glaubt, die marktbasierte Wende zu sauberer Energie biete enorme Chancen zur Entwicklung neuer Märkte und neuer Geschäftszweige. Das ist das Mantra vom ökologisch und sozial verantwortungsvollen Investment – als Gelegenheit, neue Märkte zu erschließen. Und – wie so oft im Finanzgeschäft – basiert es auf Multiplikatorenlogik. Eine bescheidene Kapitalinjektion ermöglicht die Vervielfachung der eingesetzten Mittel in Gestalt von Krediten. Das ist keine amerikanische Besonderheit. Mehrere progressive Staaten haben „grüne Banken“ zugelassen. Die EU scheut sich bei Vorhersagen über die Auswirkung ihrer Programme auf die Investitionstätigkeit nicht, von Multiplikatoren bis hin zur Verzehnfachung auszugehen, um das prognostizierte Volumen in die Höhe zu treiben.
Vielleicht steckt diese Annahme hinter der im Biden-Plan enthaltenen Idee, einen 27 Mrd. schweren Clean Energy and Sustainability Accelerator zu schaffen (BWL-Jargon für eine Beratungstätigkeit, die Unternehmen bei der Entwicklung kredittauglicher Projekte und dem Zugang zu Bankkrediten unterstützt), „um Privatinvestitionen zu mobilisieren: Investitionen in Dezentrale Stromerzeugung, in die Sanierung von Wohn- und Geschäftsgebäuden und kommunalen Bauten sowie in saubere Verkehrssysteme”. Aber diese Zeilen über marktbasierte Umrüstungen stehen nicht im Zentrum des Jobs-Plans. Sie sind in Passagen über „unterversorgte” Landgemeinden verborgen. Kein Vergleich mit dem CARES-Act, der eine gewaltige, theoretisch von der Zentralbank-Bilanz abgesicherte Kreditfazilität schuf. Den Clean Energy and Sustainability Accelerator hat man im Kleingedruckten verstaut. Wenn dies die Neufassung des Green New Deal im Geiste von BlackRock ist, so ist sie meilenweit entfernt von der kühnen Vision des Originals.
Amerikas Grenzen
Verglichen mit der Größenordnung der zur Bekämpfung von Covid-19 bereitgestellten Mittel und ihrem entschlossenen Einsatz und angesichts all der hochtrabenden Rhetorik über die Bewältigung historischer Aufgaben scheint Bidens Klimaprogramm von Zwängen gehemmt, nicht anspruchsvoll genug und ohne Fokus zu sein. Dabei hat der Jobs-Plan die zermürbenden Aushandlungsprozeduren im Kongress noch gar nicht durchlaufen. Allerdings ist nicht ganz ausgeschlossen, dass die Debatte in die andere Richtung ausschlägt – in jüngster Zeit haben stimulus bills auf ihrem Weg durch den Kongress an Fördervolumen eher zugenommen, statt zu schrumpfen. Die Linke kämpft für eine Aufstockung der vorgesehenen Mittel. Aber da die Zentristen nicht nachgeben wollen und die Wirtschaft sich schon für einen Steuerkrieg rüstet, dürfte es hart genug werden, irgendetwas durchzubringen, das wenigstens das Niveau des Zwei-Billionen-Investitionsplans hält.
Im Gegensatz zu Bidens voluntaristischem Credo stehen die USA sich in Wirklichkeit erst einmal selbst im Wege.
Wie sollte der Rest der Welt und besonders Europa auf dieses amerikanische Drama reagieren? Dass man sich in Washington traf, um die Klimakrise zu erörtern, ist zweifellos eine gute Sache. Aber das politische Ringen in den USA selbst um einen einvernehmlich, auf breiter Basis erzeugten Schub in Richtung Dekarbonisierung muss erst noch gewonnen werden. Und das Land ist von den Narben der eigenen Geschichte gezeichnet, ganz besonders in Sachen CO2-Bepreisung. Es gibt keinen Grund zu bezweifeln, dass das Biden-Team es ernst meint. Aber die Grenzen, an die Amerika stößt, sollten nicht maßgeblich für die Richtung, in die der Rest der Welt sich bewegt, oder für das einzuschlagende Tempo sein. Im Gegensatz zu Bidens voluntaristischem Credo stehen die USA sich in Wirklichkeit erst einmal selbst im Wege. Wenn die Führungsrolle, die sie in Sachen Klima erstreben, irgendetwas bedeuten soll, sollten sie zunächst diese Realität zur Kenntnis nehmen.
Dieser Beitrag ist die deutsche Erstveröffentlichung eines Textes, der unter dem Titel „America‘s race to net zero“ am 21.4.2021 im „New Statesman“ erschienen ist. Die Übersetzung stammt von Karl D. Bredthauer.