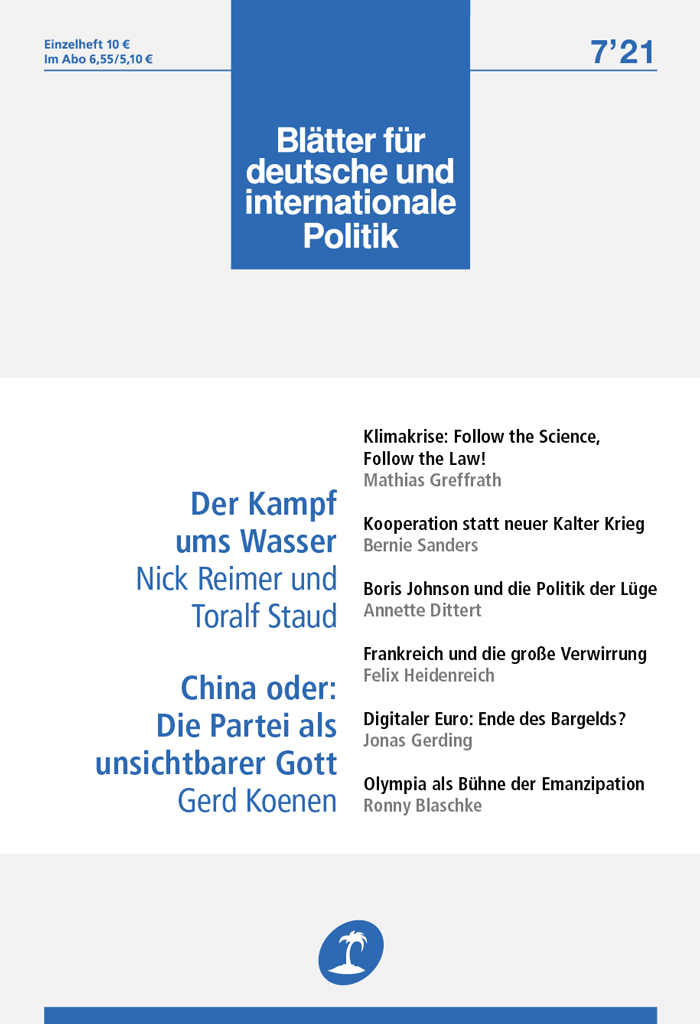Bild: Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu während einer Sondersitzung der Knesset, in der die Abgeordneten Isaac Herzog zum neuen Präsidenten wählten, 2.6.2021 (IMAGO / UPI Photo)
Selbst ein Krieg hat nicht verhindern können, dass die Ära Benjamin Netanjahus endet: Der vierte Gaza-Krieg innerhalb von zwölf Jahren begann im Mai mit Raketen auf Jerusalem. Weil nationalistische Israelis nicht von einem Flaggenmarsch durch die Altstadt lassen wollten, stellte die palästinensische Hamas der Regierung Netanjahus am Nachmittag des 10. Mai ein Ultimatum: Bis 18 Uhr müssten alle israelischen Sicherheitskräfte vom Tempelberg abgezogen werden. Die Frist verstrich – und pünktlich um sechs Uhr abends feuerte die islamistische Parteimiliz Geschosse auf die Heilige Stadt, zum ersten Mal seit 2014. Noch in derselben Nacht begann die israelische Luftwaffe mit dem Bombardement des Gazastreifens; erst elf Tage später, am 21. Mai, erreichten ägyptische Vermittler eine Waffenruhe zwischen den Israel Defense Forces (IDF) und der Hamas.
Der – verglichen zu den 51 Tagen Gaza-Krieg im Jahr 2014 – kurze, aber heftige Waffengang zwischen den ungleichen Gegnern hat die Regierungsbildung in Israel nicht aufhalten können. Schien es zunächst so, als ob Netanjahu von der militärischen Eskalation politisch profitiere, stand er nun wahrscheinlich das letzte Mal als Regierungschef einer Militäroperation gegen die Hamas vor.
Das Bündnis zu Netanjahus Ablösung hat sich in den elf Kampftagen konsolidiert. Mit dem Ergebnis, dass Israels Parlament am 13. Juni mit einer hauchdünnen Mehrheit von 60 zu 59 Stimmen den Weg für eine neue Regierung frei machte. Die Ära Netanjahu geht damit zwölf Jahre nach dem Beginn seiner zweiten Amtszeit als Ministerpräsident 2009 zu Ende. Von 1996 bis 1999 hatte er schon einmal an der Regierungsspitze gestanden, ein Vierteljahrhundert lang hat der 1949 in Tel Aviv geborene Netanjahu die Politik Israels geprägt.
Acht Parteien, ein Ziel
Weil auch die vierte Parlamentswahl in zwei Jahren im März keine klare Regierungsmehrheit ergab, kommt es so zur vielleicht kuriosesten Koalition seit der Staatsgründung 1948. Ministerpräsident wird zunächst Naftali Bennett, Vorsitzender der rechtsnationalistischen Jamina-Partei (Nach Rechts), die in der Knesset lediglich 7 der 120 Sitze stellt. Doch nur durch dieses Versprechen konnte Jair Lapid von Jesh Atid (Es gibt eine Zukunft) Bennet aus dem Netanjahu-Block herauslösen. Zwar glaubt kaum einer, dass das Bündnis, dem auch die linken Parteien Meretz (Elan) und Avoda (Arbeitspartei) angehören, vier Jahre hält. Sollte es aber durch die ersten beiden Regierungsjahre kommen, würde der liberale Außenminister Lapid im Jahr 2023 Bennett als Ministerpräsidenten ablösen.
Ein politisches Projekt hält die neue Regierung nicht zusammen, sie ist zunächst einmal getrieben davon, die Ära Netanjahu tatsächlich strukturell zu beenden. Seit zwei Jahren haben dessen Übergangsregierungen keinen Haushalt mehr aufgestellt, die vielen Wahlkämpfe haben das Land in eine tiefe institutionelle Krise getrieben; den Krieg gegen die Hamas hat eine parlamentarisch nicht mehr legitimierte Regierung geführt. Überschattet wird das Regierungsversagen Netanjahus von seinen Korruptionsverfahren. Nicht nur die Glaubwürdigkeit des Ministerpräsidenten hat darunter gelitten, sondern auch das Vertrauen in die politische Klasse insgesamt, was auch den Nachfolgern Netanjahus das Regieren schwermachen wird. Dass Yair Lapid zunächst darauf verzichtet, die Regierung zu führen, obwohl seine Zukunftspartei Jesh Atid mit 17 Knesset-Sitzen die stärkste Kraft der Achtparteienregierung stellt, rechnen ihm viele hoch an.
Allzu große Hoffnungen in eine Wiederbelebung des Nahost-Friedensprozesses sollte man an das neue Kabinett allerdings nicht verschwenden. Hier könnte sich die Dominanz des rechten Blocks um Avigdor Lieberman von Yisrael Beitenu (Unser Zuhause Israel), Gideon Saar von Tikva Chadascha (Neue Hoffnung) und von Ministerpräsident Bennett selbst negativ bemerkbar machen. Sie unterstützen alle die Annexion von Teilen des Westjordanlands, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Bennett war Vorsitzender der gemeinsamen Dachorganisationen der israelischen Siedler, bevor er 2012 den Likud verließ und sich der nationalreligiösen Partei HaBayit HaYehudi (Jüdisches Heim) anschloss. Die systematische Zersiedelung der besetzten Gebiete folgt dem ideologischen Kern des rechten Programms, das von Verhandlungen mit der palästinensischen Seite nichts wissen will.
Flickenteppich Palästina
Unter dem Strich wird Israel deshalb wohl auch unter der ersten Nach-Netanjahu-Regierung weiter wachsen, das Rumpfgebiet eines potentiell souveränen palästinensischen Staates weiter schrumpfen. Während keinem der vier Wahlkämpfe seit 2019 war die seit dem Sechstagekrieg 1967 anhaltende Besatzung ein Thema. Dabei bleibt der Alltag von Millionen Palästinensern von Ausbeutung und Demütigungen geprägt. Zugleich wächst die Zahl israelischer Siedlungen – eine Million Israelis sollen nach dem Wunsch rechter Politiker bis 2030 in den besetzten Gebieten leben. Territorial zerschnitten und zerfranst sind diese schon heute; die mit den Abkommen von Oslo 1993 und 1995 verbundene Hoffnung, hier entstünde ein eigenständiger Staat, hat sich mehr als ein Vierteljahrhundert später längst zerschlagen. Stattdessen ist Palästina ein Flickenteppich, zusammengesetzt aus 160 wirtschaftlich kaum überlebensfähigen, politisch hochexplosiven Enklaven.
Inwieweit der zentristische Block um Außenminister Lapid und Verteidigungsminister Benny Gantz von Kahol Lavan (Blau-Weiß) internationale Verhandlungen wieder in Erwägung zieht, wird stark von der US-amerikanischen Regierung abhängen. Joe Biden hat bislang nicht signalisiert, dass er dem Nahostkonflikt politisch größeres Gewicht beimessen wird als seine Vorgänger Donald Trump und Barack Obama. Den schleichenden Rückzug aus dem Nahen und Mittleren Osten begann Amerika unter seinem ersten schwarzen Präsidenten; mit dem Abzug aus Afghanistan endet zwanzig Jahre nach 9/11 eine lange Phase neoimperialistischer Überdehnung – und der längste Krieg der US-amerikanischen Geschichte.
Der liberale Internationalismus, der noch in den 1990er Jahren die Außenpolitik Bill Clintons bestimmte, ist in den beiden Dekaden des Kriegs gegen den Terror ebenfalls über Bord gegangen. Dabei wäre eine Rückbesinnung auf die Ziele, die bei der Nahostkonferenz von Madrid im Sommer 1991 noch in der Hoffnung auf die Durchsetzung einer werte- und regelbasierten multilateralen Ordnung getroffen wurden, bitter notwendig.
Das Erbe, das Trump in der Region hinterlässt, ist schwerer einzuordnen. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen Israels mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrein, Marokko und Sudan war ein Durchbruch; die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt und Israels als rechtmäßiger Souverän auf den Golanhöhen hingegen wird sich kaum revidieren lassen.[1] Das sind schwere Niederlagen für Verfechter einer auf internationalen Verträgen und UN-Resolutionen basierenden Zweistaatenlösung. Diese Kräfte zu stärken, allen voran die Vereinten Nationen, obliegt künftig noch stärker der Europäischen Union als den USA.
Abu Dhabi einbinden
Welche Rolle die Bundesrepublik dabei spielen wird, ist derzeit noch offen. Fest steht aber, dass sowohl einem künftig von den Grünen, der FDP oder der CDU geführten deutschen Außenministerium ein stärkeres regionalpolitisches Engagement in Nahost die Gelegenheit böte, die besonderen Beziehungen Berlins zu den Vereinigten Arabischen Emiraten stärker friedenspolitisch auszurichten – nicht nur mit Blick auf den Krieg in Syrien, der vor zehn Jahren begann, sondern auch auf Israel. Die von Trump forcierte Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Jerusalem und Abu Dhabi im Oktober 2020 bekräftigten Israels damaliger Außenminister Gabi Aschkenasi und sein Kollege aus den Emiraten, Abdullah bin Zayed, vor dem Holocaust-Mahnmal in Berlin – im Beisein von Bundesaußenminister Heiko Maas, dessen Ansehen auf palästinensischer Seite durch seine uneingeschränkte Unterstützung der israelischen Luftangriffe während des Gaza-Kriegs im Mai schwer gelitten hat.
An die Annäherung an Abu Dhabi aber sollte auch die kommende Bundesregierung anknüpfen. In den ersten Jahren des Syrienkriegs arbeiteten deutsche Diplomaten eng mit ihren Kollegen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen – wenn diese Kooperation künftig auch auf israelische Beamte ausgeweitet würde, wäre das ein Fortschritt. Um das Vakuum zu füllen, das die USA zwischen Irak und Israel hinterlassen, sind die Emirate ein wichtiger Akteur. Eine wertegeleitete Außenpolitik für Nahost muss deshalb strategisch Abschied nehmen von der Vorstellung, dass die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und arabischen Staaten erst auf einen Friedensschluss zwischen Israel und einem palästinensischen Staat folgen könne. Zumal die Friedensabkommen Ägyptens 1979 und Jordaniens 1994 mit Israel zeigen, dass die arabische Seite hier nie eine einheitliche Linie verfolgte.
Eine stärkere Ausrichtung Israels an die Emirate und möglicherweise bald auch an Saudi-Arabien könnte durch einen Faktor gestärkt werden, der wirklich neu ist in der ersten Regierung nach Netanjahu: Mit der Vereinigten Arabischen Liste des Politikers Mansur Abbas stützt zum ersten Mal eine arabische Kraft eine israelische Regierung.
Der jüdisch-arabische Schulterschluss ist sowohl auf rechter jüdischer wie auf linker arabischer Seite umstritten. Während Netanjahus Likud den Rechtsnationalisten Saar und Bennett vorwirft, mit „Terroristen“ zu koalieren, beklagen Politiker der linken Chadash-Partei den Ausverkauf Abbas‘ an jene Kräfte, die noch vor drei Jahren in der Knesset Arabisch als Amtssprache abschafften. Das Nationalstaatsgesetz von 2018 räumt außerdem nur noch dem jüdischen Volk das Recht auf nationale Selbstbestimmung ein – Oslo wirkt vor diesem Hintergrund wie eine Fata Morgana.[2]
Mansur Abbas ist es gelungen, umgerechnet 13 Mrd. Euro für unterentwickelte arabische Gemeinden in den Koalitionsverhandlungen zu sichern. Ob die materiell motivierte Annäherung Abbas‘ an den jüdischen Mainstream auf Dauer den Kampf um gleiche Bürgerrechte stärkt oder schwächt, lässt sich zu Beginn der jüdisch-arabischen Partnerschaft in der Regierung nicht prognostizieren. Es ist ein pragmatischer Kurs, bei dem Werte unter den Tisch fallen könnten, dem aber auch die Chance innewohnt, festgefahrene Wege zu verlassen.
In einem optimistischen Szenario gelänge es der etwas anderen israelischen Regenbogenkoalition so, tatsächlich eine neue politische Ära nach zwölf Jahren Netanjahu einzuleiten. Diese müsste nach mehr als einem halben Jahrhundert Besatzung deren Ende wieder in den Blick nehmen – und helfen, die demokratischen Strukturen eines künftigen palästinensischen Staats zu stärken. Angesichts der Erosionsprozesse, die die israelische Demokratie in den vergangenen Jahren unter Netanjahu durchlief, könnten sowohl die beiden linken Parteien Avoda und Meretz, aber auch die zentristischen Politiker von Jesh Atid und Kahol Lavan eine wichtige Rolle einnehmen, rechtsstaatliche Prinzipien wieder mehr Geltung zu verleihen – inner-israelisch wie international.
Ein Jahrzehnt rechter Hetze
Für ein pessimistischeres Szenario lieferten die Ausschreitungen beunruhigende Anzeichen, die im Schatten des Gaza-Kriegs im Mai in vielen binationalen Gemeinden tobten. Sie sind das Ergebnis eines Jahrzehnts rechter Hetze, die nicht nur Netanjahu beförderte. Auch der neue Ministerpräsident, Naftali Bennett, verglich noch 2018 Palästinenser mit Moskitos: „Wenn du sie tötest, gelingt es dir, 99 von ihnen zu töten, und der hundertste Moskito, den du nicht tötest, tötet dich. Die echte Lösung ist deshalb, den ganzen Sumpf auszutrocknen.“
Die Ära Netanjahu ist also noch lange nicht zu Ende. Seit seinen ersten Wahlkämpfen in der ersten Hälfte der 1990er Jahre hat der heute 71jährige gegen eine Verhandlungslösung mit der palästinensischen Seite mobilisiert. Ihm ist es in den vergangenen Jahren gelungen, das Thema international so nachhaltig in den Hintergrund zu rücken, dass sich kaum noch einer daran erinnert, wie in den Jahren zwischen Netanjahus erster und zweiter Regierungszeit Ariel Scharon den Abzug aus dem Gazastreifen durchsetzte oder sich Ehud Barak und Ehud Olmert weiter um einen Friedensschluss bemühten. Nicht nur mit der palästinensischen Seite übrigens, sondern auch mit Syrien: Bis ins Detail lagen die Pläne zum Grenzverlauf zwischen dem See Genezareth und den Golanhöhen bei den von der Türkei in Ankara vermittelten Gesprächen 2008 vor.
Regionale Friedenslösungen sichern
Immerhin hat die Aufnahme normaler zwischenstaatlicher Beziehungen zwischen Israel, den Emiraten, Bahrein, Marokko und Sudan seit Herbst 2020 die Grundlagen für ein stärkeres diplomatisches Engagement verbessert. Die EU sollte das Zeitfenster nutzen, um den Fokus zu weiten: auf regionale Friedenslösungen, die das Herz des alten Nahostkonflikts nicht aus dem Blick verlieren – den anhaltenden Kriegszustand Israels mit Syrien und dem Libanon.
In der neuen israelischen Regierung gibt es dafür linke und liberale Partner, aber auch an rechtsstaatlichen Prinzipien orientierte konservative Kabinettsmitglieder. Ihre Politik gegenüber den rechtsnationalistischen Kräften zu stärken, muss die Europäische Union sich für die kommenden Monate auf die Fahne schreiben. Nur so kann das Momentum nach dem Abgang Netanjahus für eine neue internationale Verhandlungsinitiative genutzt werden.
[1] Vgl. Markus Bickel, Hauptfeind Iran: Israel und die neue sunnitische Achse, in: „Blätter“, 12/2020, S. 11-14.
[2] Vgl. dazu Tsafrir Cohen, Israel: Der Auftritt der Generäle, in: „Blätter“, 4/2019, S. 37-40.