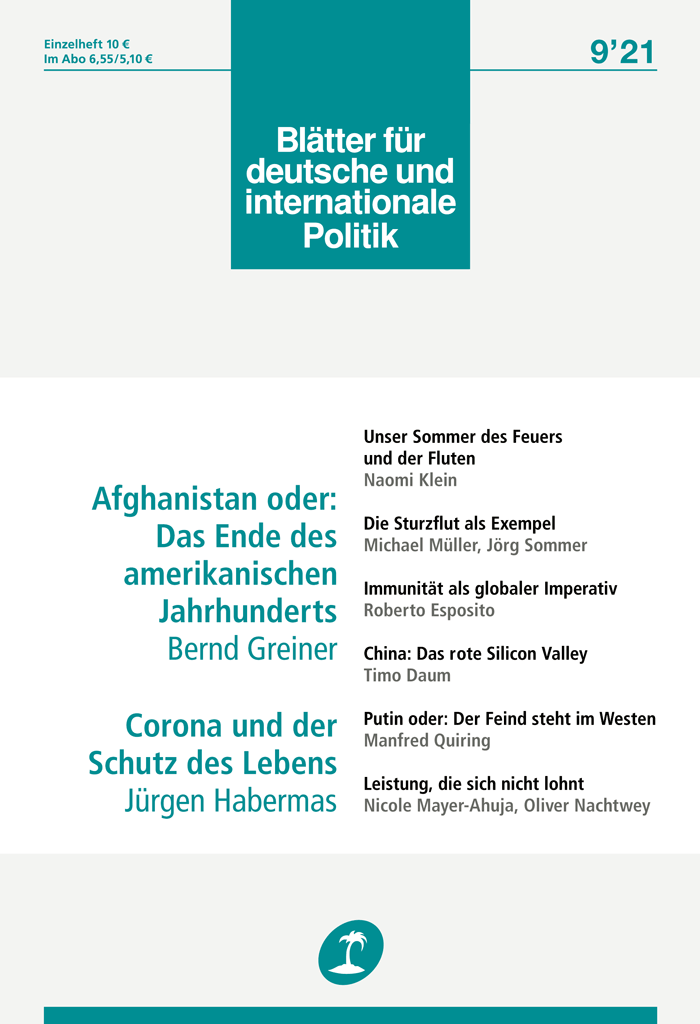Bild: Gnu im Serengeti Nationalpark, Tansania (IMAGO / blickwinkel)
Der Druck könnte höher kaum sein: Im Herbst will die Weltgemeinschaft gleich zwei Mal zusammenkommen, um eine existenzielle Bedrohung für große Teile der Menschheit sowie für hunderttausende weitere Arten abzuwenden: Vom 11. bis zum 24. Oktober findet im chinesischen Kunming zunächst der UN-Biodiversitätsgipfel statt, auf dem die Verhandler einen zehn Jahre umfassenden Fahrplan für den weltweiten Artenschutz festlegen wollen. Vom Ausgang des Gipfels hängt ab, ob der dramatische Verlust der Artenvielfalt in der Welt – verursacht durch den Verlust von Habitaten, den Einsatz von Pestiziden, Wilderei und den Folgen des Klimawandels – gestoppt werden kann.
Nur eine Woche danach beginnt der UN-Klimagipfel in Glasgow. Hier sollen die teilnehmenden Länder verschärfte Pläne vorlegen, wie sie bis zum Jahr 2030 ihre CO2-Emissionen zu mindern gedenken. Zwar verpflichteten sich mit dem Pariser Klimavertrag im Jahr 2015 rund 195 Länder weltweit dazu, die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Doch den Worten sind bislang keine Taten gefolgt: Die CO2-Emissionen stiegen weiter von Jahr zu Jahr an, zuletzt nur kurzfristig leicht gedämpft durch die Corona-Pandemie. Sollte die Wende nicht gelingen, droht der Welt ein Klimachaos, das sich schon heute in Form von immer neuen Hitzerekorden, langanhaltenden Dürren und verheerenden Überschwemmungen abzeichnet.[1]
Noch immer behandeln Politikerinnen sowie viele Umweltschützer und Wissenschaftlerinnen die Arten- und Klimakrise fatalerweise getrennt voneinander. Dieser Missstand geht auf den Mai 1992 zurück, als auf dem historischen UN-Umweltgipfel in Rio die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt nicht nur die Klimarahmenkonvention verabschiedeten, die seither die Grundlage für den internationalen Klimaschutz bildet, sondern auch eine in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannte Konvention beschlossen: das Übereinkommen über die biologische Vielfalt. Während die jährlichen Klimagipfel trotz einiger Rückschläge immer stärker an Gewicht gewannen und vor sechs Jahren ihren Höhepunkt im Pariser Klimaabkommen fanden, fristen die Biodiversitätsgipfel bis heute eher ein Nischendasein. Damals war noch nicht klar, wie eng beide Sphären miteinander verbunden sind und sich gegenseitig bedingen, weshalb sich die zwei Konventionen erst einmal unabhängig voneinander entwickelten. Beide Krisen lassen sich aber, wie man heute immer besser versteht, nur gemeinsam lösen.[2]
Das liegt zum einen an zahlreichen Synergien zwischen Klimaschutz und Artenschutz: Um die Erderwärmung auf ein erträgliches Maß zu begrenzen, reicht es nicht mehr aus, sich „nur“ weltweit von fossilen Energien zu lösen und stattdessen auf erneuerbare Energien zu setzen. Vielmehr müssen dafür auch die Ökosysteme einbezogen werden: Allein die Landökosysteme speichern rund ein Viertel der Treibhausgase, die der Mensch Jahr für Jahr ausstößt. Wissenschaftler sprechen von den sogenannten naturbasierten Lösungsmöglichkeiten.
Tiere als Klimaschützer
Die wichtigste Rolle spielen dabei Wälder, vor allem die großen borealen Wälder in Nordamerika und Sibirien sowie die Regenwälder in Brasilien, Zentralafrika und Südostasien. Mehr als sieben Prozent der Treibhausgase, die in einem Jahr in die Atmosphäre gelangen, entstehen durch Brandrodungen, zuletzt vor allem in Indonesien und Brasilien. So verwandelt sich der Amazonas-Regenwald derzeit sogar von einer Klimasenke zu einer Klimaquelle, er gibt also mehr CO2 ab, als er absorbiert.
Aber auch Grasland und Savannen, Feuchtgebiete und Mangrovenwälder gelten als Wunderwaffe im Kampf gegen den Klimawandel. Feuchtgebiete bedecken rund sechs bis neun Prozent der Erdoberfläche und enthalten über ein Drittel des globalen terrestrischen Kohlenstoffs. Solche Gebiete zu schützen bzw. zu restaurieren gilt unter Wissenschaftlern als eine der kostengünstigsten und schnellsten Methoden, um Klimaschutz zu betreiben, Ökosysteme besser gegen den Klimawandel zu wappnen und den Menschen vor Überschwemmungen, Bodenerosionen oder Trinkwasserverschmutzungen zu schützen.
Allerdings – und das steht auf den UN-Klimagipfeln bisher nicht auf der Agenda – kommt es bei alledem auch darauf an, was in den Wäldern, Wiesen oder Ozeanen lebt. Umweltwissenschaftlerinnen erkennen immerhin zunehmend die Bedeutung der Tiere für den Klimaschutz, egal ob diese in den borealen Nadelwäldern des hohen Nordens leben oder in den Tropenwäldern und Savannen Afrikas.
Denn ohne die Tiere verlöre die Biosphäre ihre Fähigkeit, Kohlendioxid zu binden. Waldelefanten, Tapire, Vögel sowie unterschiedlichste Säugetiere befördern etwa die Verteilung von Baumsamen. Wissenschaftler bezeichnen den Verlust der Tiere durch Wildtierjagd, Abholzung und Brände deshalb als „zusätzliche, stille Bedrohung“ für unser Klima.
Besonders eindrucksvoll ist die Fähigkeit der Tiere als Klimaschützer in der Serengeti zu beobachten: In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rafften Wilderei und Rinderpest drei Viertel der damals 1,2 Millionen Gnus der Savanne dahin. Infolgedessen konnten die Gräser ungehindert in die Höhe sprießen, bis die Trockenzeit kam und fast die gesamte Vegetation jedes Jahr aufs Neue abbrannte. Nachdem die Rinder Anfang der 1960er Jahre rund um den Nationalpark geimpft wurden, erholte sich der Gnu-Bestand in Tansania wieder. Die Tiere knabberten die Gräser fleißig ab, verdauten diese und schieden die Pflanzenreste wieder aus.
In der Folge verwandelte sich die Serengeti von einer CO2-Quelle in eine CO2-Senke. Denn wenn die Gnus Gräser abäsen, wachsen diese nicht mehr so hoch und fangen seltener Feuer. Wissenschaftler um Oswald Schmitz vom Institut für Wald- und Umweltstudien an der Yale-Universität in New Haven errechneten, dass diese Einsparung in etwa die gesamten jährlichen CO2-Emissionen Ostafrikas aufwiegt.
Eric Dinerstein von der US-Denkfabrik Resolve sieht im Pariser Klimaabkommen deshalb nur „ein halbes Abkommen“: „Es wird nicht allein die Vielfalt des Lebens auf der Erde retten oder Ökosystemleistungen erhalten, von denen die Menschheit abhängt“, schrieb der Ökologe 2019 im Fachblatt „Science Advances“. „Es ist auch auf natürliche Klimalösungen angewiesen, die außerhalb des Paris-Abkommens gestärkt werden müssen.“
Andersherum hilft es den Tieren und Pflanzen, je stärker wir die globale Erwärmung begrenzen. Schon heute wirkt sich der Klimawandel weltweit massiv auf Lebewesen aus. Diese versuchen zwar, sich auf die Erwärmung einzustellen, indem sie ihren Jahresrhythmus neu justieren oder vorübergehend in weniger heiße Mikrorefugien flüchten bzw. – und das war auch während früherer Klimawechsel in der Erdgeschichte die bevorzugte Strategie – langfristig in kühlere Gefilde abwandern.
Die Flucht vor dem Klimawandel
Schon jetzt lässt sich beobachten, dass Tiere und Pflanzen überall auf der Welt in Richtung der Pole, die Berge hinauf und die Ozeane hinabströmen. Landbewohner legen dabei im Schnitt rund 17 Kilometer, Meeresbewohner sogar 72 Kilometer pro Jahrzehnt zurück. Für mehr als 10 000 Arten haben Biologen diese Völkerwanderung der Arten bereits nachgewiesen. Weil aber nicht alle im Gleichschritt marschieren, sondern selbst innerhalb einer Art oder einer Population unterschiedlich schnell gewandert wird, bilden sich ganz neue Artengemeinschaften, die Gewinner und Verlierer hervorbringen.
Hinzu kommt, dass die Ausweichfläche nicht unendlich groß ist. Wer die Polargebiete, einen Berggipfel, das Flachland der Tropen oder eine Insel bewohnt, befindet sich früher oder später in einer Sackgasse und ist dann der zunehmenden Hitze schutzlos ausgeliefert. Dies sind darum auch die Orte, in denen zukünftig die meisten Arten aussterben werden.
Der Weltbiodiversitätsrat schätzt, dass durch den Klimawandel eine Million der insgesamt acht Millionen bekannten Arten auf der Welt vom Aussterben bedroht sind. „Der menschengemachte Klimawandel wird zunehmend zum dominanten Faktor bei der direkten Bedrohung der Natur und ihrer Dienstleistungen für die Menschen“, schreiben führende Wissenschaftler des Weltklimarats IPCC und des Weltbiodiversitätsrats IPBES in einem Bericht, den sie im vergangenen Juni vorstellten. Es war die erste gemeinsame Analyse beider UN-Gremien, die den mehr als 190 Mitgliedstaaten übergeben wurde. Der 300seitige Bericht betont, dass beide globalen Probleme unmittelbar zusammengehören: „Wer die unzertrennbare Natur von Klima, Biodiversität und menschlicher Lebensqualität ignoriert, erzielt für keine der Krisen optimale Lösungen“, so die eindringliche Mahnung.
Denn ohne ein abgestimmtes Vorgehen können Klimaschutzmaßnahmen dem Artenschutz auch massiv schaden: Werden etwa Windturbinen an den falschen Stellen aufgebaut und ungenügend gesteuert, können sie tausende Zugvögel zerschreddern. Werden auf artenreichen Wiesen Einheitsforste hochgezogen, kann dies die Biodiversität empfindlich verringern.
Eine weitere Gefahr lauert in der Zukunft: Der Weltklimarat sieht in den meisten seiner Szenarien für das 1,5- oder Zwei-Grad-Ziel die massenhafte Abscheidung von CO2 aus der Atmosphäre vor. Um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, müssten beispielsweise 18 Prozent der Landoberfläche mit Maisfeldern überzogen werden, damit die Pflanzen der Atmosphäre Kohlendioxid entziehen. Nach ihrer Ernte würden sie zur Stromgewinnung verbrannt, so die Theorie, und das dadurch entstandene CO2 unter die Erde gepresst. Dafür fehlt es allerdings sowohl an überzeugender Technik als auch an ausreichend geeigneten Untergründen, von den potentiellen Gefahren ganz zu schweigen. Zudem verlören wir damit auch den erforderlichen Platz für den Nahrungsmittelanbau, auf den eine wachsende Weltbevölkerung dringend angewiesen ist, und auch für Tiere und andere Pflanzen würde der Lebensraum noch enger.
Platz aber ist gerade das, was die Arten brauchen, um vor dem Klimawandel zu fliehen. Weil der Mensch inzwischen jedoch die Hälfte der Landoberfläche des Planeten bebaut und mit Acker- oder Weideflächen überzogen hat, stecken viele Tiere und Pflanzen buchstäblich fest. Besonders dramatisch ist die Lage in den tropischen Regenwäldern Südamerikas, Afrikas und Asiens, die durch Holzeinschlag und Brandrodungen immer stärker fragmentieren, wodurch die Tiere keine Ausweichmöglichkeiten mehr haben.
Schutzzonen der Zukunft
Die Schutzgebiete auf der Welt reichen längst nicht aus, die Artenvielfalt zu retten. Beispiel Europa: Mit Hilfe von Artenverbreitungsmodellen prognostizierten Makroökologen und Modellierer vor einigen Jahren, dass die meisten Wirbeltiere und Pflanzenarten in den europäischen Schutzgebieten schon im Jahr 2080 ungeeignete Klimabedingungen vorfinden könnten – insbesondere in den oft kleinteiligen Natura-2000-Gebieten, die dahingehend manchmal sogar noch schlechter abschnitten als die vollkommen ungeschützten Gebiete um sie herum. Es reicht also nicht, nur die Flächen zu schützen, auf denen heute schon besonders viele Arten leben, sondern es müssten auch solche geschützt werden, auf denen die Arten in Zukunft vorzufinden sein werden. Und die bestehenden Areale müssten zudem mit den neuen verbunden werden, um eine Wanderung zwischen diesen zu ermöglichen. Für die USA wurden entsprechende potentielle Wanderrouten bereits auf Karten festgehalten, in Europa fehlen diese bislang noch.
Die UN-Artenschutzkonferenz Ende Oktober bietet nun die Chance, einen ersten Schritt in diese Richtung zu unternehmen: Auf ihr sollen mehr Flächen unter Schutz gestellt werden – und zwar insgesamt 30 Prozent der Erdoberfläche bis 2030. Derzeit sind es gerade einmal 15 Prozent der Landfläche und 7,5 Prozent der Meeresgebiete, wobei viele der Flächen mal mehr, mal weniger vom Menschen weitergenutzt werden. Auch heißt ein formeller Schutzstatus nicht, dass die Gebiete tatsächlich geschützt werden, dafür bräuchte es obendrein eine vernünftige Überwachung und Verwaltung.
Um das zu ermöglichen, ist es nicht unbedingt sinnvoll, Menschen per se aus Schutzgebieten auszusperren. Erfolgversprechender ist es, wenn die lokale Bevölkerung eingebunden und mit dem Schutz der Gebiete betraut wird. Das zeigt unter anderem ein Blick in jene Gebiete, in denen indigene Völker leben: Dort geht die Artenvielfalt laut wissenschaftlichen Studien deutlich langsamer zurück als im Rest der Welt.
Allerdings bringen den bedrohten Arten auch noch so viele Fluchtwege nichts, wenn der Klimawandel ungehindert voranschreitet. Viele Arten sind schlicht zu langsam, um mit dem rasanten Tempo der Erderwärmung mithalten zu können, die der Mensch mit der Verbrennung fossiler Energiequellen vorantreibt.
Es braucht somit beides: Würden wir die Hälfte der Erdoberfläche unter strengen Schutz stellen und die Erderwärmung zugleich auf unter zwei Grad Celsius begrenzen, so ließe sich das Aussterberisiko in den artenreichsten Gebieten der Welt laut US-Wissenschaftlern um immerhin drei Viertel senken. Das bedeutet zwar, dass noch immer hunderttausende Arten aussterben würden. Aber künftige Generationen könnten dann – zumindest in Grundzügen – noch eine Welt vorfinden, die der heutigen einigermaßen ähnelt, also weiterhin vielfältig und lebenswert ist. Ob diese Hoffnung aber überhaupt berechtigt ist, müssen die beiden Umweltgipfel im Herbst beweisen.
[1]. Vgl. die Beiträge von Naomi Klein sowie Michael Müller und Jörg Sommer in dieser Ausgabe.
[2] Vgl. dazu das kürzlich erschienene Buch des Autors: Die Natur auf der Flucht. Warum sich unser Wald davonmacht und der Braunbär auf den Eisbär trifft. Wie der Klimawandel Pflanzen und Tiere vor sich hertreibt, München 2021.