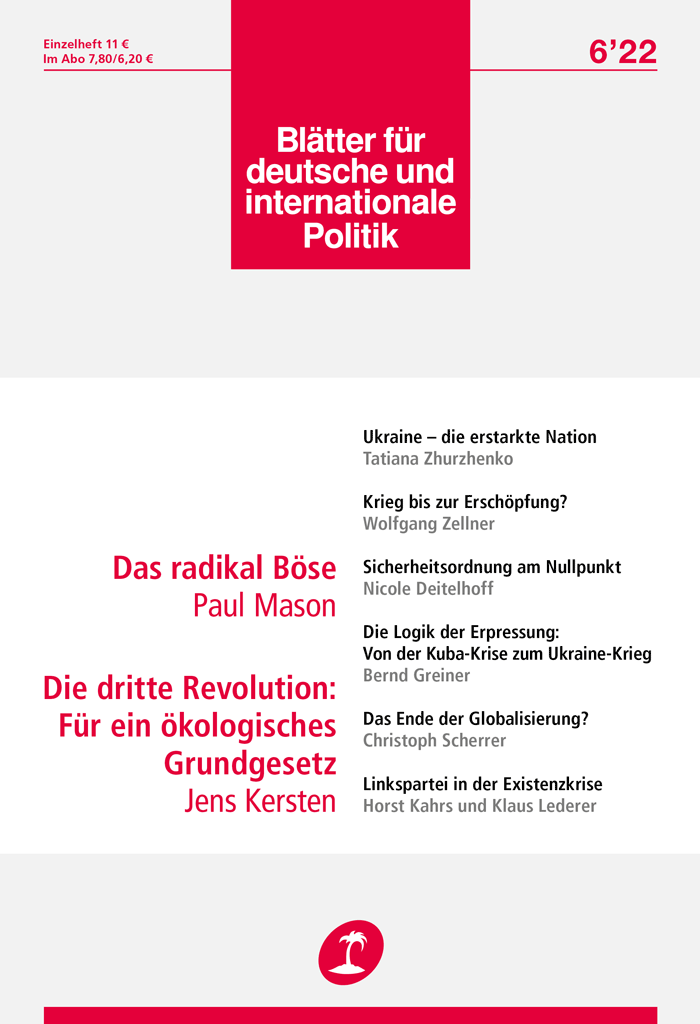Krieg und Widerstand im ukrainischen Diskurs

Bild: Ein ukrainischer Soldat schwenkt eine ukrainische Flagge aus einem russischen Kettenfahrzeug, 13.5.2022 (IMAGO / ZUMA Wire)
Seit dem 24. Februar leben vierzig Millionen Ukrainer in einer neuen Wirklichkeit. Während die Mehrheit der Russen der Kreml-Propaganda von einer kurzen „militärischen Spezialoperation“ ohne zivile Opfer glaubte, war den im ganzen Land von Sirenen und Explosionen geweckten Ukrainern vom ersten Tag an klar, dass Krieg herrschte. Russlands Invasion hat das Leben aller Ukrainer dramatisch verändert, ob sie im okkupierten Cherson, im unter Dauerfeuer liegenden Kharkiv, im verwüsteten Mariupol oder im von Flüchtlingen überfüllten Lviv leben. Wie reagiert man, wenn plötzlich das bisherige Leben in Trümmern liegt und die Zukunft völlig ungewiss ist? Und was, wenn dies einer Gesellschaft zustößt, die durch die jahrelange aggressive Politik seines östlichen Nachbarn bereits traumatisiert ist?
Nach dem ersten Schock weichen Wut und Verzweiflung der nüchternen Einsicht, dass der Krieg so bald nicht enden wird. Die Menschen passen sich der neuen Realität an, machen wieder Pläne. Und in der ukrainischen Öffentlichkeit artikulieren sich erste Versuche, den Krieg zu verstehen und einzuordnen. Worum geht es in diesem Krieg? Begann er wirklich am 24. Februar oder vielleicht doch viel früher? Wer führt diesen Krieg, Putin oder die Russen? Was macht er mit uns als Gesellschaft, als Nation? Für was kämpfen wir? Und wie könnte ein Sieg aussehen?
In den ersten Wochen der Invasion fragten sich die Ukrainer, ob die russische Bevölkerung den Krieg unterstützt. Kaum jemand machte sich Illusionen über Putins Regime, aber es war für viele schwer zu glauben, dass der Überfall auf ein benachbartes „Brudervolk“ – so bis dahin die Kreml-Rhetorik – von der russischen Bevölkerung gutgeheißen wird. Und wenn doch, war das vielleicht nur ein anfänglicher Propagandaerfolg? Würden die Menschen in Russland nicht doch ihre Meinung ändern, wenn sie die Wahrheit erführen?
Für die Ukrainer waren dies existenzielle Fragen. Bereits in der Nacht des 24. Februar appellierte Präsident Wolodymyr Selenskyj, „nicht als Präsident, sondern als Ukrainer“, an die russischen Bürger, einen Krieg zu verhindern, der auch für Russland katastrophale Folgen haben würde. Auch in den folgenden Tagen forderte er die Nachbarn wiederholt auf, gegen die Invasion zu protestieren. Doch Massenproteste blieben aus, und in den ukrainischen Medien verbreiteten sich Enttäuschung und Wut. Viele Ukrainer riefen ihre Verwandten in Russland an, um ihnen von den Schrecken zu berichten, deren Zeugen sie geworden waren – nur um zu erfahren, dass man dort eher dem russischen Fernsehen traute. Mit dem Fortgang des Krieges zeigte sich immer deutlicher, dass die russische Bevölkerung die „militärische Spezialoperation“ passiv, aber mehrheitlich unterstützte. Und die Zustimmung steigt: Nach einer Umfrage des staatlichen russischen Meinungsforschungsinstituts VCIOM am 25. Februar äußerten 65 Prozent ihre Zustimmung, am 30. März waren es bereits 76 Prozent, und nach einer Umfrage des unabhängigen Lewada-Zentrums waren am 11. April sogar 81 Prozent dafür. Einige westliche Politiker hielten zunächst daran fest, dass russische Normalbürger diesen Krieg nicht wollten und daher auch nicht für ihn verantwortlich gemacht werden sollten. Dies stieß in den ukrainischen Medien auf Unverständnis und Kritik: Es reiche nicht aus, allein Putin und sein Regime vor Gericht zu stellen, vielmehr stelle sich die Frage der kollektiven Verantwortung. Zudem sei es an der Zeit, dass die russische Gesellschaft ihre Vergangenheit aufarbeite und sich von ihren imperialen Ambitionen verabschiede.[1]
Die Entdeckung der Kriegsverbrechen in Butscha und anderen Vorstädten Kiews markiert einen Wendepunkt in dieser Debatte. Für die Menschen in der Ukraine, die sich schon fast an die wochenlange Bombardierung ihrer Städte gewöhnt hatten, waren die Berichte von den Plünderungen und Massenmorden, von Folter und Vergewaltigung durch das russische Militär ein neuer Schock. Bei vielen riefen diese Verbrechen Erinnerungen daran wach, wie die russische und die sowjetische Armee in der Vergangenheit Zivilbevölkerungen behandelt haben – in Syrien, in den Tschetschenienkriegen, in Ostdeutschland am Ende des Zweiten Weltkriegs und in Galizien im Ersten Weltkrieg. Wie konnte man sich das ungeheuerliche Verbrechen, für das Butscha steht, erklären? „Russlands Bevölkerung hat sich erfolgreich selbst entmenschlicht“, meinte Jurij Andruchowytsch in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.[2] Für andere verkörpern die Russen gar eine Kultur von Vergewaltigern und Plünderern.[3] Ein Video von russischen Soldaten, die ihre Beute von einer Poststation an der belarussischen Grenze nach Hause schicken, verbreitete sich in den sozialen Medien. Rubzowsk, eine arme Provinzstadt in Sibirien, in die die meisten Pakete mit geplünderten Fernsehern und Staubsaugern gingen, wurde zu einem negativen Sinnbild für die „russische Welt“.
Die Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung riefen auch historische Parallelen zu den Verbrechen der Nazis in der sowjetischen Ukraine wach. In den ukrainischen Medien wurde der vom Begriff „Faschismus“ abgeleitete Neologismus „Ruschismus“ (рашизм) populär, um die Russen als Angreifer und Besatzer zu kennzeichnen.[4] Einige Journalisten bestanden jedoch darauf, keine Umschreibungen zu benutzen, sondern den Feind beim Namen zu nennen: „Russen“.[5] Spätestens seit Butscha ist in den Augen der Ukrainer die Frage der Mitverantwortung der russischen Bevölkerung beantwortet. In einem Interview mit russischen Journalisten sagte Präsident Selenskyj, dass sich die Einstellung der Ukrainer gegenüber den Russen irreparabel zum Schlimmsten gewendet habe, auch in den russischsprachigen Regionen. Wir haben es, sagte er, „mit einem radikalen historischen und kulturellen Bruch zu tun“. [6]
Wann hat der Krieg begonnen?
Die russische Invasion am 24. Februar hat das Leben der Ukrainer radikal geteilt: Es gibt ein Davor und es gibt ein Danach. Der Krieg wurde abrupt, brutal und unentrinnbar zur neuen Alltagswirklichkeit. Doch es gab deutliche Vorboten: als Putin die sogenannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine offiziell anerkannte; als er seine berüchtigte Rede hielt, in der er die Legitimität des ukrainischen Staates leugnete; als er wiederholt die ukrainische Regierung verächtlich machte und bedrohte; als die Kriegswarnungen der westlichen Partner lauter wurden und die ukrainischen Medien begannen, Lagepläne lokaler Luftschutzkeller und Ratschläge für das Anlegen von Notvorräten zu veröffentlichen. Zugleich demonstrierte die Regierung allerdings Zuversicht und Optimismus, um die Bevölkerung zu beruhigen. Die Menschen versuchten, die Vorzeichen des Krieges zu ignorieren und ihr friedliches Leben weiterzuleben.
Für viele von ihnen war das Leben aber auch bis dahin nicht sehr friedlich gewesen. Schon 2014, nach dem Ende des Janukowytsch-Regimes und kurz vor der Annexion der Krim, beschwor die Entscheidung des russischen Parlaments, der Duma, den Einsatz des russischen Militärs auf dem Territorium der Ukraine zu erlauben, das Gespenst eines Krieges zwischen beiden Ländern herauf. Russland setzte jedoch zunächst auf einen inneren Konflikt in der Ukraine. Von einem „Bürgerkriegs“-Szenario erhoffte man sich die territoriale Auflösung des ukrainischen Staates. Gegen alle Beweise behauptete Russland, im Donbass-Konflikt nicht auf Seiten der Separatisten militärisch involviert zu sein, und präsentierte sich als Vermittler und Friedenswächter. Die Ukraine zahlte einen hohen Preis in diesem Konflikt, den niemand einen Krieg nennen wollte. Er forderte 14 000 Tote, und ein großer Teil der Bevölkerung musste aus Donezk und Luhansk fliehen. Für die Ukrainer, die nahe der Front blieben oder regelmäßig die sogenannte Kontaktlinie überquerten, für die ukrainischen Soldaten an der Front und für die Freiwilligen und Journalisten, die im Donbass arbeiteten, war der Krieg bereits Alltagsrealität, als die Menschen im Rest des Landes noch ein normales, friedliches Leben führen konnten.
Mit der russischen Invasion am 24. Februar ist aus dem halb verdeckten Konflikt ein offener Krieg geworden. Der Schock des Angriffs warf ein grelles Licht auf die von vielen verdrängte Tatsache, dass die Ukraine schon seit acht Jahren in einem Krieg mit Russland lebte. Man kann sogar behaupten, dass der Krieg noch früher begann. Der ukrainische Journalist Roman Romaniuk schreibt: „Was jetzt geschieht, ist unser letzter Maidan. Der Maidan von 2004 [die Orangene Revolution] und der von 2013/14 waren in Wahrheit Proteste gegen Putin. Denn beim ersten Mal sollte sein Handlanger Präsident werden, und beim zweiten Mal wollte dieser den Kurs des Landes drehen und es Putin in die Arme werfen. Daher ist dieser Krieg gegen Putin unser letzter Maidan.“[7] Andere ziehen sogar Parallelen zu Ereignissen in der Geschichte der Sowjetunion. So weckt der Krieg für Dzhamala, eine Sängerin krimtatarischer Herkunft, Assoziationen mit der tragischen Geschichte ihres Volkes. Sie gewann 2016 den Eurovision Song Contest mit ihrem Lied „1944“, in dem es um die Deportation der Krimtataren unter Stalin geht. Das Lied war als Protest gegen die Annexion der Krim gemeint und wurde auch so verstanden. Dzhamala musste jetzt mit ihren Kindern fliehen und ihren Mann zurücklassen. Nun reist sie mit dem Lied durch Europa, um Spenden für die Ukraine einzusammeln. Auf die Frage der ukrainischen „Vogue“, welche neue Bedeutung „1944“ nach der Invasion bekommen habe, antwortete sie: „Vor dem Krieg war das meine persönliche Geschichte – ein Lied über die Vertreibung meiner Urgroßmutter aus der Krim. Aber die Geschichte wiederholt sich. Fast 80 Jahre später haben wir wieder Eindringlinge zu Hause, gekommen, um zu zerstören, zu morden, auszuhungern, zu vergewaltigen, alles mit der Behauptung, ‚nicht verantwortlich‘ zu sein. Heute ist das unglücklicherweise ein Lied über die ganze Ukraine.“[8]
Angesichts von Berichten, dass Russland plane, die Ernte in den besetzten Gebieten zu enteignen, erinnerte der ukrainische Philosoph Volodymyr Yermolenko an den Holodomor, die vom Sowjetregime herbeigeführte Hungersnot in der Ukraine 1932/33. „Das ist nicht einfach Völkermord. Es ist ein wiederholter Völkermord. Ein Völkermord zum zweiten, dritten, fünften, zehnten Mal. Weil er nie verurteilt und nie bestraft wurde. Weil damals, nach 1932/33, niemand ‚Nie wieder!‘ sagte zu diesem Bösen.“ Yermolenko rückt den Holodomor in die russische Tradition imperialer Unterdrückung: „Das Böse von Iwan, Peter, Katharina, Nikolaus, Vladimir, Joseph, Vladmir. Unbestraft, nie bereut und unerlöst wird dieses Böse auf ewig durch die Welt wandern. Denn es findet keinen Ausgang. Es wurde nicht in die Hölle gesperrt. Das ist der Grund, warum sie jetzt dieselbe Sprache gebrauchen: ‚die Ernte enteignen‘. Denn sie wurden nicht für den Holodomor bestraft. Daher die Parole ‚Wir können es wieder tun‘. Es ist ein Böses, das sich wieder und wieder aus dem Grab erhebt. Daher Z – das Zombie-Böse.“[9]
Die Vorstellung, dass der gegenwärtige Konflikt nur ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte des Kampfs der Ukraine gegen Russlands imperiale Unterdrückung sei, ist nicht neu. In den Jahren nach dem Euromaidan – den erfolgreichen Protesten zugunsten der von Janukowytsch gestoppten Hinwendung zur EU 2013/2014 – propagierte das Ukrainische Institut für Nationale Erinnerung (UINP) das Narrativ eines hundertjährigen Krieges gegen Russland. Der Euromaidan sollte demnach als eine Fortsetzung der Ukrainischen Revolution von 1917-21 verstanden werden. Deren Ziel war die Gründung eines unabhängigen ukrainischen Staates, aber sie wurde vom bolschewistischen Russland niedergeschlagen.[10]
Seit der russischen Invasion am 24. Februar hat der Topos vom hundertjährigen Krieg an Popularität gewonnen. Am 21. April stellte das ukrainische Kulturministerium einen Videoclip online, der ein Narrativ vom ukrainischen Märtyrertum und Widerstand konstruiert. Es zieht sich durch die gesamte sowjetische und postsowjetische Geschichte: vom bolschewistischen Krieg gegen die Ukrainische Volksrepublik von 1917-21 über den Holodomor und Stalins Repressionen in der sowjetischen Ukraine, den nationalistischen Untergrund während des Zweiten Weltkriegs und danach, den Kampf der Dissidenten für die Unabhängigkeit 1991 bis hin zur russischen Aggression von 2014 und zum jetzigen Krieg.[11] Volodymyr Viatrovych, der ehemalige Direktor des UINP und heutige Parlamentsabgeordnete, rekapitulierte das Narrativ und argumentierte: „Die Ukraine war nie so stark wie heute, Russland musste nie so große Verluste einstecken, und die Welt hat nie zuvor so viel Solidarität und aktive Unterstützung gezeigt. Dies bietet uns die Chance, unseren langen, hundertjährigen Krieg für die Unabhängigkeit endlich zu gewinnen.“[12]
Vaterländischer Krieg? Unabhängigkeitskrieg?
Allerdings drängte sich Millionen von Ukrainern am ersten Kriegstag eher ein anderer historischer Bezug auf. Der unvermittelte Angriff am frühen Morgen, die Ankündigung des Kremls, Kiew in einem Blitzkrieg einzunehmen, das Ausmaß der Zerstörung und des menschlichen Leids schon in den ersten Tagen ließen an den Überfall Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion 1941 denken. Die Ältesten erinnern sich daran noch und den nachkommenden Generationen ist er aus Familienerinnerungen, Schulbüchern, Filmen, Romanen vertraut. Die ukrainische Journalistin Nataliya Gumenyuk besuchte kürzlich einige vom ukrainischen Militär zurückeroberte Städte und Dörfer in der Nähe von Kiew und sprach mit den Anwohnern über ihre Erfahrungen unter der russischen Okkupation. Sie versucht zu erklären, warum ältere Menschen die russischen Soldaten oft als „Deutsche“ oder „Faschisten“ bezeichnen.[13] Für sie wiederhole sich in der Besatzung durch eine fremde Macht, welche die lokale Bevölkerung ihrer Rechte und ihrer Würde beraubt und sie Zeugen oder Opfer von Plünderungen, Entführungen, Folter, Vergewaltigung und massenhaftem Mord werden lässt, das Muster der nazi-deutschen Invasion vor 80 Jahren. Die bittere Ironie des heutigen Krieges ist, dass Russland ihn unter der Fahne der „Befreiung der Ukraine vom Faschismus“ führt und sich dabei auf den Mythos des „Großen Vaterländischen Kriegs“ stützt. Dieser Mythos fungierte in der Sowjetunion als offizielles Narrativ des Zweiten Weltkriegs: der unter dem Genossen Stalin vereinte heroische Widerstand von Volk, Roter Armee und Kommunistischer Partei gegen die Aggression Nazi-Deutschlands. Fragmente dieses Narrativs – vor allem der Beitrag des Volkes zum Sieg – haben das Sowjetregime überlebt und wurden auch von vielen Ukrainern internalisiert. In der Ukraine hat sich inzwischen allerdings eine pluralistische und oft kontroverse Erinnerungskultur herausgebildet und es wurden Anstrengungen unternommen, das europäische Narrativ vom Zweiten Weltkrieg als Tragödie zu übernehmen. In Russland ist dagegen der triumphalistische Mythos vom „Großen Vaterländischen Krieg“ zur tragenden Säule der postsowjetischen nationalen Identität geworden und wird vom Kreml eingesetzt, um den Status Russlands als Großmacht zu unterstreichen. Am deutlichsten zeigt sich das am Stellenwert des 9. Mai, dem „Tag des Sieges“; als wichtigstem Feiertag, an dem sich das Land ostentativ als große Militärmacht präsentiert.
Für viele Ukrainer liegt die Bezeichnung „vaterländischer Krieg“ für den gegenwärtigen Konflikt nahe, auch wenn hier das sowjetische/russische Narrativ anklingt. Sie assoziieren „vaterländisch“ eher mit dem Willen von Millionen Ukrainern, ihr Land gegen einen brutalen Aggressor zu verteidigen. „Für uns Ukrainer ist dies ein vaterländischer Krieg. Wir erinnern uns, wie solche Kriege beginnen. Und wir wissen, wie sie enden – für die Invasoren“, sagte Selenskyj bereits am 3. März in seiner täglichen Rede an die ukrainischen Bürger.[14] Drei Tage später erließ er ein Dekret, das den neuen Titel „Heldenstadt der Ukraine“ einführte. Volnovakha, Hostomel, Mariupol, Kharkiv, Kherson und Chernihiv erhielten den Titel für den Heldenmut und den Widerstandswillen, den die Bürger dieser Städte gegen den russischen Angriff gezeigt hatten.[15] Mit diesem Akt bezog sich der ukrainische Präsident offensichtlich auf eine sowjetische Tradition. In der Nachkriegszeit wurde im Zuge der Institutionalisierung des „Großen Vaterländischen Krieges“ einem Dutzend Städte der Titel „Heldenstadt“ verliehen. Vier davon befanden sich auf dem Territorium der sowjetischen Ukraine: Odessa, Kiew, Sewastopol und Kertsch. Die Tradition wurde im postsowjetischen Russland mit einer langen Liste von „Städten militärischen Ruhms“ fortgesetzt, die so im selben Geiste verspätet für ihren Beitrag zum Sieg geehrt wurden. Bis zu Selenskyjs Dekret hatte die Ukraine dergleichen Titel nicht verliehen. Viele waren deshalb irritiert und sahen in der Fortsetzung der sowjetischen Tradition einen politischen Fehler. Am deutlichsten äußerte sich Viatrovych. Der Begriff „Heldenstadt“ sei untrennbar mit dem von Russland usurpierten sowjetischen Narrativ verbunden und damit also mit dem Narrativ des Feindes. Sobald die Ukrainer davon Gebrauch machten, befänden sie sich in einem gemeinsamen ideologischen Raum mit Russland. Er schlug vor, stattdessen eine neue, eigene Tradition zu stiften und einen alternativen Titel wie etwa „Stadt der Unbeugsamen“ zu prägen. Nicht nur in den Augen Viatrovychs bot die Invasion eine Gelegenheit, die Dekommunisierung des öffentlichen Raums abzuschließen und sich der letzten Überbleibsel des Mythos vom Großen Vaterländischen Krieg zu entledigen.[16]
Europäischer Krieg? Krieg für Europa?
Im öffentlichen Diskurs der Ukraine ist die Überzeugung zentral, dass es sich beim gegenwärtigen Krieg nicht einfach um eine militärische Auseinandersetzung handelt, sondern um einen zivilisatorischen Konflikt um Europa. Dies geht zurück auf den Euromaidan-Protest gegen die Entscheidung der Janukowytsch-Regierung, die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der EU zu verschieben – worauf Russland gedrängt hatte. Die Proteste weiteten sich aus und im Zuge des Kampfes gegen Polizeigewalt, Korruption und autoritäre Herrschaft identifizierte sich die Euromaidan-Bewegung zunehmend mit europäischen Werten von Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung. In den Folgejahren zahlte die Ukraine für ihre europäischen Aspirationen einen hohen Preis; zugleich machte sie signifikante Fortschritte bei der wirtschaftlichen und politischen Annäherung an die EU. Die 2017 von der EU gewährte Visafreiheit öffnete den Schengen-Raum für viele, die vorher kaum eine Chance gehabt hatten, Westeuropa zu besuchen: jüngere Leute, Geringverdienende, Menschen aus den östlichen und südlichen Teilen des Landes. In der Folge assoziierten die Menschen die positiven Entwicklungen mit der Europäisierung der Ukraine, während sie die Hauptprobleme des Landes – vor allem den Krieg im Donbass – mit der russischen Aggression verbanden.
Im Konflikt mit Russland nahmen die Ukrainer die Rolle Europas allerdings als ambivalent wahr. Einerseits wussten sie die Sanktionen gegen Russland, die Nichtanerkennung der Annexion der Krim und die finanzielle, institutionelle und moralische Unterstützung seitens der westlichen Nachbarn zu schätzen. Andererseits waren sie aber enttäuscht von deren Halbherzigkeit und realpolitischer Orientierung. Es war den europäischen Regierungen nicht gelungen, Russlands Ambitionen einzudämmen oder den Konflikt im Donbass beizulegen. Trotzdem setzten sie ihre Kooperation mit Putins Regime fort, vor allem im Energiesektor – insbesondere das Nord-Stream- 2-Projekt – lief klar den ukrainischen Interessen zuwider. Politik und Medien der Ukraine erinnerten immer wieder daran, dass das Land im Donbass Europas Außengrenze verteidige und für die europäischen Werte kämpfe, doch diese Argumente beeindruckten die Öffentlichkeiten und politischen Eliten in der EU kaum. Ihnen erschien der Krieg im Donbass nur als ein weiterer Konflikt im postsowjetischen Raum. Die Ausweitung des Konflikts auf die ganze Ukraine hat für beide Seiten vieles geändert. Die EU-Länder begannen ihre Appeasement-Politik gegenüber Putin zu überdenken. Sie einigten sich rasch auf Sanktionen gegen Russland und öffneten ihre Grenzen für Flüchtlinge. Die Drohgebärden Moskaus richteten sich auch gegen den Westen und so erschien die Behauptung Kiews, dass die Ukraine nicht nur das eigene Land, sondern das europäische Projekt verteidige, nicht mehr so absurd. Die Überzeugung, dass deshalb die Unterstützung der Ukraine nicht nur moralisch geboten sei, sondern auch der Verteidigung der EU diene, fand insbesondere in Polen und den baltischen Staaten ein positives Echo. Dort ist die Befürchtung verbreitet, sie könnten das nächste Ziel Putins sein.
Gleichwohl zögerten die EU-Staaten in den ersten Wochen, die Ukraine auch militärisch zu unterstützen, weil sie eine Eskalation zu einem europäischen Krieg vermeiden wollten. Dieses Zögern rief bei manchen Ukrainern einen alten Topos vom Verrat Europas wach. 1931 beschuldigte der ukrainische Exildichter Oleksandr Oles (1878 bis 1944) Europa in einem Gedicht, die Lösung der „ukrainischen Frage“ nach dem Ersten Weltkrieg versäumt zu haben. Das Gedicht entstand am Vorabend des Holodomor nach dem ersten Jahrzehnt bolschewistischer Herrschaft in der Ukraine und endet: „Als die Ukraine ihr Leben verfluchte / Und ein Massengrab wurde / Als selbst der Teufel weinte / Schwieg Europa.“ Erst nach der Zerstörung Mariupols und den Massakern von Butscha und anderswo änderte sich die Stimmung in der EU zugunsten einer massiveren militärischen Unterstützung.
Das Narrativ, die Ukraine verteidige auch die Freiheit Europas, gewann also an Überzeugungskraft. Eine Folge davon war, dass die bis dahin so fern und unrealistisch erscheinende Frage einer EU-Mitgliedschaft der Ukraine es auf die Tagesordnung schaffte. Präsident Selenskji bat um ein beschleunigtes Aufnahmeverfahren. Eine Zusage erhielt er zwar nicht, aber Anfang April reiste Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Kiew und brachte den Fragebogen zur Beantragung der Mitgliedschaft mit, was als symbolischer Auftakt des Beitrittsprozesses gilt.
Die kollektive Erfahrung des Krieges hat dazu beigetragen, dass die Ukrainer ihr Land nicht mehr als Objekt geopolitischer Interessen sehen, sondern als politisches Subjekt. Ukrainische Intellektuelle argumentieren, dass die Ukraine nicht als Bürde für die EU gesehen werden sollte, sondern als Chance, die Krise des europäischen Projekts zu lösen, als Inspirationsquelle für das künftige Europa. Der Philosoph Volodymyr Yermolenko ist davon überzeugt, dass der Krieg die Ukraine stärker und weiser machen wird. Die existentielle Erfahrung an der Grenze zwischen Leben und Tod werde ein neues Denken und eine neue Kultur hervorbringen, eine neue Vision von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat. „In vielen Fragen, in denen wir uns als Schüler der großartigen europäischen Kultur fühlten, sehen wir uns nun als ihre Lehrer.“[17]
Nichts wünschen sich die Ukrainer mehr als ein Ende des Krieges. Aber wie könnte dieses aussehen? Als die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine kurz nach Beginn der Invasion begannen, fragten sich Experten im Westen sogleich, zu welchen Konzessionen die Ukraine wohl bereit sein würde. Es war nicht einfach, den westlichen Medien, aber auch vielen öffentlichen Intellektuellen zu erklären, dass die russischen Forderungen so absurd sind, dass sie die Verhandlungen zu einer Farce machten. Während die Frage einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine noch rational diskutiert werden könnte, schien die Forderung nach ihrer „Entnazifizierung“ und „Demilitarisierung“ einem russischen Skript zur Wiederaufführung des Zweiten Weltkriegs entsprungen zu sein. Die ukrainische Öffentlichkeit war auch nicht bereit, Russland territoriale Konzessionen zu machen. Jede Preisgabe von Land würde den Feind nur dazu einladen, sich mehr zu nehmen.
Welcher Sieg? Wann endet der Krieg?
Nach den ersten Wochen des Kampfes trugen mehrere Faktoren zu einem neuen Konsens bei. Die Ukraine kann den Krieg nicht einfach nur beenden, sondern sie kann – und soll – ihn gewinnen. Russlands Aussichten auf einen schnellen Sieg schwanden, seine „militärische Spezialoperation“ zog sich hin, mit hohen Kosten für den Angreifer. Die motivierte und professionell operierende ukrainische Armee konnte den Vormarsch der Invasoren verlangsamen oder stoppen und in mehreren Fällen sogar besetztes Territorium zurückerobern. Dabei erhält die Ukraine inzwischen starke internationale Unterstützung. Gesellschaft und Staat zeigen eine bemerkenswerte Widerstandfähigkeit. Im Gegensatz zu 2014 gibt es keine prorussische Mobilisierung und keine Unterstützung der Besatzer „von unten“. Kaum jemand scheint bereit, mit den Invasoren zu kollaborieren. Hinzu kommt, dass Russlands Kriegsverbrechen keinen Zweifel mehr daran lassen, dass es um die Vernichtung der Ukraine geht und ihre Kapitulation daher keine Option ist. Zumal der Kreml und die offiziellen Medien Russlands sie mit einer Rhetorik des Genozids begleiten.[18]
Wenn die Ukraine also auf einen Sieg hoffen kann und nicht einfach nur auf ein Ende des Krieges, wie sähe er aus? Am 22. April wurde diese Frage einigen öffentlichen Intellektuellen auf Ukrinform.ua gestellt.[19] Ihre Antworten stimmen in einem Punkt überein: Es wäre ein Erfolg für die Ukraine, wenn sie die Kontrolle über die seit dem 24. Februar von Russland besetzten Gebiete zurückgewinnen könnte. Ein echter Sieg aber sei erst mit der Wiederherstellung der Grenzen von vor 2014 erlangt. Dies sei allerdings ein fernes Ziel, das nicht allein militärisch erreicht werden könne, sondern diplomatische Anstrengungen erfordere. Es geht also um einen Prozess. Einige äußerten, dass der Sieg den Abschluss eines Friedensabkommens voraussetze, das nicht nur eine Pause vor der nächsten Konfrontation gewähre. Es müsse eine Welt schaffen, in der Russland keine Bedrohung mehr darstelle. „Wie sollte eine solche Lösung aussehen? Sie läuft auf die Entmachtung Putins, den Rückzug der russischen Armee, eine Anklage der Kriegsverbrecher hinaus. Die russische Bedrohung wird erst verschwinden, wenn es grundlegende Veränderungen in der Russischen Föderation gibt.“
Dies würde einen Regimewechsel und demokratische Transformationen in Russland bedeuten, die, anders als 1990, irreversibel sein sollten. Für viele ukrainische Kommentatoren ist die wichtigste Voraussetzung für einen stabilen Frieden, dass Russland sich von der Vorstellung eines Imperiums verabschiedet. Nach Auffassung des ukrainischen Historikers Yaroslav Hrytsak sollte in der neuen Ordnung Russland seine Vorstellung aufgeben, eine eigenständige, besondere Zivilisation zu sein, und endlich ein normales Land werden, das als Nuklearmacht unter internationale Kontrolle gestellt wird.[20] In den ukrainischen Medien und sozialen Netzwerken wird lebhaft und emotional über eine mögliche Desintegration der Russischen Föderation spekuliert. „Unser strategisches Ziel sollte nicht einfach sein, den Angriff zu überleben, sondern der russischen Gesellschaft eine Art Ukraine-Syndrom einzuimpfen, ähnlich dem Vietnam-Syndrom in den USA oder dem Afghanistan-Syndrom in der späten Sowjetunion. So etwas ist zwar kein Allheilmittel gegen Militarismus und Messianismus, aber ein guter Impfstoff“, meint der Journalist Mykhailo Dubynianskyi in der „Ukrainska Pravda“. [21] Würde der Krieg gegen die Ukraine in Russland mit wirtschaftlicher Not und sinnlosen menschlichen Verlusten assoziiert, verginge vielleicht die Lust auf eine neue Aggression. Die Ukrainer unterschätzen allerdings gerne die Risiken eines solchen Szenarios durch die damit entstehende Instabilität. Realisten warnen ohnehin davor, auf die Demokratisierung oder Auflösung der Russischen Föderation zu hoffen.
Insgesamt ist die Zuversicht groß, dass die ukrainische Nation selbstbewusster und geeinter aus dem Krieg hervorgehen wird. Zur positiven Bilanz der Kriegserfahrung gehört nämlich, dass die Ukrainer sich ihrer Stärken bewusst geworden sind: Solidarität und Bürgersinn, Ablehnung von Autoritarismus und Liebe zur Freiheit. Hinzu kommt ein neu gewonnenes Vertrauen in die politische Führung, in die lokale Selbstverwaltung und in die Armee. Viele glauben, dass diese Stärken nicht nur zum Sieg beitragen, sondern dem Land auch helfen werden, die Reformen abzuschließen, der Korruption ein Ende zu machen und einen angemessenen Platz in Europa einzunehmen. In diesem Sinne geht es im öffentlichen Diskurs über den Krieg nicht nur um Leid und Opfer; vielmehr wird der Krieg auch als eine Chance gesehen. Gewiss, man kann solche Überlegungen leicht als Wunschdenken abtun. Schließlich nährte der Euromaidan ähnlich hochfliegende Hoffnungen, dass die ukrainische Gesellschaft endlich auf dem Weg in eine stabile und demokratische Zukunft sei. Dieser Weg hat sich als ziemlich holprig erwiesen. Von außen betrachtet scheint die gegenwärtige Lage den Ukrainern wenig Anlass zu Optimismus zu geben. Doch ist jetzt der Moment, in dem die Konturen einer europäischen Nachkriegsordnung für die nächsten Jahrzehnte gezeichnet werden, und der Moment für die Ukraine, ihren Platz in dieser Ordnung zu finden.
[1] So etwa der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, der Direktor des Instituts für Nationale Erinnerung, Anton Drobovych, und der Filmregisseur Oleh Sentsov: Кулеба: За війну проти України відповідальніросіяни, а не лише Путін, www.dw.com/uk, 18.3.2022; Anton Drobovych, Русофобия как новая норма?, www.pravda.com.ua, 15.3.2022; Про колективну відповідальність росіян за події в Україні, www.espreso.tv, 13.4.2022.
[2] Alles, was wir sehen, zeugt von Entmenschlichung, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ), 8.4.2022.
[3] So beispielsweise Tetyana Vodotyka, Цивілізація мародерів. Чому росіяни так легко привласнюють і нищать чуже майно, www.tyzhden.ua, 19.4.2022.
[4] Vgl. dazu Timothy Snyder, The War in Ukraine Has Unleashed a New Word, in: „New York Times Magazine“, 22.4.2022.
[5] So z.B. Vadym Karpiak, Чому слід називати ворогів росіянами, а не „рашистами“, www.novynarnia.com, 7.4.2022.
[6] Это не просто война. Все гораздо хуже, www.meduza.io, 27.3.2022.
[7] Roman Romaniuk, Ця війна проти путіна — це наш остаточний Майдан, www.pravda.com.ua, 29.3.2022.
[8] Усі виступи тепер — наче останні, www.vogue.ua, 20.4.2022.
[9] Volodymyr Yermolenko, „Можем повторить“ — це вони й про Голодомор, www.gazeta.ua, 28.4.2022.
[10] Vgl. Tatiana Zhurzhenko, Neuerfindung und Entsorgung. Ukraine: Die Revolution 1917 im Lichte des Majdan, in: „Osteuropa“, 6-8/2017, S. 273-289.
[11] 100 Років російсько-українській війні, YouTube-Kanal des Ministeriums für Kultur und Informationspolitik der Ukraine, 21.4.2022.
[12] Volodymyr Viatrovych, Iсторія протистояння, а не братерства. Чому сталася ця війна?, www.nv.ua, 22.3.2022.
[13] Nataliya Gumenyuk, Sie nennen sie die Deutschen, in: „Die Zeit“, 16.4.2022.
[14] Для нас це вітчизняна війна, www.president.gov.ua, 3.3.2022.
[15] Dekret des Präsidenten der Ukraine Nr. 111/2022, 6.3.2022, ebd.
[16] Навіщо нам совєтський штамп „місто-герой“? www.facebook.com/volodymyr.viatrovych, 13.4.2022.
[17] Volodymyr Yermolenko, Війна зробить нас сильнішими. Відчуємо себе вчителями європейської культури, www.gazeta.ua, 28.3.2022.
[18] Vgl. die Dokumentation des Textes von Timofej Sergejzew in: „Blätter“, 5/2022, S. 63-69.
[19] Якою буде перемога, і якою стане Україна після перемоги? ukrinform.ua, 22.4.2022.
[20] Ярослав Грицак: Україна стане новим центральноєвропейським тигром, www.pravda.com.ua, 1.5.2022.
[21] Mykhailo Dubynianskyi, Український синдром, www.pravda.com.ua, 6.3.2022.