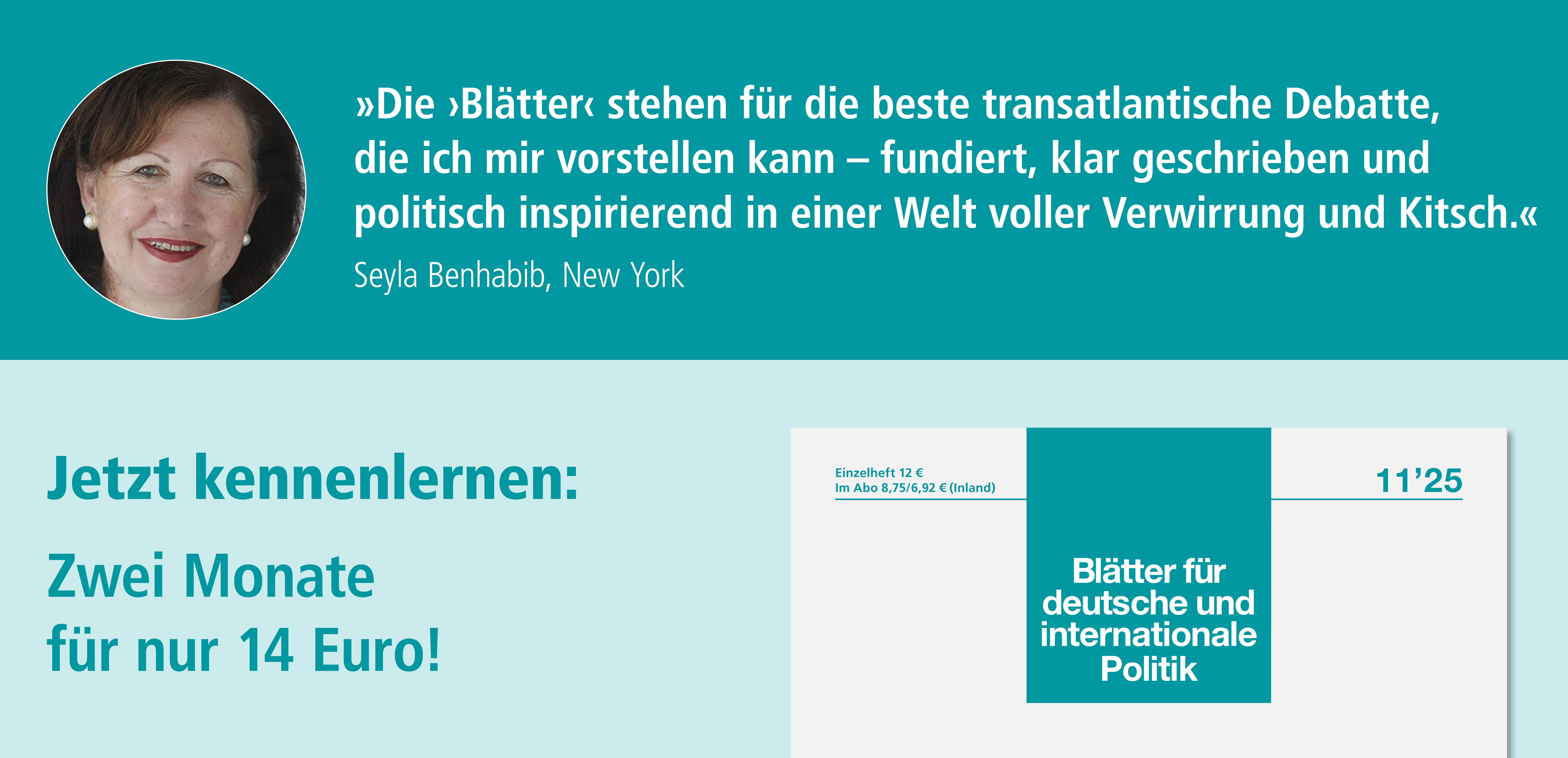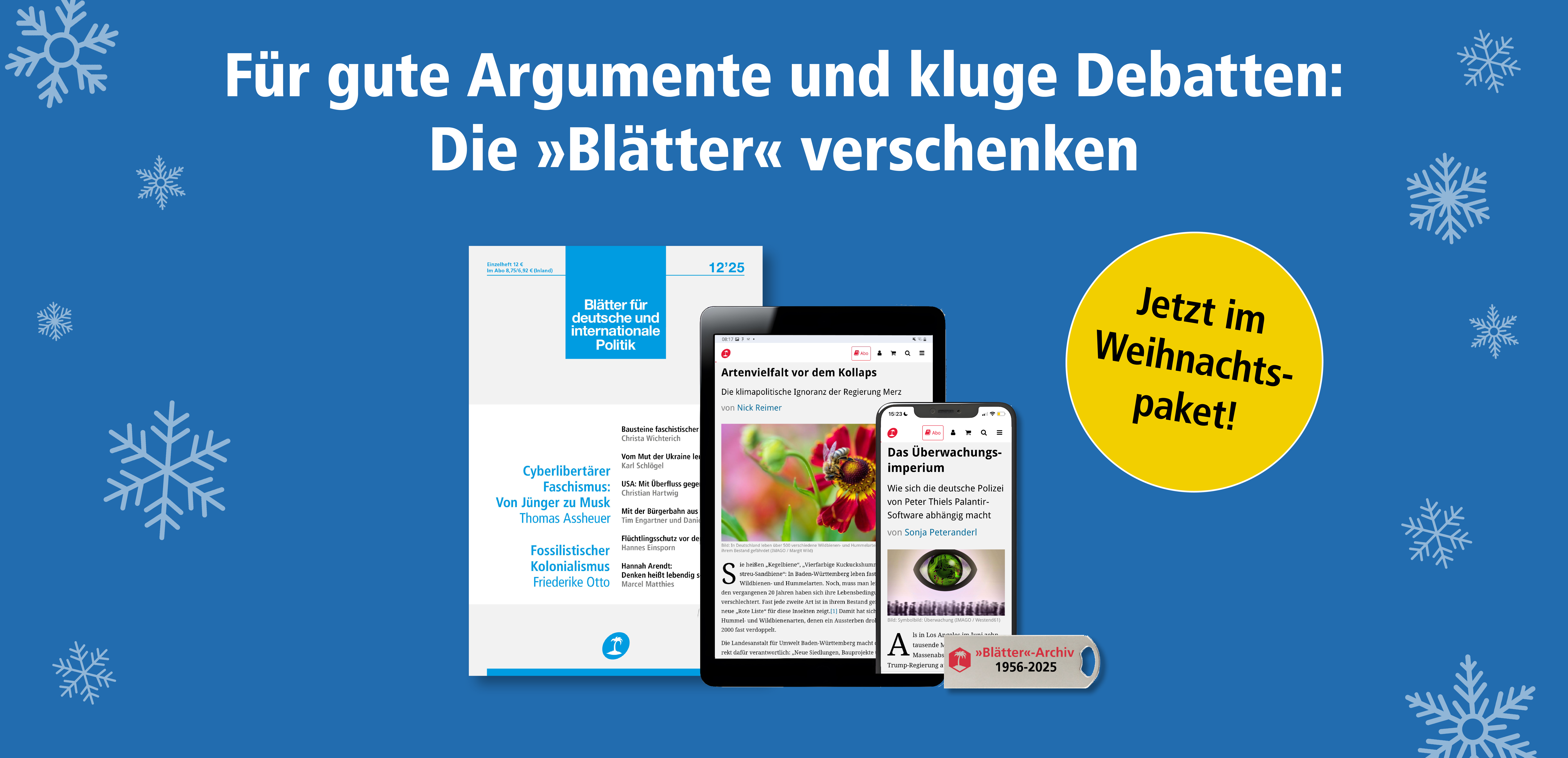Bild: Protest während Netanyahus Besuch in Berlin, 16.3.2023 (IMAGO / Daniel Reiter)
In den 1990er Jahren guckte ich im israelischen Fernsehen gern die Satiresendung „Ha-Chamishia Ha-Kamerit“. Mein Lieblingssketch handelte von den Olympischen Spielen: Eine israelische Delegation verlangt vom deutschen Kampfrichter, dem kleinen israelischen Athleten an der Rennstrecke einige Meter Vorsprung vor den anderen Sportlern zu geben, die alle größer sind. Der Deutsche lehnt das ab, die Israelis versuchen es daraufhin mit emotionaler Erpressung: „Kill me, I’m a Jew“ – töte mich doch, ich bin Jude –, ruft einer, und ein anderer fragt: „Haven’t the Jews suffered enough?“ – Haben die Juden nicht genug gelitten?[1] Der Sketch bringt zum Ausdruck, was viele Israelis denken: Die Deutschen sollen ihre historische Schuld durch Zugeständnisse an Israel abbezahlen. Wenn nicht mit Vorteilen bei den Olympischen Spielen, dann mit militärischer und politischer Unterstützung.
Auch in Deutschland scheint diese Vorstellung in der Politik mittlerweile Konsens zu sein. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte die Sicherheit Israels in einer Rede 2008 vor der Knesset sogar zur „deutschen Staatsraison“, dies wurde von allen Parteien im Bundestag unterstützt. Die Diskussion im Parlament anlässlich der 70-Jahr-Feier zur Gründung des Staates Israel 2018 zeigte diesen Konsens deutlich.[2] Martin Schulz (SPD) erklärte: „Indem wir Israel schützen, schützen wir uns selbst vor den Dämonen der Vergangenheit unseres eigenen Volkes.“ Volker Kauder von der CDU sekundierte: „Mit dem Existenzrecht Israels verteidigen wir nicht nur dieses Land und diesen Staat, sondern auch die Demokratie und den Rechtsstaat.“ Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen) sagte: „Die Existenz Israels ist unmittelbar verbunden mit der Existenz unseres Landes als freie Demokratie und deswegen unsere Verantwortung. Wir müssen der Garant Israels als Staat sein, als Deutsche.“ Bijan Djir-Sarai (FDP) erklärte: „Für die deutsche Außenpolitik sind die Sicherheit und das Existenzrecht des Staates Israel unverhandelbar.“ Und Dietmar Bartsch (Die Linke) sprach von Deutschlands „moralischer Pflicht, dem Staat Israel solidarisch zur Seite zu stehen“. Sogar von Rechtsaußen kam Zuspruch: Alexander Gauland (AfD), der den Nationalsozialismus als „Vogelschiss“ bezeichnet hatte, nutzte die deutsche Vergangenheit für eine Solidaritätserklärung: „Gerade weil wir auf diese furchtbare Weise [der Holocaust] mit dem Existenzrecht Israels verbunden sind, war und ist es richtig, die Existenz Israels zu einem Teil unserer Staatsraison zu erklären.“ Tatsächlich brüstet sich die AfD auch an anderer Stelle gern mit Solidarität gegenüber Israel – um auf diese Weise gegen Muslime und Araber Stimmung zu machen.
In der deutschen Bevölkerung ist die Verpflichtung zum Staat Israel allerdings umstritten. Bei einer „Stern“-Umfrage 2012 sagten 60 Prozent der Befragten, Deutschland habe keine besondere Verpflichtung gegenüber Israel. Nur jeder Dritte (33 Prozent) hielt eine besondere Verantwortung für gegeben.[3] Der Aussage „Vor dem Hintergrund der Geschichte des Holocaust hat Europa eine besondere Verantwortung für Israel“ stimmten 2020 in einer Umfrage 64 Prozent der Israelis, aber nur 41 Prozent der Deutschen zu.[4]
Es scheint, als seien die Politiker moralischer als die Gesamtbevölkerung. Aber ist das wirklich so? Um diese Annahme zu beantworten, muss zunächst die Begründung des Verhältnisses zu Israel kritisch überprüft werden. Denn die Anerkennung des Staats als Repräsentant der Opfer und die politische, wirtschaftliche und militärische Unterstützung wurden zwar stets gern moralisch begründet. Doch in Wirklichkeit war es oft realpolitisches Kalkül, das die deutsche Politik bestimmte.
Verbrechen bloß »im Namen des deutschen Volkes«
1952 kam das Wiedergutmachungsabkommen – oder auf hebräisch „Shilumim“, für „Zahlungen“ – zwischen Israel und Deutschland zustande. Zugleich akzeptierte Israel mit dieser Entscheidung seines Staatsgründers David Ben-Gurion zähneknirschend das von den Deutschen betriebene Narrativ, dass die große Mehrheit der Deutschen in der Nazizeit gegen den Holocaust gewesen war.
Das war ganz im Sinne von Konrad Adenauer. Der erste Bundeskanzler verstand die moralische Verpflichtung gegenüber Israel anders als Angela Merkel: Für ihn beinhaltete sie nicht gleichzeitig eine Anerkennung der moralischen Verantwortung der Deutschen für die Nazi-Vergangenheit.
In seiner Regierungserklärung „Haltung der Bundesrepublik gegenüber den Juden“ am 27. September 1951 vor dem Bundestag sprach Adenauer von dem „Leid, das […] über die Juden in Deutschland und in den besetzten Gebieten gebracht wurde“, als seien es nicht die Deutschen gewesen, die das Leid gebracht und verübt hätten, sondern als sei Deutschland nur zufälliger Tatort. Tatsächlich, führt er weiter aus, seien die Verbrechen auch nur „im Namen des deutschen Volkes“ verübt worden, die Deutschen aber hätten in „überwiegender Mehrheit die an den Juden begangenen Verbrechen verabscheut und sich nicht an ihnen beteiligt“.[5]
Adenauer strickte damit an einer Legende, die so etwas wie die Lebenslüge dieser Generation war, die nicht nur Verantwortung, sondern direkt Schuld trug – und damit war es auch die Lebenslüge der noch jungen Bonner Republik: Nazis, das waren immer die anderen, eigentlich seien die Deutschen größtenteils gegen die Nazis gewesen, und der Name Deutschlands sei von Hitlers „Verbrecherbande“ missbraucht worden. Die Bevölkerung wollte von all dem sowieso so wenig wie möglich wissen und war – im Gegensatz zur Politik – wenig gewillt, eine Entschädigung zu leisten: Im Jahr 1952 befürworteten nur elf Prozent der Deutschen eine Wiedergutmachungszahlung von drei Milliarden Mark in Form von Waren.[6]
Der Kanzler stand mit dieser Sichtweise nicht allein. Adenauer hatte seine Erklärung vom 27. September 1951 dem Bundespräsidenten Theodor Heuss und allen Parteien, die im Bundestag vertreten waren, im Vorfeld zur Stellungnahme zugeleitet. „Sie fand allgemein Billigung. Bundespräsident Heuss war besonders an dieser Frage interessiert“, notierte Adenauer später in seinen Memoiren.[7] Das Bundestagsprotokoll vermerkt „lebhaften Beifall im ganzen Hause außer bei der KPD und auf der äußersten Rechten“. Die folgenden Debattenbeiträge von SPD, CDU, FDP, DP, Zentrum und BP unterstützten Adenauers Erklärung ausdrücklich, am Ende erhoben sich laut Protokoll alle Abgeordneten auf Aufforderung von Bundestagspräsident Hermann Ehlers (CDU), als Zeichen des „Mitgefühl(s) für die Opfer“ und um zu zeigen, dass man „gewillt ist, Folgerungen aus dem, was geschehen ist, zu ziehen“.
Der Konsens unter den Parteien war breit, weil es Betroffenheit ohne echtes Schuldbekenntnis war. Ohnehin ging es den wenigsten im Bundestag um die moralische Schuld, die abgetragen werden sollte. Die Entschädigung der Juden und Israelis war ein Mittel, um das bundesdeutsche Ansehen in der Welt wiederherzustellen, das sprachen auch Wortbeiträge in der auf Adenauers Rede folgenden Debatte deutlich an. Heinrich von Brentano von der CDU, später Innenminister, ging es um die Achtung in der Welt, die davon abhänge, wie viel Achtung Deutschland den Juden entgegenbringe. Bernhard Reismann von der Zentrumspartei beklagte ein „erklärliches Ressentiment“, das „aus der Welt geschafft“ werden müsse.
Adenauer selbst schrieb in seinen Memoiren wiederholt von „moralischer Verpflichtung“ und „Ehrenpflicht“ zu einer Entschädigung, aber er betonte vor allem die Notwendigkeit einer „großzügigen Geste“, die „weniger in ihrem materiellen Wert als vielmehr nach ihrer symbolhaften Bedeutung beurteilt werden müsse“.[8] Die Wiedergutmachung an Israel und den Juden war gemäß Adenauer also vor allem ein Symbol, ein Vehikel, damit die Bundesrepublik Deutschland wieder ihren Platz unter den Nationen einnehmen konnte.
Das entsprach auch der Erwartung der Besatzungsmächte: Der amerikanische High Commissioner John McCloy bezeichnete 1947 die Beziehung der Deutschen zu den Juden als „Lackmustest für die deutsche Demokratie“.[9]
Adenauer war klar: Wenn das Land erst die Anerkennung von jüdischer Seite und an erster Stelle von Israel hätte, wäre der Weg geöffnet zu weiterer selbstständiger Staatlichkeit der Bundesrepublik, zu einer Normalisierung, zu einem Ende des Paria-Status unter den Nationen. Es ging hier also gar nicht so sehr um die Juden und Israel, sondern um das Selbstbild eines demokratisierten, gewandelten Deutschlands: Entnazifizierung – geschafft.
Der Historiker Frank Stern nannte diese Instrumentalisierung der Wiedergutmachung 1992 zutreffend „Whitewashing“, also das Reinwaschen Deutschlands von den Sünden der Naziregierung.[10] Darauf greift auch der Politikwissenschaftler Daniel Marwecki zurück, wenn er analysiert: „Israel wurde benutzt, aber trug auch selbst zum frühen Whitewashing der Bundesrepublik Deutschland bei. Am Ende des Tages war das der Preis, den Israel für deutsche Unterstützung bezahlte.“[11] Beide waren aufeinander angewiesen, notiert der Historiker Dominique Trimbur: „Westdeutschland brauchte Israel als Beweis für seine unerschütterliche Bindung an das demokratische Lager, der jüdische Staat brauchte Westdeutschland, um seiner Isolation im Nahen Osten zu entkommen und sich mit einem Partner mit wachsendem Einfluss in Westeuropa zu verbinden.“[12] Es wird also hochgestochen über Moral gesprochen, dabei geht es eigentlich um machtpolitisches Kalkül.
Wiedergutmachung ohne Anerkennung Israels
Kurioserweise gehörte die formelle Anerkennung des Staates Israel nicht zu den Maßnahmen der Wiedergutmachung. Obwohl sich Israel schon 1956 um diplomatische Beziehungen mit Bonn bemühte, blieb Deutschland bis 1965 die einzige westliche Nation ohne diplomatische Repräsentanz in Tel Aviv.[13] Es bestand die Sorge, dass die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel zu einer Anerkennung der DDR durch die arabischen Staaten führen würde. Das musste unbedingt verhindert werden, da sich die Bundesrepublik als einzige legitime Vertretung des deutschen Volkes sah und im Zuge dieses Anspruchs das Ziel hatte, die DDR außenpolitisch zu isolieren.
Die Vorstellung, dass die Deutschen ein Jahrzehnt nach dem Holocaust die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zu Israel verweigerten, ist aus heutiger Sicht ein Skandal. Der Vorgang zeigt deutlich, dass moralische Argumente oft zum Einsatz kamen, wenn es gerade politisch passte.
Das wurde auch 1959 bei einem Waffengeschäft deutlich: Die Bundesrepublik war dabei, wieder eigene militärische Streitkräfte aufzustellen, und irgendjemand kam auf die Idee, 50 000 „Uzi“-Maschinengewehre in Israel zu bestellen. Positiver Nebeneffekt: Es war ein Handel mit moralischer Fassade, dem sogar noch der Anstrich der Antisemitismusbekämpfung verliehen wurde. Eine dem Geist der Wehrmacht verpflichtete Armee würde nie Waffen bei Juden kaufen! „Die Uzi in der Hand deutscher Soldaten ist sicher besser als alle Broschüren gegen den Antisemitismus“, sagte der Journalist und Adenauer-Berater Rolf Vogel 1956 bereits zu Shimon Peres, damals Generaldirektor des israelischen Verteidigungsministeriums und enger Vertrauter von Ministerpräsident David Ben-Gurion.[14] Das Problem nur: Die Bundeswehr brauchte gar nicht so viele Uzis. Also verkaufte Deutschland 10 000 weiter an Portugal (damals eine Diktatur), das diese in seiner Kolonie Angola einsetzte, um die dortige Unabhängigkeitsbewegung niederzuschlagen – die „schlimmstmögliche Kombination“, wie der Historiker Yeshayahu Jelinek es formuliert.[15]
Realpolitik statt Moral
Bei der Wiedergutmachung und der Beziehung zwischen Deutschland und Israel ging es somit selten um Moral, Verpflichtung oder sogar Schuld, sondern vor allem um Realpolitik. Erst mit der Rede Angela Merkels vor der Knesset wurde die Formel der deutschen Staatsraison zur Sicherheit Israels zum Signum deutscher Politik. Seitdem wird sie von verschiedenen Amtsträgern routiniert wiederholt. So auch im umstrittenen Bundestagsbeschluss bezüglich der BDS-Kampagne 2019, wo es heißt: „Durch eine besondere historische Verantwortung ist Deutschland der Sicherheit Israels verpflichtet. Die Sicherheit Israels ist Teil der Staatsraison unseres Landes.“[16]
2021 fand die deutsche Bindung an Israel sogar Eingang in den Koalitionsvertrag der neuen Ampel-Bundesregierung. „Die Sicherheit Israels ist für uns Staatsraison. Wir werden uns weiter für eine verhandelte Zweistaatenlösung auf der Grundlage der Grenzen von 1967 einsetzen. Die anhaltende Bedrohung des Staates Israel und den Terror gegen seine Bevölkerung verurteilen wir. Wir begrüßen die begonnene Normalisierung von Beziehungen zwischen weiteren arabischen Staaten und Israel. Wir machen uns stark gegen Versuche antisemitisch motivierter Verurteilungen Israels, auch in den VN.“[17] Das bekräftigte die neue Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) bei ihrem Antrittsbesuch in Tel Aviv und Jerusalem: „Die Sicherheit Israels ist und bleibt deutsche Staatsraison.“[18] Zudem erklärte sie nach einem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Deutschland stehe „unverrückbar zu seiner Verantwortung für diese Schrecken der Vergangenheit“, dies sei ein „Auftrag für die Gegenwart und für die Zukunft“. All das vermittelt den Eindruck – und Angela Merkel sagte es ja explizit –, dass eine solche Staatsraison eine Selbstverständlichkeit im Nachkriegsdeutschland sei, dass diese Position schon von jeder Bundesregierung und jedem Bundeskanzler vor ihr mitgetragen worden und von ihr und anderen Politikern nur bestätigt oder deutlich ausgesprochen worden sei. Dabei stimmt das nicht im Geringsten. Merkels Äußerungen waren ein Novum in den deutsch-israelischen Beziehungen.
Es ist auch noch aus einem anderen Grund bemerkenswert, dass diese Erklärung kaum in der Öffentlichkeit und Politik infrage gestellt worden ist. Schließlich beruht das Konzept auf einem vordemokratischen Gedanken: Staatsraison, am prominentesten beschrieben durch den florentinischen Staatsdenker Niccolò Machiavelli in seinem Hauptwerk „Der Fürst“ (1513), bedeutet ursprünglich, dass ein Staat seine (Macht-)Interessen durchsetzen darf und soll, selbst wenn dies die Verletzung von Rechten einzelner Bürger beinhaltet oder den Bruch von Gesetzen, da das Staatswohl wichtiger ist als das Wohl des Einzelnen. Damit steht die Idee der Staatsraison eigentlich grundsätzlich dem Rechtsstaat entgegen. Da etwa die Bundesrepublik Deutschland im Grundgesetz die Wahrung der Würde des Menschen und der Grundrechte festgeschrieben hat, war in bundespolitischem Zusammenhang lange nicht von einer Staatsraison die Rede. Nicht einmal, als es etwa im „Deutschen Herbst“ 1977 darum ging, nicht auf Erpressungsversuche von Terroristen einzugehen, den Staat also nicht erpressbar zu machen. Und so ist es zumindest verwunderlich, dass Angela Merkel ausgerechnet auf das Konzept der Staatsraison zurückgegriffen hat, um die Verbundenheit zu Israel zum Ausdruck zu bringen.
Die Verharmlosung der Shoah
Gerade in Zeiten, in denen in Jerusalem rechtsextremistische Minister im Amt sind, müssen wir uns kritisch die Frage stellen, ob das Konzept der Staatsraison noch tragbar ist. Zu lange hat die deutsche Politik trotz der besorgniserregenden politischen Entwicklungen in der israelischen Gesellschaft alle Augen zugedrückt. Noch schlimmer, immer wieder unterstützte sie sogar Narrative, die Palästinenser als die neuen Nazis darstellen.
Im Jahr 2020 flogen israelische F-16-Kampfjets zusammen mit deutschen Eurofightern über das ehemalige Konzentrationslager Dachau und das Flugfeld Fürstenfeldbruck, wo 1972 das Olympiaattentat sein Ende gefunden hatte, bei dem palästinensische Terroristen elf israelische Sportler und einen deutschen Polizisten ermordet hatten. Die gemeinsame Übung sollte deutsch-israelische Verbundenheit symbolisieren; die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sprach von einem „sehr persönlichen Moment“.
Worin der Mehrwert dieses Manövers für die israelische (oder deutsche) Sicherheit lag, bleibt jedoch unklar, und auch der symbolische Wert der Flugroute ist bei näherer Ansicht ausgesprochen fragwürdig: Umstandslos wird hier palästinensischer Terror auf eine Stufe mit dem Holocaust gestellt. Das hat einen durchaus revisionistischen Beigeschmack: als wären die Palästinenser die natürlichen Erben der Nazis.
Doch auch das folgte einem gängigen Muster: Schon im Eichmannprozess 1961 hat Hannah Arendt beobachtet, wie die Analogie zwischen den Arabern und den Nazis als staatlich gesteuertes Entlastungsnarrativ funktioniert. In ihrem Buch „Eichmann in Jerusalem“ bemerkt sie kritisch, dass Adenauers Vertrauter Hans Globke „den Vorrang vor dem ehemaligen Mufti von Jerusalem haben (soll), wenn man die Leidensgeschichte der Juden unter dem Naziregime gerichtsnotorisch machen wollte“.[19]
So basierten die „besonderen Beziehungen“ zwischen Deutschland und Israel von Beginn an auf einer impliziten Verharmlosung der Shoah. Jede Seite profitierte: Israel konnte seine arabischen Feinde delegitimieren, und Deutschland musste sich nicht mit der fehlenden Aufarbeitung seiner NS-Vergangenheit auseinandersetzen. Dass diese Formel auch heute funktioniert, zeigt die gut gemeinte Aktion des deutsch-israelischen Militärmanövers über Dachau und Fürstenfeldbruck. Wir müssen uns daher der Frage stellen, was Solidarität mit Israel heute bedeutet. Die deutsche Politik kann auf Dauer schwerlich an Merkels Konzept der Staatsraison festhalten.
Gewiss, die moralische Bedeutung einer Selbstverpflichtung des deutschen Staates ist kaum zu überschätzen. Sie ist aber weder gesetzlich verankert noch von der Bevölkerung legitimiert. Angela Merkel und weitere deutsche Amtsträger haben damit den deutschen Staat auf die Sicherheit eines anderen Staates verpflichtet. Ausgelassen wurde dabei die Frage, was Israel tun oder unterlassen solle, damit diese Garantie in Zukunft bestehen kann. Das Versprechen wurde nicht einmal an Bedingungen geknüpft, wie etwa an das Fortbestehen der israelischen Demokratie. Im Jahr 2008 war es vermutlich nicht einmal vorstellbar, dass diese so fragil ist, wie es sich heute herausstellt. Aktuell blickt man mit Angst auf die politischen Entwicklungen in Israel. Denn die größte Gefahr für die Sicherheit des Landes geht nicht von den arabischen Nachbarländern oder Iran, sondern von der eigenen ultranationalistischen und religiös-fundamentalistischen Regierung aus. Unter ihr droht Israel zu einer Autokratie zu mutieren. Es bleibt zu hoffen, dass die Proteste der liberalen Teile der Gesellschaft den Plan der Regierung vereiteln.
Als Benjamin Netanjahu im März zu Besuch nach Berlin kam, durfte – wie zu erwarten – in der Ansprache des Bundeskanzlers das Bekenntnis zur Sicherheit Israels als deutsche Staatsraison nicht fehlen. Doch irgendwie wirkte dieser Satz dieses Mal anders auf mich – vielleicht weil die größte Bedrohung für Israels Sicherheit neben dem Bundeskanzler selbst saß.
Der Beitrag basiert auf „Über Israel reden. Eine deutsche Debatte“, dem jüngsten Buch des Autors, das soeben im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen ist.
[1] Ha-Chamishia Ha-Kamerit, Feldermaus at the Olympics, www.youtube.com.
[2] Bundestagsdebatte zum 70. Jahrestag der Gründung des Staates Israel, www.bundestag.de, 26.4.2018.
[3] Stern-Umfrage: Israel verliert bei den Deutschen an Ansehen, www.stern.de, 23.5.2012.
[4] Bertelsmann-Stiftung, Deutliche Unterschiede in der gegenseitigen Wahrnehmung zwischen Europa und Israel, Gütersloh 2020.
[5] Deutscher Bundestag, 165. Sitzung, www.bundestag.de, 27.9.1951.
[6] Elisabeth Noelle et al., Jahrbuch der Öffentlichen Meinung 1947–1955, Bonn 1956, S. 130.
[7] Konrad Adenauer, Erinnerungen 1953–55, Stuttgart 1966, S. 136.
[8] Ebd., S. 138.
[9] Werner Bergmann, Antisemitismus in öffentlichen Konflikten, Frankfurt a. M. 1997. S. 67.
[10] Frank Stern, The Whitewashing of the Yellow Badge, Oxford 1992.
[11] Daniel Marwecki, Germany and Israel, London 2020, S. 29.
[12] Dominique Trimbur, American influence on the Federal Republic of Germany’s Israel Policy, Berlin 2003, S. 275.
[13] Daniel Marwecki, Germany and Israel, London 2020, S. 72.
[14] Rolf Vogel, Deutschlands Weg nach Israel, Stuttgart 1987, S. 134 f.
[15] Yeshayahu Jelinek, Deutschland und Israel 1945–1965, München und Oldenburg 2004, S. 409.
[16] Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen: Der BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten – Antisemitismus bekämpfen, Deutscher Bundestag, Drucksache 19/10191, 19. Wahlperiode, www.bundestag.de, 15.5.2019, S.1.
[17] Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP, www.bundesregierung.de, Berlin 2021.
[18] Außenministerin Baerbock in Israel, www.spiegel.de, 10.2.2022.
[19] Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, London 2012. Immer wieder gab es (in Deutschland wie Israel) Versuche, den Mufti von Jerusalem Amin al-Husseini als prominente Figur bei der Planung des Holocaust darzustellen. Noch 2015 erklärte Benjamin Netanjahu in einer Rede vor dem jüdischen Weltkongress, dieser habe eine „zentrale Rolle als Anstifter zur Endlösung“ gespielt. Bei einem Treffen zwischen Hitler und al-Husseini im Jahr 1941 soll der Mufti auf Hitlers Frage „Was soll ich also mit den Juden machen?“, laut Netanjahu mit „Verbrennen Sie sie“ geantwortet haben. Ein Dialog, der in keiner historischen Quelle zu finden ist.