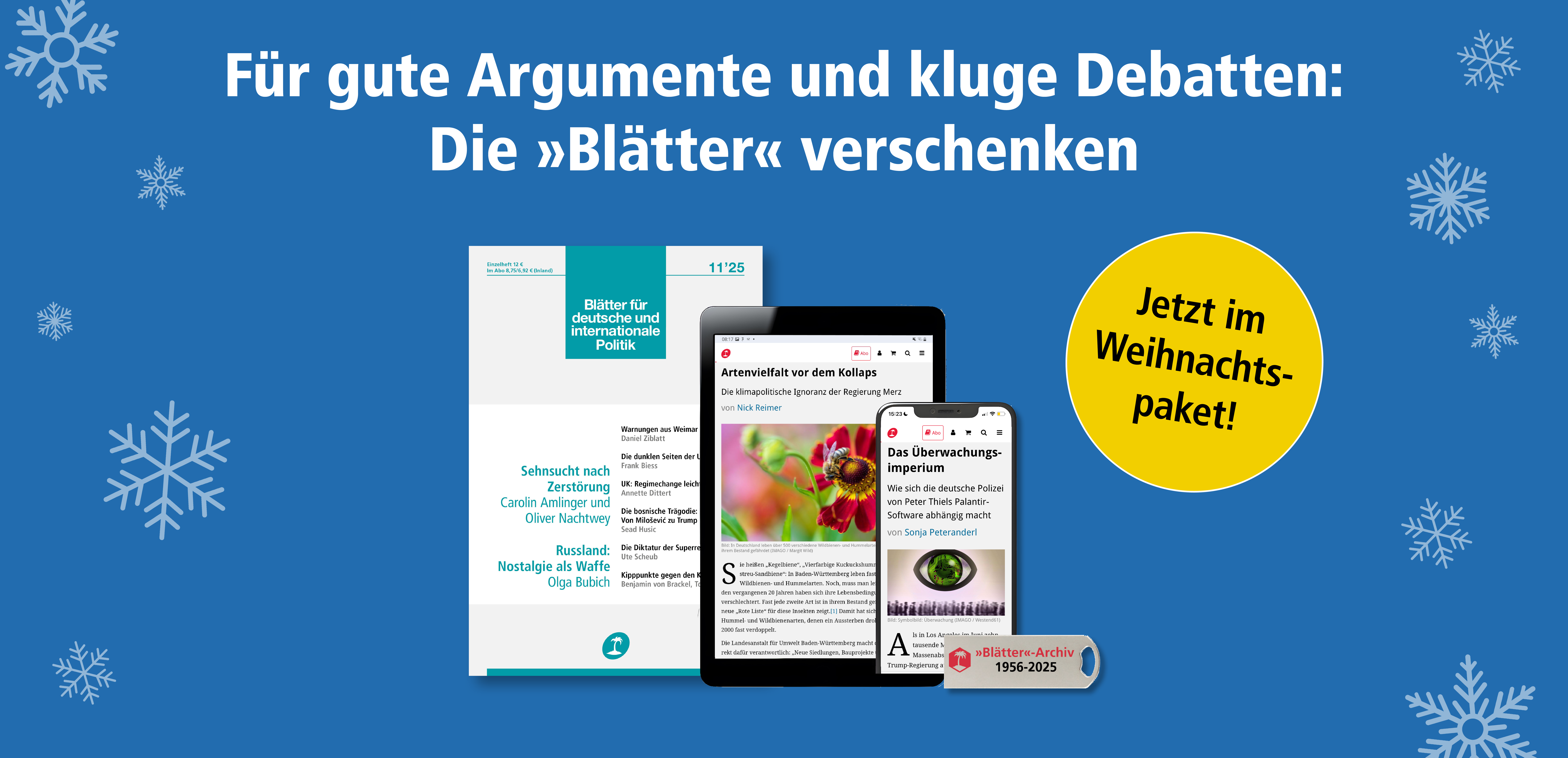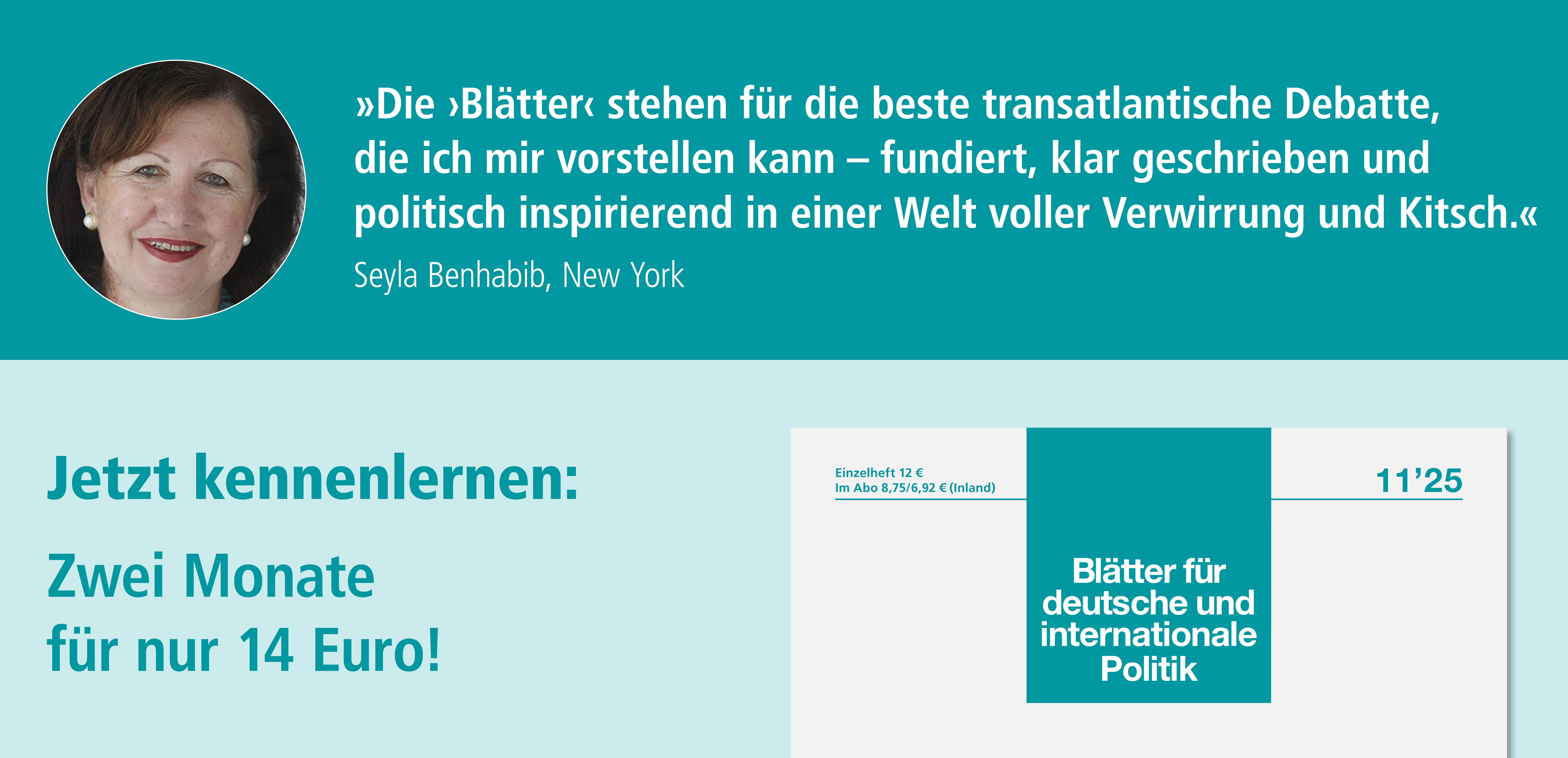Das Versagen der deutschen Finanzkontrollbehörden

Bild: Offener Geldkoffer, 18.1.2023 (IMAGO / Panthermedia / Pippocarlot)
An einem Herbsttag des Jahres 2018 staunen selbst erfahrene Geldwäschebeauftragte einer Bank in Hessen nicht schlecht. Ein Kunde möchte 500 Mio. Euro überweisen. Dieser unfassbar hohe Betrag ist auf der Durchreise. Das Geld hat seinen Ursprung in einem Verdachtsland außerhalb der EU und soll dann, sozusagen mit kurzem Boxenstopp bei einer hiesigen Korrespondenzbank, durchgeleitet werden in einen anderen Staat außerhalb der EU, dem Vernehmen nach keine lupenreine Demokratie. Der naheliegende Verdacht: Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.
Die Bank macht ordnungsgemäß sofort Meldung bei der Financial Intelligence Unit (FIU), wo alle Verdachtsmeldungen geprüft werden. Die FIU, die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, ist eine Behörde des Bundes bei der Generalzolldirektion. Sie untersteht der Rechtsaufsicht des Bundesfinanzministeriums und hat mit rund 400 Mitarbeitern beim Zollkriminalamt (ZKA) in Köln ihre Dependance. Dort und in Dresden sollen bis 2026 insgesamt rund 700 Fachleute arbeiten. Die FIU zückt ihr schärfstes Schwert und erlässt eine „Sofortmaßnahme“ nach dem Geldwäschegesetz. Damit ist die Überweisung für erst einmal dreißig Tage gesperrt. Umgehend telefonieren Mitarbeiter der FIU mit der zuständigen Staatsanwaltschaft und dem Landeskriminalamt, um auszuloten, ob die beschafften Indizien für ein Ermittlungsverfahren ausreichen. Doch der strafprozessuale Anfangsverdacht lässt sich nicht erhärten, und deshalb wird die Zahlung am Ende doch mit flauem Gefühl freigegeben.
Dieser Fall ist exemplarisch für den Alltag der Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Einerseits identifiziert die Bank die verdächtige Überweisung und meldet sie sofort. Andererseits gibt die Behörde am Ende grünes Licht. Das mutmaßlich schmutzige Geld kommt allen Zweifeln zum Trotz beim Empfänger an.
Die FIU ist ein wichtiger Filter in der Geldwäschebekämpfung. Banken, Finanzdienstleister, aber auch Mitglieder des Nichtfinanzsektors wie Immobilienmakler, Kryptotauschbörsen, Notare, Juweliere, Glücksspielanbieter, Autohändler und weitere Güterhändler sind dazu verpflichtet, der FIU Meldung zu machen, wenn ihnen ein Geschäft mit Kunden verdächtig vorkommt. Beispielsweise ist eine hohe Barzahlung beim Auto- oder Schmuckkauf ein starkes Indiz für mögliche Geldwäsche. Die Behörde ist im besten Fall ein Seismograf für Geldwäscheaktivitäten. Hat ein zur Meldung an die FIU Verpflichteter den Verdacht, dass eine Transaktion im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung steht, muss er die Transaktion anhalten. Das gilt für eine Bank ebenso wie für einen Juwelier. Dann beginnt die Wartezeit. Innerhalb von drei Tagen muss die FIU den Vorfall geprüft und – sollte sich der Verdacht erhärten – an die Staatsanwaltschaft weitergegeben haben.
Geschieht dies nicht, bedeutet das grünes Licht für die Banküberweisung oder den Verkauf, beispielsweise eines Schmuckstücks. Die Dreitagefrist wird oft gerissen. Dann gehen die verdächtigen Zahlungen durch, ohne rechtzeitig geprüft worden zu sein. Der simple Grund: Die FIU ist überfordert, ihr fehlen für ein effizientes Abarbeiten der Meldungen ausreichend Mitarbeiter und Informationszugänge. Eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion „Die Linke“ ergab 2023, dass insgesamt 525 000 Geldwäschemeldungen nicht bearbeitet worden sind – die allermeisten, weil man sie als nicht prüfungswürdig eingestuft hat. Doch wie verlässlich ist diese Vorprüfung? Die FIU setzt bei ihrer Bewertung der vielen Verdachtsmeldungen den umstrittenen „risikobasierten Ansatz“ ein. Eine Software trifft die Vorauswahl der Meldungen. Weil die Datenbasis fehlt, gehen der Behörde viele prüfungswürdige Verdachtsmeldungen durch die Lappen, die – wenn überhaupt – erst später händisch bearbeitet werden.
Verdacht auf Strafvereitelung im Amt
Die Bundesländer haben das Bundesfinanzministerium seit 2017 immer wieder auf die Probleme hingewiesen. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück meint sogar, der risikobasierte Ansatz der FIU könnte den Tatbestand der Strafvereitelung erfüllen. Deshalb durchsuchte die Behörde kurz vor der Bundestagswahl 2021 das Bundesfinanz- und das Bundesjustizministerium. Die SPD witterte eine Instrumentalisierung der Justiz im Wahlkampf. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück rechtfertigte sich, zwischen der FIU und den nun durchsuchten Ministerien habe es umfangreiche Kommunikation gegeben. Gab es Absprachen? Wurden Mitarbeiter beeinflusst? Man wolle, so die Staatsanwaltschaft, mögliche konkrete Beschuldigte identifizieren.
Das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Osnabrück gegen die FIU wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt läuft seit Jahren. Ausgangspunkt war die Verdachtsmeldung einer Bank in Osnabrück im Juni 2018. Dabei ging es um eine Überweisung nach Afrika über mehr als eine Mio. Euro. Hintergrund der Zahlung seien möglicherweise Terrorismusfinanzierung sowie Waffen- und Drogenhandel, so der Verdacht des Kreditinstituts. „Die FIU nahm diese Meldung zur Kenntnis, leitete sie aber nicht an deutsche Strafverfolgungsbehörden weiter. Daher sei es nicht möglich gewesen, die Zahlung zu stoppen“, so die Staatsanwaltschaft, die im Februar 2020 ein Ermittlungsverfahren einleitete, das noch immer andauert. Im Juli 2020 durchsuchten die Ermittler die FIU-Zentrale in Köln. Es ist mehr als peinlich, wenn eine zuständige Geldwäschekontrollbehörde unter Strafvereitelungsverdacht steht.
Die Arbeitsbelastung für die Behörde wächst unterdessen. Die Zahl der Verdachtsmeldungen steigt massiv an: Im Jahr 2020 waren es rund 144 000, im Jahr 2021 bereits 298 000. Der Großteil der Meldungen kam aus dem Finanzsektor, hier vor allem von den Banken. Lediglich knapp drei Prozent der Hinweise gab der Nichtfinanzsektor, wo Kriminelle es besonders leicht haben, ihr Geld zu waschen. In Ermittlerkreisen kursieren die wildesten Geschichten über die katastrophale Arbeit der FIU. „Eine Gruppe Italiener zahlt bei der Bank Bargeld ein in Höhe von 30 000 Euro. Das Institut meldet den Vorgang mit dem Verdacht der Schutzgelderpressung im Mai 2020 an die FIU. Erst im Januar 2021 kommt der Vorgang zu den Ermittlern. Die Videoüberwachung bei der Bank war gelöscht, das Konto geleert“, berichtet ein Fahnder. So etwas passiere immer wieder.
Der Bundesrechnungshof übergab dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages am 11. September 2020 einen vertraulichen Bericht über die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch die FIU. In dem Bericht heißt es schonungslos: „Die FIU kann auf die regionalen Polizeidaten in den Vorgangsbearbeitungssystemen der Länderpolizeien nicht elektronisch zugreifen. Die Datenbestände der Länderpolizeien enthalten Informationen zur Organisierten Kriminalität und des Staatsschutzes. Die FIU kann auch auf einen Großteil wichtiger Steuerdaten der Finanzverwaltungen des Bundes und der Länder nicht elektronisch zugreifen, insbesondere auf die verschiedenen steuerlichen Veranlagungsdaten. Die FIU kann damit die in sie gesetzten Erwartungen nur unzureichend erfüllen. Es besteht vor allem die Gefahr, dass die FIU Sachverhalte mit Bezug zu Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nicht erkennt bzw. erkennen kann und infolgedessen nicht an die Strafverfolgungsbehörden weiterleitet; mit unvollständigen Informationen angereicherte Sachverhalte übermittelt; Sachverhalte nicht in angemessener Zeit bearbeiten kann und damit ihrem gesetzlichen Auftrag, insbesondere ihrer Filterfunktion, nicht gerecht wird.“[1]
Der Bericht des Bundesrechnungshofs war ein Alarmsignal: Selten ist das Versagen einer Bundesregierung von der Konzeption bis zur Umsetzung einer auch international wichtigen Kontrollbehörde so schonungslos offengelegt worden. Der Austausch der FIU mit den Ermittlungsbehörden bleibe „bürokratisch und kompliziert“, sagte auch der damalige EU-Parlamentarier der Grünen und heutige Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Sven Giegold. Die FIU kann beispielsweise nicht auf Knopfdruck herausfinden, ob gegen eine Person, die bei einer Bank eine verdächtige Überweisung gemacht hat, bei der Polizei bereits ein Ermittlungsverfahren läuft.
Die gut zwanzigjährige Geschichte der Behörde stand nie unter einem guten Stern. Die Gründung der FIU erfolgte auf Druck der USA nach 9/11. In Deutschland stemmten sich Lobbyisten, insbesondere die der Banken und Notare, massiv dagegen. Der damalige Bundesinnenminister Otto Schily setzte sich schließlich durch. Die FIU wurde 2002 beim Bundeskriminalamt (BKA) angesiedelt, bei Spezialisten, die sich schon lange mit Geldwäschebekämpfung beschäftigten. Doch auf Bestreben des damaligen Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble arbeitet die FIU seit 2017 nicht mehr unter dem Dach des BKA, sondern unter dem des Zolls – gegen den ausdrücklichen Rat der Experten.
Desaströs aus Tradition?
Das politische Desinteresse Deutschlands am Kampf gegen die Finanzkriminalität missfällt dem obersten internationalen Antigeldwäsche-Gremium, der Financial Action Task Force (FATF), schon lange. Die zwischenstaatliche Organisation wurde 1989 von der G7 und der Europäischen Kommission gegründet. Heute hat die FATF 37 Mitgliedsstaaten plus EU-Kommission und Golf-Kooperationsrat. Das Sekretariat der Organisation befindet sich bei der OECD in Paris. Weltweit haben sich über 180 Länder verpflichtet, die 40 FATF-Empfehlungen zu übernehmen, deren Umsetzung in nationales Recht von internationalen Gutachtern regelmäßig überprüft und beurteilt wird. Der Zufall wollte es, dass die FATF-Teams 2021 in Deutschland eine Prüfung durchführten, just als ein Deutscher Präsident der FATF war. Es war der Ministerialdirigent und Unterabteilungsleiter im Bundesfinanzministerium Marcus Pleyer, der dort für die Geldwäschebekämpfung im Land mitverantwortlich ist. Pleyers zeitweilige Doppelrolle als Präsident der Kontrollinstitution einerseits und Mitverantwortlicher für den desaströsen Zustand der FIU andererseits legte einen möglichen Interessenkonflikt nahe, auch wenn Pleyer sagte, „er sei bei der FATF aus allem, was die Prüfung Deutschlands angeht, raus“.
Bereits als Büroleiter des damaligen Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble bekam Pleyer 2011 hautnah mit, wie holprig die Geldwäscheaufsicht etwa im Immobiliensektor und bei den Casinos funktioniert. Damals veröffentlichte die FATF auch das Ergebnis ihrer ersten Deutschland-Prüfung. Das Urteil war vernichtend. Deutschland erfüllte gerade einmal fünf von damals noch 49 Empfehlungen vollständig.
Im Sommer 2022 präsentierte die FATF ihren aktuellen Bericht: Die Experten bemängeln das Kompetenzwirrwarr von über 300 Behörden und sehen Defizite bei der Überwachung des Bargeldschmuggels. Die wenigsten der vielen Tausend Verdachtsmeldungen, die die Sammelstelle FIU jedes Jahr an die Behörden weiterleite, würden zu knallharten Ermittlungsverfahren führen. Von rund 36 000 Geldwäscheverfahren 2020 mündeten dem Bericht zufolge nur 629 in eine Anklage und 773 in einen Strafbefehl. „Auch andere Statistiken stützen die Schlussfolgerung, dass die Gesamtzahl der Geldwäscheverfahren gering erscheint, wenn man bedenkt, dass Deutschland ein wichtiges Finanz- und Wirtschaftszentrum ist“, so die FATF.
Wirecard – keiner fühlte sich zuständig
Wie schlimm es um die Geldwäschekontrolle durch die deutsche FIU steht, zeigt auch der Skandal um das einstige Vorzeigeunternehmen Wirecard. Nach dem Zusammenbruch des Konzerns 2020 kam heraus, dass die Commerzbank der FIU bereits im Februar 2019 eine umfangreiche Geldwäscheverdachtsmeldung übergeben hatte. Darin enthalten: eine Liste von 343 auffälligen Zahlungen von Konten der Wirecard Bank. Aus einer zusätzlichen Sachverhaltsdarstellung der Geldwäschebekämpfer der Bank ging hervor, dass die 16 Auftraggeber der verdächtigen Überweisungen über die Wirecard Bank dieselbe Adresse in Singapur haben.[2]
Für Profis sind das klare Alarmsignale, doch die FIU reagiert nicht. Es dauert fast eineinhalb Jahre, bis die Behörde die Verdachtsmeldungen an die zuständigen Ermittlungsbehörden weiterleitet. Zu spät, denn zu diesem Zeitpunkt ist Wirecard bereits insolvent und der Betrugsskandal offenbar. Die Schlafmützigkeit macht Experten fassungslos: „Wäre so ein Ding in einem Landeskriminalamt angekommen, dann wäre man damit sofort zur Staatsanwaltschaft gelaufen“, sagt Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK). Seine Aussage steht in scharfem Kontrast zur Aussage des inzwischen zurückgetretenen FIU-Chefs Christof Schulte, der die Verdachtsmeldung der Commerzbank in einer Befragung als „keine besonders gute“ bezeichnete.[3] „Das Chaos bei der FIU ist ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Wir brauchen eine Finanzpolizei mit kriminalistischer Expertise“, sagte der damalige Bundestagsabgeordnete der Linkspartei Fabio De Masi im September 2021 in einer Pressemitteilung. „Auch bei Wirecard hat die FIU Strafvereitelung zu verantworten.“
Der Betrugsskandal Wirecard belegt gleich auf mehreren Feldern die Unzulänglichkeiten der Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Der Finanzkonzern tauchte beispielsweise 2017 in Geldwäscheermittlungen gegen die italienische Mafiaorganisation ’Ndrangheta auf.[4] Darüber hinaus betreute Wirecard zweifelhafte Kundschaft aus postsowjetischen Oligarchenkreisen. Auch die Glücksspielindustrie gehörte zum Kundenkreis – Wirecard leitete als deren Zahlungsdienstleister verdächtige Überweisungen weiter. Des Weiteren, so ergeben Zeugenaussagen, wurden regelmäßig enorm hohe Bargeldbeträge bei der hauseigenen Wirecard Bank abgehoben und rausgetragen – eingeschweißt in Plastik. Der abgetauchte Wirecard-Vorstand Jan Marsalek konnte kurz vor seiner Flucht noch ein großes Vermögen nach Russland transferieren – in Bitcoin. Das Wirecard-Desaster kostet Anleger und Banken Milliarden Euro. Der Ruf der deutschen Aufsichtsbehörden ist dahin. Wie konnten die Verdachtsmomente nur so lange ignoriert werden?
Die Staatsanwaltschaft München I ermittelte bereits zwischen 2010 und 2012 wegen Geldwäscheverdachts gegen Verantwortliche der Wirecard-Gruppe. In dem Ermittlungsverfahren ging es um Finanztransaktionen für Onlineglücksspiel-Anbieter in den USA, die Wirecard abwickelte. Im Rahmen der Ermittlungen stand die Staatsanwaltschaft damals auch in Kontakt mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Aufsichtsbehörde veranlasste 2010 eine Sonderprüfung bei Wirecard und stellte „zahlreiche Mängel bei der Geldwäscheprävention“ fest. Allerdings seien die festgestellten organisatorischen Mängel nicht so gravierend gewesen, dass aufsichtsrechtliche Maßnahmen veranlasst wurden.[5] Im Februar 2012 wurde das staatsanwaltliche Verfahren eingestellt, „da ein Tatnachweis nicht zu führen war“, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.
Die Politiker sahen Wirecard als ihren „Darling“, man war geradezu stolz auf dieses „Kompetenzzentrum“. Die damalige Bundesregierung setzte sich sogar in China für Wirecard ein. Und Wirecard-Manager Oliver Bellenhaus durfte 2011 – die ersten Ermittlungen gegen Wirecard liefen da bereits – als Sachverständiger im Finanzausschuss des Bundestages Folgendes zum Besten geben: „Uns liegt es auch am Herzen, Geldwäsche zu bekämpfen. Ich denke, wir haben das auch über die letzten fünf Jahre erfolgreich gezeigt und erfolgreich betrieben.“[6] Bellenhaus packt seit 2023 im Wirecard-Prozess als Kronzeuge aus.
Der Wirecard-Skandal hätte vielleicht verhindert werden können, wenn die deutschen Aufsichtsbehörden ihre Pflicht zur Geldwäschebekämpfung ernst genommen hätten. Die Wirtschaftsprüfer, Finanzbehörden, aber auch die Geldwäscheaufsicht hätten zum Beispiel den jahrelangen Recherchen der „Financial Times“ nachgehen können – die britische Zeitung hatte Wirecard in vielen Berichten Vorwürfe gemacht, die Bilanzen zu fälschen. Stattdessen stellte die BaFin Strafanzeige gegen die Journalisten – wegen des Verdachts der Marktmanipulation. Dabei gab es bereits klare Verdachtsindizien gegen den deutschen Finanzkonzern. Beispielsweise war es ein offenes Geheimnis, dass Wirecard mit der Zahlungsabwicklung für Pornoseiten und Onlineglücksspiel viel Geld verdiente. Beide Sektoren gelten als Hotspots für Geldwäsche. Darüber hinaus kaufte Wirecard andere Unternehmen zu völlig überhöhten Preisen auf – eine klassische Methode von Geldwäschern.
Doch die deutschen Aufsichtsbehörden litten unter einem Kompetenzwirrwarr: Niemand wusste, wer zuständig dafür ist, den Konzern auf die Umsetzung der Regeln zur Geldwäscheprävention hin zu kontrollieren. Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal wies 2021 nach, dass Wirecard aufgrund dieser Unsicherheit faktisch von niemandem beaufsichtigt wurde.[7] Die BaFin schob der Bezirksregierung Niederbayern die Verantwortung zu, die diese zurückwies.
„Es gibt eine Gesetzeslücke“, sagt der Jurist Lars Haffke, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU München im Bereich Corporate Governance. Die BaFin sei nur für die Aufsicht der Wirecard Bank AG zuständig gewesen. „Die Wirecard AG als Ganzes fiel unten durch, weil die Aufsichtsbehörden der Länder, in diesem Fall die Bezirksregierung Niederbayern, nur für die Geldwäschekontrolle des Nichtfinanzsektors zuständig sind“, sagt Haffke. „Reine Dienstleister wie die Wirecard AG, die nicht anderweitig dem Geldwäschegesetz unterliegen, konnten ohne Aufsicht agieren.“
Die Bundesländer sind also dafür zuständig, den Nichtfinanzsektor zu überwachen – dazu gehörte auch die Wirecard AG. Diese Anforderung gilt seit dem Geldwäschegesetz von 1993. Die Überforderung der Bundesländer bei der Erfüllung ihrer Aufgabe sowie die ungeklärten Zuständigkeiten sind immer wieder Thema unter Experten. Doch die Politik ignoriert die Warnungen, selbst ein Vertragsverletzungsverfahren der EU weckte Berlin nicht auf. Die Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern in der Geldwäscheprävention funktioniert bis zum heutigen Tag nicht oder nur schlecht – Wirecard ist da nur die Spitze des Eisbergs.
Dreißig Jahre Stau
Bereits in einem früheren Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission – nach einer Beschwerde eines der Autoren dieses Beitrags (Andreas Frank) im Jahr 2004 – wurde die Bundesregierung angewiesen, das Geldwäschegesetz korrekt anzuwenden. Danach wurden in den Bundesländern die bis dahin fehlenden Aufsichtsbehörden bestimmt, allerdings in jedem Bundesland anders: Die Zuständigkeiten gingen hier an Regierungspräsidien, dort an Bezirksregierungen, anderswo an Ministerien und Ordnungsämter. Die Bundesländer merkten bald, dass sie mit dieser Aufgabe überfordert waren. Geldwäsche passiert international, was soll da ein kleiner Beamter im Regierungspräsidium schon tun? In Wolfsburg kümmerte sich damals eine einzige Person im Ordnungsamt um die Aufsicht des VW-Konzerns und aller anderen zur Meldung an die FIU Verpflichteten des Nichtfinanzsektors. Eine effektive Bekämpfung der Geldwäsche ist so unmöglich.
Folgerichtig baten die Bundesländer den Bund im Jahr 2012, die geldwäscherechtliche Aufsicht über den Nichtfinanzsektor selbst zu übernehmen. Sie lieferten konkrete Belege für ihre Überforderung – doch die Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel lehnte ab.
Geldwäschebekämpfung ist Europarecht. Die EU-Kommission führte in 30 Jahren über 100 Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedsstaaten, weil sie die Geldwäscherichtlinie nicht richtig umgesetzt haben, darunter mehrfach gegen Deutschland. Sie forderte die Bundesregierung unter Merkel noch im Jahr 2021 dazu auf, die Vierte Geldwäscherichtlinie ordnungsgemäß umzusetzen – nach jahrelanger Trödelei.
Die Kontrollen des Nichtfinanzsektors auf Geldwäscheprävention sind bis zum heutigen Tag unzureichend. Die Aufseher müssten eigentlich regelmäßig bei Immobilienmaklern, im Glücksspielsektor oder bei Juwelieren überprüfen, ob diese Betriebe gut gerüstet sind, um Geldwäschegeschäfte zu verhindern. Dazu gehören Kontrollen, ob die Personalausweise von Kunden bei hohen Bargeldgeschäften tatsächlich kopiert werden. Doch die Maßnahmen fallen je nach Bundesland unterschiedlich scharf aus. Oft haben die Behörden in den Gewerbeaufsichtsämtern und Bezirksregierungen kein geschultes Personal für diese Aufgabe.
Im Jahr 2020 monierte der Bundesrechnungshof diese eklatanten Defizite schonungslos.[8] Es gibt im Nichtfinanzsektor immer noch keine wirksame Geldwäscheaufsicht und das fast 30 Jahre, nachdem das Geldwäschegesetz in Kraft getreten ist. So setzen die Länderaufsichten zum Beispiel zu wenig Personal ein, um gebotene intensive und flächendeckende Maßnahmen durchführen zu können, insbesondere Vor-Ort-Prüfungen der über 1,1 Mio. zur Meldung an die FIU Verpflichteten. Bei einer jährlichen Vor-Ort-Kontrollquote von deutlich unter 0,5 Prozent muss ein Verpflichteter durchschnittlich nur höchstens alle zweihundert Jahre mit einer Vor-Ort-Prüfung rechnen. Die gesetzlichen Anforderungen werden nicht erfüllt. Den meldepflichtigen Maklern, Notaren oder Juwelieren fehlen zudem Informationszugänge zum PEP-Register für „Politisch Exponierte Personen“. Hierbei handelt es sich unter anderem um Minister, Staatssekretäre, Botschafter, Parlamentarier, hochrangige Vertreter internationaler Organisationen und deren Familien, die bei Geldgeschäften grundsätzlich engmaschiger überprüft werden sollen. Aber wie soll ein Juwelier in Deutschland wissen, ob der Kunde vielleicht der Sohn eines sanktionierten Diktators ist? Das geht nur durch den Abruf der aktuellsten Listen. Doch der Zugang ist teuer. Inhaber kleiner Juweliergeschäfte, Auto- und Edelmetallhändler können und wollen sich das nicht leisten.
Es ist ein grundsätzliches Problem: Die deutschen Behörden können den Kampf gegen Geldwäsche auch im Nichtfinanzsektor nicht alleine gewinnen. Der Staat braucht Hilfe. Deshalb müssen seit 1991 die Verpflichteten, also unter anderem Anwälte, Notare, Immobilienmakler, Juweliere und Autohändler, für den Staat die beschriebene Wächterfunktion übernehmen, die die Polizei schon aufgrund des dafür erforderlichen Personalaufwands niemals leisten könnte. Die Verpflichteten handeln mit ihrer Verdachtsmeldung aber oft gegen ihr Eigeninteresse. Ein Juwelier möchte Schmuck verkaufen, die Herkunft des Geldes kann ihm eigentlich egal sein. Das Mindeste, was der Verpflichtete erwarten kann, ist, dass die FIU seine Meldung zügig bearbeitet und Rückmeldung gibt. Aber das funktioniert auch nach über 20 Jahren noch nicht. Gleichzeitig dürften die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass staatliche Aufsichtsbehörden regelmäßig prüfen, ob Juweliere oder Immobilienmakler ihrer Meldepflicht nachkommen. Doch diese Kontrollen bleiben seit über 30 Jahren weitgehend aus.
Von wegen »Nichts geht mehr«
Wirecard konnte die Aufsichtsschwächen auch im Bereich des Glücksspiels ausnutzen. Gerade bei Onlinecasinos sind Geldflüsse schwer nachvollziehbar. Es ist für Kunden ein Leichtes, Konten bei Glücksspielanbietern einzurichten, ohne ernsthaft überprüft zu werden. Häufig betreiben Verbrechersyndikate die Casinos gleich selbst, was die Geldwäsche zusätzlich erleichtert. Die Geldwäschegefahr im Glücksspielsektor steht in scharfem Kontrast zu der Freiheit, die dieser Sektor in Europa und auch in Deutschland genießt. Dies ist politisch gewollt; die Konsequenzen werden sehenden Auges in Kauf genommen.
Zur Geldwäsche über Casinos brauchen die Syndikate Banken oder Finanzdienstleister, die nicht so genau hinschauen, wer der Kunde ist. Wirecard war ein solcher Konzern. In Italien fiel das auf. Stefano Musolino, stellvertretender Staatsanwalt in Reggio Calabria, war 2015 an der Operazione Gambling beteiligt. Die italienischen Ermittler führten damals Tausende Razzien in Spielhallen durch. „Ein Wettbüro betrieb mit der ’Ndrangheta ein System zur Geldwäsche“, so das Ermittlungsergebnis von Musolino. Er zeigt die Verbindung nach Germania auf: „Wirecard war eine der Banken, die von den kriminellen Organisationen genutzt wurde, um das Geld zu deponieren, das sie mit ihren illegalen Geschäften verdient hatten.“[9] Doch in Deutschland schlug dieses Ermittlungsergebnis keine hohen Wellen. Dabei wird der Glücksspielsektor seit jeher für Geldwäsche genutzt; das Internet hat dies nur auf ein neues Level gehoben. „Mit dem Onlinegambling hat sich alles verändert. Die Geldwäscher müssen nicht mehr mit Geldtaschen in verrauchte Wettbüros laufen. Die Banden eröffnen eigene Onlinecasinos. So können sie Geld waschen, beispielsweise indem die Kriminellen gegeneinander spielen, um auf diesem Weg Geld zu transferieren“, sagt Helen Ault, Direktorin der Isle of Man Gambling Supervision Commission dazu.
Banken stehen oft in der Kritik, sie würden verdächtige Zahlungen aus dem Glücksspielsektor viel zu selten melden. Doch dieser Vorwurf stimmt inzwischen nur noch bedingt. Die meisten großen Kreditinstitute in Deutschland möchten Wettanbieter überhaupt nicht mehr als Kunden haben. Sie wollen mit den Grauzonen des Wirtschaftslebens – Glücksspiel und Porno – nichts mehr zu tun haben. Doch der Gesetzgeber zwingt die Banken, diesen Branchen weiter behilflich zu sein.
Man muss kurz ausholen, um diesen Wahnsinn zu erklären. Seit der Umsetzung der EU-Zahlungsdiensterichtlinie 2007 gibt es neben den Vollbanken, die Spareinlagen annehmen dürfen, auch Zahlungsdienstleister. Diese Anbieter übernehmen den Zahlungspart zwischen Kunden und Händlern. Es ist ein weniger streng regulierter Bereich des Finanzsektors, der politisch gewollt war, um den „alten“ Banken Konkurrenz zu machen.
Weil die Banken aus der Schmuddelecke herauswollen, müssen Glücksspielanbieter und andere Vertreter aus dem wirtschaftlichen Grausektor stattdessen Geschäftsbeziehungen mit Zahlungsdienstleistern eingehen. Diese genießen gesetzlich „erleichterte Anforderungen“ bei der Geldwäschekontrolle. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesen Finanzfirmen kriminelle Kunden durchs Raster fallen. Dadurch sind die vielen neuen Zahlungsdienstleister wie PayPal, Payoneer oder Klarna geradezu prädestiniert dafür, missbraucht zu werden, beispielsweise von Wettanbietern, die ihre eigene Kundschaft nur rudimentär auf Geldwäscheverdacht überprüfen.
Zudem fehlt Zahlungsdienstleistern häufig die Infrastruktur, um Zahlungen verbindlich abzuwickeln. Sie müssen sich also, so komisch das klingt, für die Abwicklung ihrer Kundenzahlungen – wir sind immer noch bei Glücksspiel und Porno – eine Bank suchen. Die Banken holen sich die Schmuddelkundschaft also durch die Hintertür wieder herein. Sie tun das nicht freiwillig. Sie müssen es tun. So will es der „Kontrahierungszwang“ im Paragrafen 56 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG), Ausfluss der europäischen Zahlungsdiensterichtlinie (PSD 2). Diese schreibt seit 2019 vor, dass Banken den Zahlungsdienstleistern eine Schnittstelle zur Verfügung stellen müssen. Die Zahlungen werden angesichts der Masse in gebündelter Form durchgeführt, und die Bank weiß nicht, was im Einzelnen in der Blackbox mit Abertausenden Einzelüberweisungen drin ist. Die Überwachungssysteme der Banken schlagen nur manchmal an – in den allermeisten Fällen müssen die Banken die Gelder durchleiten: praktisch ohne Prüfung.
Die Banken verpflichten den Zahlungsdienstleister in der Regel zwar darauf, dass er Transaktionen aus bestimmten Geschäftsfeldern wie Rotlicht, Wett- und Glücksspiel nicht an die Bank weiterleitet, aber: Kennt der Zahlungsdienstleister seine Kunden überhaupt gut genug, die sich hinter Offshore-Konstruktionen verbergen können? Eher nicht. Selbst bei der BaFin räumt man ein, dass das Problem besteht und national kaum lösbar ist. Der Kontrahierungszwang folgt europäischer Gesetzgebung, und viele Zahlungsanbieter, die in Deutschland ihre Dienste anbieten, kommen aus dem EU-Ausland, zum Beispiel aus Malta, das für seine laschen Kontrollen bei der Geldwäsche berüchtigt ist.
Auch Wirecard war übrigens ein Zahlungsdienstleister. Der niederländische Geldwäscheexperte Dick Crijns hält Wirecard sogar für die potenziell perfekte Geldwaschmaschine. „Wirecard war ein großer Finanzdienstleister und in einem respektablen Land wie Deutschland an der Börse notiert. Eine kriminelle Organisation findet dort genug Gelegenheiten, um hohe Geldbeträge zu überweisen sowie Firmenbeteiligungen und eigene Aktien zu kaufen.“[10] Daran, so steht zu befürchten, wird sich so schnell nichts ändern.
Der Beitrag basiert auf dem neuen Buch der Autoren „Dreckiges Geld. Wie Putins Oligarchen, die Mafia und Terroristen die westliche Demokratie angreifen“, das kürzlich im Piper-Verlag erschienen ist.
[1] Bundesrechnungshof, Bericht über die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch die Financial Intelligence Unit (FIU), 11.9.2020.
[2] Arne Meyer-Fünffinger und Josef Streule, Wirecard-Skandal: Verdachtsmeldung auf dem Silbertablett, www.br.de, 5.6.2021.
[3] Arne Meyer-Fünffinger und Josef Streule, Wirecard und die „Mastercard“ der Commerzbank, www.tagesschau.de, 9.6.2021.
[4] Miles Johnson und Dan McCrum, Wirecard processed payments for mafia-linked casino, www.ft.com, 3.8.2020.
[5] Bayrischer Landtag, Auszug aus DS 18/10867, Anfragen Dr. Martin Runge zum Plenum zur Plenarsitzung am 21.10.2020, Antwort der Staatsregierung, www1.bayern.landtag.de, 19.10.2020.
[6] Bundestag Finanzausschuss, 65. Sitzung, S. 32, www.bundesgerichtshof.de, 19.19.2011.
[7] Deutscher Bundestag, Wirecard-Untersuchungsausschuss. Vorläufiges stenografisches Protokoll 19/19, 28.1.2021.
[8] Bericht des Bundesrechnungshofes für den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages über die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch die Financial Intelligence Unit (FIU). Defizite bei der Geldwäschebekämpfung im Nichtfinanzsektor, Gz.: VIII 5 – 2018 – 1071/2 VS-NfD, 16.12.2020.
[9] Bayrischer Rundkfunk, Doku: Der Fall Wirecard: Von Sehern, Blendern und Verblendeten, www.youtube.com, 20.12.2020.
[10] Dick Crijns, Wirecard viewed from a money laundering perspective, Anti Money Laundering Centre NL, www.amlc.eu, 3.8.2020.