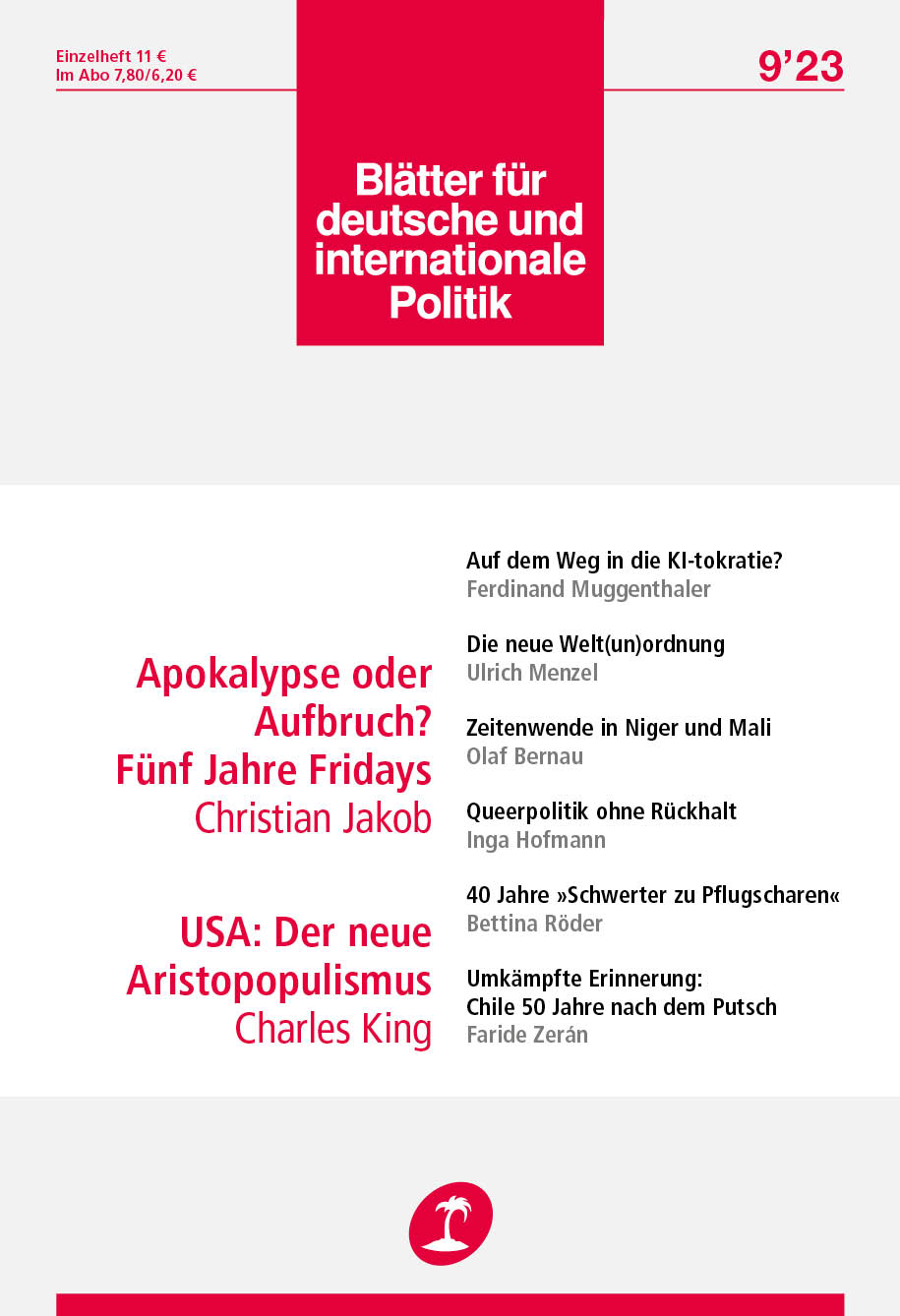Bild: Eine Europafahne mit den Abdrücken blutiger Hände, 20.6.2023 (IMAGO / epd-bild / Christian Ditsch)
Wieder einmal sind die Flüchtlingszahlen weltweit angestiegen. Laut dem Global Trends Report des UN-Flüchtlingshilfswerks waren Ende 2022 mehr als 108 Millionen Menschen auf der Flucht.[1] Doch zu den wiederholten Warnungen vor einem angeblichen Massenansturm auf Europa besteht kein Anlass. Denn von den aktuellen Flüchtlingen sind 62,5 Millionen Menschen Binnenvertriebene, die also ihren Herkunftsstaat nicht verlassen haben. Und von den restlichen rund 35 Millionen Menschen kommt nur ein Bruchteil in die Europäische Union. Dort sind im vergangenen Jahr die Flüchtlingszahlen vor allem wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gestiegen, der die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg zur Folge hatte. Aktuell ist Europa weit davon entfernt, einen Großteil der Schutzsuchenden aufzunehmen.
Ein Weckruf für die internationale Staatengemeinschaft sollten die neuen Zahlen der UN dennoch sein. Notwendig wären gemeinsame Absprachen, wie fluchtauslösende Kriege und Konflikte gelöst werden können, wie sich das jährlich tausendfache Sterben an den Grenzen beenden ließe, wie Schutzsuchenden eine menschenwürdige Unterbringung ermöglicht wird, wie sie Zugang bekommen zu fairen und rechtsstaatlichen Verfahren und welche Schritte nötig sind, um ihnen langfristige Perspektiven in den Aufnahmegesellschaften zu ermöglichen. Stattdessen steht das individuelle Asylrecht weltweit unter Druck. Zunehmend stellen die ökonomisch starken Staaten des Globalen Nordens rechtsstaatliche Asylverfahren zur Disposition und setzen auf Abschottung. In den USA hat die Regierung unter Joe Biden eine Regelung zu verantworten, durch die Schutzsuchenden die Einreise verweigert wird, wenn sie nicht zuvor Asyl in einem Drittland beantragt haben. Im Juli 2023 kippte ein US-Bundesgericht diese Regelung zwar vorläufig, aber der Kurs der Regierung ist klar.
In Großbritannien versucht die Tory-Regierung unter Rishi Sunak, auf allen Ebenen Fluchtwege zu versperren und Asylsuchende zu entrechten. Immerhin ist Innenministerin Suella Bravermann mit ihrem Plan gescheitert, eine rigorose Rückführungspolitik zu betreiben. Der sogenannte Ruanda-Deal, durch den Asylsuchende in das afrikanische Land abgeschoben werden sollten – egal, ob sie sich zuvor dort aufgehalten haben oder nicht –, wurde durch das Berufungsgericht in London gekippt. In Ruanda gäbe es kein funktionierendes Asylsystem, dass Schutzsuchende vor der Kettenabschiebung in andere Staaten schütze, so das Gericht. Diesen menschenrechtlichen Einwänden zum Trotz hat die Ruanda-Lösung jedoch auch in der EU Anhänger. So setzte sich die österreichische schwarz-grüne Regierung bei den Verhandlungen um ein neues Asylsystem in Brüssel vehement für eine solche Möglichkeit ein.
Mit dem Ratsbeschluss vom 8. Juni zur Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) ist die EU noch nicht so weit gegangen wie die Biden-Regierung in den USA oder die Tories in Großbritannien. Aber der Beschluss der europäischen Innenminister demonstriert den Unwillen Europas, einen rechtebasierten Flüchtlingsschutz aufrechtzuerhalten. Dabei hat insbesondere die Bundesrepublik Deutschland eine historische Verantwortung: Die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950 waren auch eine Reaktion auf die Gräueltaten des NS-Regimes und millionenfacher Flucht in den 1930er und 1940er Jahren. Dennoch hat die Ampelregierung bei den Verhandlungen auf EU-Ebene die restriktive Position der EU-Kommission im Prinzip gestützt und keine Abkehr von der Politik der Entrechtung gefordert.
Das individuelle Asylrecht unter Beschuss
Ein zentraler Baustein des internationalen Flüchtlingsschutzes ist das Verbot des sogenannten Refoulement. Das heißt: Kein Vertragsstaat darf Menschen in ein Land abschieben, in dem dieser Person Folter oder eine unmenschliche Behandlung droht. Um das sicherzustellen, bedarf es aber individueller Verfahren, damit dies im Einzelfall überprüft wird. Die aktuellen Debatten um eine Ersetzung des individuellen Asylrechts, die jüngst etwa der Unionsgeschäftsführer Thorsten Frei gefordert hat,[2] ignorieren, dass durch den Refoulement-Schutz in jedem Fall ein individuelles Verfahren durchgeführt werden muss, wenn ein Mensch in Europa um Asyl ersucht.
Auf dem Papier lassen die EU-Innenminister das individuelle Asylrecht und den Refoulement-Schutz zwar stehen, sie wollen aber mit dem neuen, von der EU-Kommission vorgeschlagenen, Asyl- und Migrationspakt Instrumente einführen oder ausbauen, die einen Zugang zu vollwertigen Asylverfahren versperren: Im Pakt enthalten sind unter anderem Schnellverfahren ohne umfassende Sachverhaltsprüfung, Haftzentren und weniger Rechtsschutz. Viele Regierungen der EU-Mitgliedstaaten wollen im Kern, dass keine Flüchtlinge mehr auf illegalisierten Routen nach Europa gelangen – und sie weigern sich zugleich, legale Fluchtwege zu schaffen.[3]
Die geplanten EU-Asylrechtsverschärfungen treiben die seit mehreren Jahrzehnten dominierende Logik der Externalisierung der Migrationskontrollen in doppelter Hinsicht weiter: Erstens schieben die zentraleuropäischen Mitgliedstaaten weiterhin die Verantwortung für die Aufnahme von Schutzsuchenden an die europäische Peripherie ab. In Griechenland, Italien und Spanien sollen die neuen Grenzverfahren vorrangig durchgeführt werden, und auf eine verbindliche Verteilung von Asylsuchenden in Europa hat sich der Rat nicht geeinigt. Zweitens werden bereits vorhandene Instrumente wie die sicheren Drittstaatkonzepte verschärft und ausgeweitet, um leichter Abkommen mit autokratischen Drittstaaten schließen zu können. Die Standards, ab wann ein Staat nach EU-Recht als angeblich sicher gilt, werden dabei noch einmal stark abgesenkt, beispielsweise muss der Staat künftig nicht mehr umfassend die Genfer Flüchtlingskonvention ratifiziert oder umgesetzt haben.
Durch diese Änderung soll auch der EU-Türkei-Deal nachträglich legalisiert werden, der nie dem europäischen Asylrecht entsprochen hat. Ohnehin hat dieses Abkommen in der Praxis nicht funktioniert. Vorgesehen waren unter anderem Visaerleichterungen für die Türkei, die nicht umgesetzt wurden, die Aufnahme von syrischen Schutzsuchenden aus der Türkei, die nicht erfolgt ist, und Rückführungen von Asylsuchenden aus den EU-Hotspots, die kaum stattgefunden haben. Das einzige, was der EU-Türkei-Deal am Ende tatsächlich bewirkt hat, ist die Festsetzung von Asylsuchenden auf griechischen Inseln und unwürdige Zustände wie in den Lagern auf Lesbos oder Samos, die zuletzt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als menschenrechtswidrig beurteilt wurden.[4]
Neue Deals mit Autokraten
Trotz solcher Erfahrungen mit Migrationspartnerschaften hat die EU bereits den nächsten Deal mit einer autokratischen Regierung geschlossen. Mehrmals reisten die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni unter dem Slogan #TeamEurope nach Tunis, um höchstpersönlich mit Präsident Kais Saied zu verhandeln. Sie schafften es im Juli 2023, ein sogenanntes Memorandum of Understanding zu vereinbaren. Es umfasst laut EU-Kommission fünf Säulen: makroökonomische Stabilität, Handel und Investitionen, grüne Energiewende, zwischenmenschliche Kontakte und Migration.[5] Von den fast einer Mrd. Euro, die die EU-Kommission Tunesien zur Verfügung stellen will, sollen rund 105 Mio. in den Kampf gegen sogenannte irreguläre Migration fließen. Doch unter diesen Begriff fallen faktisch alle Schutzsuchenden, die versuchen, über das Mittelmeer Europa zu erreichen.
Ein internes Schreiben aus dem deutschen Auswärtigen Amt, das „Zeit online“ einsehen konnte, äußert deutliche Kritik am übereilten Vorgehen der EU-Kommission. Der Deal mit Tunesien sei ohne rechtsstaatliche Garantien zustande gekommen und die Kommission habe den Rat bei den Verhandlungen übergangen.[6] Das Kapitel über Migration enthält zudem keine Vereinbarungen, wie Flüchtlinge in Tunesien menschenwürdig aufgenommen werden sollen. Das Land hat bis heute kein funktionierendes Asylsystem und befindet sich derzeit in einer akuten Wirtschaftskrise.
Die Europäische Union verhandelt nicht das erste Mal mit Tunesien. Schon Anfang der 2000er Jahre wollte die EU das Land dabei unterstützen, ein „wirksames und umfassendes Grenzverwaltungssystem“ zu schaffen.[7] Das tunesische Parlament stellte 2004 sogar per Gesetz die irreguläre Ausreise unter Strafe. Damals kooperierte Europa noch mit dem autokratischen Präsidenten Zine el-Abedine Ben Ali, der 2011 im Zuge des Arabischen Frühlings gestürzt wurde. Nach den Umbrüchen in der nordafrikanischen Welt kollabierte jedoch auch das Grenzabschottungssystem der EU. Seitdem versucht Brüssel, mit den alten Instrumenten das schon einmal gescheiterte Grenzregime wiederaufzubauen.
Der neue Deal mit Tunesien fällt in eine Zeit, in der Präsident Saied die Justiz entmachtet, die Pressefreiheit einschränkt und rassistische Verschwörungserzählungen über Flüchtlinge verbreitet. Die tunesische Opposition kritisiert das Abkommen folglich und vermutet, dass der autokratische Präsident dadurch sein Regime stabilisieren will. In der Tat hat Saied mit dem Deal ein Druckmittel in der Hand, um die EU davon abzuhalten, die innenpolitischen Zustände im Land zu kritisieren. Schon Libyens Diktator Muammar al-Gaddafi und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdog˘an haben in der Vergangenheit die Migrationspartnerschaften mit der EU genutzt, um sich außenpolitisch zu immunisieren. Die EU manövriert sich mit diesen Deals daher in eine außenpolitische Sackgasse.
Zudem ist mehrfach dokumentiert, wie die tunesische Polizei Flüchtlinge schutzlos in der Wüste ausgesetzt hat. Human Rights Watch hat der tunesischen Regierung wiederholt vorgeworfen, Flüchtlinge aus Ländern südlich der Sahara menschenrechtswidrig zu behandeln.[8] „Dieser Migrationsdeal wird wahrscheinlich zu längeren, gefährlicheren und damit tödlicheren Migrationsrouten führen. Der Deal wird die Schleuser-Systeme nicht schwächen, sondern stärken“, sagt die Migrationsforscherin Ahlam Chemlali.[9]
Das Grenzregime ist nicht alternativlos
Victoria Rietig, Leiterin des Migrationsprogramms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, hat in einem Artikel den „Empörten“ bzw. Kritikern des Deals vorgeworfen, wesentliche Punkte der Partnerschaft zu übersehen.[10] Tunesien handele nicht nur auf Geheiß der EU, sondern habe „ein Eigeninteresse daran, seine Grenzen zu kontrollieren und gegen gefährliche Bootsüberfahrten vorzugehen“. Tatsächlich aber werden durch diese Politik tunesische Staatsbürger, die dem Abbau demokratischer Rechte und wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit entgehen wollen, faktisch im Land eingeschlossen. Dadurch ist das Menschenrecht auf Auswanderungsfreiheit berührt, wie es in Artikel 13 Absatz 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte normiert ist. Rietig führt weiterhin an, es gäbe keine guten Alternativen zu dem Deal. Sie stellt damit die Prämisse auf, die EU müsse solche Migrationspartnerschaften eingehen und könne sich ihre Partner nicht immer nach rechtsstaatlichen Kriterien aussuchen. Aber die Alternative zu solchen Abkommen ist eine konsequente Übernahme von Verantwortung der Europäischen Union für den Flüchtlingsschutz und die Einhaltung geltenden europäischen Rechts.
Denn durch solche Übereinkünfte verweigert sich die EU seit Jahren einer ernsthaften Debatte, wie eine humane Flüchtlingsaufnahme und wie rechtsstaatliche Verfahren auf europäischem Boden garantiert werden können. Der Fokus auf Abschottung und die Darstellung von Flucht als Gefahr haben rechte und rechtsextreme Bewegungen und Parteien in Europa gestärkt. Da sie in vielen EU-Mitgliedstaaten inzwischen die Migrationsagenda vorgeben, haben sich die Spielräume für eine menschenrechtsbasierte Asyl- und Migrationspolitik in den vergangenen Jahren erheblich verkleinert. Die EU-Kommission als Hüterin der Verträge müsste in dieser Situation das europäische Flüchtlingsrecht verteidigen. Stattdessen forciert sie weitere Asylrechtsverschärfungen und stärkt Regierungen wie der derzeitigen griechischen den Rücken, die brutale völkerrechtswidrige Pushbacks durchführt.
Angesichts dessen müssen sich die zivilgesellschaftlichen Kräfte, die für die Verteidigung von Menschenrechten einstehen, neu sortieren und transnationale Bündnisse vertiefen. Im Falle des Tunesien-Deals hat sich zumindest gezeigt, dass NGOs, Aktivisten und Medienschaffende auf der europäischen und tunesischen Seite sehr schnell in der Lage waren, die Menschenrechtsverletzungen zu skandalisieren. Solche Partnerschaften müssen dringend vertieft werden.
[1] Vgl. Zahlen und Fakten zu Menschen auf der Flucht, uno-fluechtlingshilfe.de.
[2] Thorsten Frei, Das individuelle Recht auf Asyl muss ersetzt werden, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 18.7.2023.
[3] Vgl. Marcus Engler, Aus den Augen, aus dem Sinn: Flüchtlingsabwehr in der EU, in: „Blätter“, 8/2023, S. 41-44.
[4] EGMR, A.D. v. Greece, Entscheidung vom 4.4.2023, Beschwerdenummer 55363/19.
[5] Vgl. The European Union and Tunisia: political agreement on a comprehensive partnership package, ec.europa.eu/commission, 16.7.2023.
[6] Franziska Grillmeier, Yassin Musharbash und Bastian Mühling, Ohne Rücksicht auf Verluste, zeit.de, 2.8.2023.
[7] Brot für die Welt, medico international und Pro Asyl (Hg.), Im Schatten der Zitadelle, Berlin und Frankfurt a.M. 2013, S. 121.
[8] „Al Dschasira“, 14.7.2023.
[9] Vgl. „Der EU-Tunesien-Deal wird Schleuser-Systeme stärken“, mediendienst-integration.de, 26.7.2023.
[10] Victoria Rietig, Fünf Punkte, die Kritiker des Tunesien-Abkommens übersehen, spiegel.de, 22.7.2023.