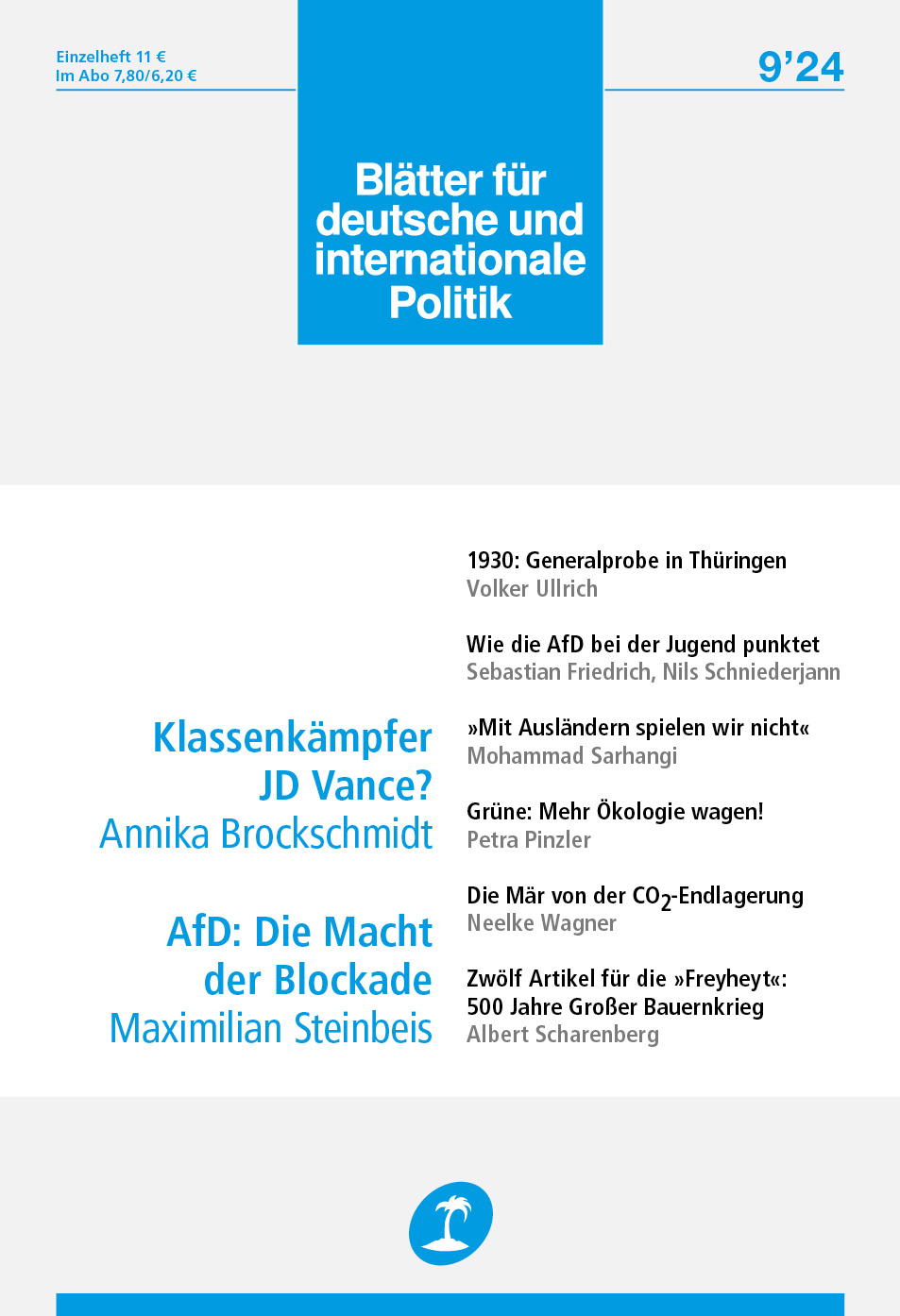Wie die AfD bei der Jugend punktet

Bild: Auf TikTok fordert der AfD-Politiker Maximilian Krah Schüler dazu auf, sich zur AfD zu bekennen (IMAGO / Guido Schiefer)
Lange galten die meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland eher als links oder allenfalls als unpolitisch. Daher war die mediale Aufregung groß, als im April die Trendstudie „Jugend in Deutschland 2024“ der AfD attestierte, mit 22 Prozent Zustimmung die beliebteste Partei bei den 14- bis 29-Jährigen zu sein.[1] Zum Vergleich: Vor zwei Jahren kam die AfD in derselben Jugendstudie auf neun Prozent. Und bei Wahlen konnte sie bislang weder bei Älteren noch bei Jüngeren punkten, sondern vor allem bei Menschen mittleren Alters. Obwohl die Studie methodisch kritisiert wurde, stützen verschiedene Wahlen und Umfragen der vergangenen Monate die Kernaussage der Erhebung. So lag die AfD bei der Europawahl im Juni laut Infratest Dimap bei den 16- bis 24-Jährigen nur einen Prozentpunkt hinter CDU/CSU auf dem zweiten Platz,[2] laut Forschungsgruppe Wahlen war die AfD bei Jüngeren sogar gleichauf mit der Union.[3] Auch bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern im Herbst 2023 konnte die AfD bei jungen Wählern punkten: In Bayern erhielt sie bei den 18- bis 24-Jährigen 16 Prozent, in Hessen sogar 18 Prozent der Stimmen.[4] Noch deutlicher zeigt sich die Entwicklung bei der „U18-Wahl“, einer bundesweiten Simulation für Jugendliche unter 18 Jahren. Dort hat die AfD binnen fünf Jahren ihr Ergebnis verdoppelt.[5] Es zeigt sich: Bei jungen Erwachsenen punktet die Partei überproportional.
Der Aufstieg der AfD unter jungen Wählern ist symptomatisch für die gegenwärtige Krise der politischen Ordnung. Kurz zusammengefasst: Ökonomisch stößt das exportorientierte Wirtschaftsmodell der Bundesrepublik an Grenzen. Auf politischer Ebene verlieren bestehende Institutionen und Ideologien an Bindungskraft, während sich neue noch nicht etabliert haben. Es ist die Zeit fundamentaler Verschiebungen – grundlegende Autoritätskrisen wie diese können sich über Jahre, manchmal auch Jahrzehnte ausdehnen. Dies lässt sich mit Antonio Gramscis Begriff der „Hegemoniekrise“[6] treffend beschreiben: Im Kern geht es darum, dass die alte, postpolitische Hegemonie der Merkelzeit nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch erschüttert wurde. Aufgabe der Nachfolgerkoalition unter Olaf Scholz war es, durch ein Nachholen der verschleppten ökologischen Modernisierung des deutschen Exportmodells ein neues politisches Projekt zu begründen. Darum ging es, als sich das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP als „Fortschrittskoalition“ präsentierte. Doch dieses Projekt ist deutlich ins Stocken geraten.
Blockierte grüne Modernisierung
Die tatsächlich notwendige Transformation wird nämlich derzeit blockiert: zunächst durch (hauptsächlich) angebotsseitige Krisen im Gefolge des Ukrainekriegs, die sich aktuell vor allem wegen des Festhaltens an der Schuldenbremse verschärfen. Mit einer grün-liberalen Modernisierung lassen sich dadurch immer schlechter die gesellschaftlichen Probleme bearbeiten – damit büßt dieses Projekt auch zunehmend an politischer Bindungskraft ein. So hat es die Ampelkoalition nicht geschafft, die zunehmend brüchiger gewordene postpolitische Hegemonie der Merkeljahre durch ein neues Modell zu ersetzen. Ihr zu Beginn zur Schau getragener Zukunftsoptimismus blieb ohne Substanz. Eine Hegemoniekrise findet ihren konkreten Ausdruck unter anderem darin, dass „im Ergebnis von Wahlen […] keine klaren Mehrheiten für die Regierungsbildung [entstehen]“.[7] Das dürfte sich bei den anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland wie auch bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr deutlich zeigen. Denn heute konkurrieren, vereinfacht gesagt, drei politische Projekte zur Krisenbearbeitung, wie die Sozialwissenschaftlerin Lia Becker argumentiert. Im Kern unterscheiden sie sich darin, wie sie die Probleme des deutschen Exportmodells lösen möchten. Auf der einen Seite stehen zwei Varianten von Modernisierern: zum einen die Vertreter einer grün-liberalen Lösung und zum anderen die Verfechter einer autoritär-neoliberalen Modernisierung, für die momentan vor allem die CDU und dort insbesondere Friedrich Merz und Carsten Linnemann stehen. Daneben positionieren sich drittens, ein wenig außerhalb, diejenigen, die eine Erneuerung dieses Modells grundsätzlich ablehnen – und rechts-autoritär die fossilistische Lebensweise im Rahmen des souveränen Nationalstaats verteidigen wollen.[8]
Noch vor zwei Jahren schien klar, welchem dieser Projekte Jugendliche am stärksten zuneigen: Die damalige Jugend-Trendstudie zeigte eine breite Unterstützung für Grüne und FDP – fast die Hälfte der Jugendlichen war von diesen Parteien überzeugt.[9] Die Grünen stehen dabei am prominentesten für das Projekt eines liberalen Ökomodernismus, der die alte, postpolitische Hegemonie ablösen soll. Und stärker noch als die Gesamtbevölkerung befürworteten Jugendliche lange Zeit klar ein solches grün-modernistisches Zukunftskonzept. Doch seit dem Antritt der Ampelkoalition hat ihre Zustimmung drastisch abgenommen: In nur zwei Jahren verzeichneten die Grünen in Umfragen einen Rückgang von neun, die FDP sogar von elf Prozentpunkten in der Gunst der jungen Wähler. Gleichzeitig legen sowohl die politischen Vertreter einer autoritär-neoliberalen Modernisierung als auch die der rechts-autoritären Reaktion in Form der AfD zu. Wie konnte es dazu kommen?
Liberale Frauen, konservative Männer
Will man über den Erfolg der AfD unter Jugendlichen sprechen, darf zunächst nicht unterschlagen werden, dass die Geschlechterdynamik hinter diesem Trend eindeutig ist. Ohnehin stößt die AfD bei Männern auf deutlich stärkeren Zuspruch als bei Frauen, und bei Jüngeren verschärft sich dieser Trend noch: Während junge Frauen in den vergangenen Jahren zunehmend liberalere Positionen einnehmen, tendieren junge Männer in Deutschland weiterhin zu konservativen Ansichten. Dass sich die politischen Präferenzen junger Menschen so stark anhand der Geschlechter polarisiert haben, deutet darauf hin, dass sich die Wahrnehmungen und Erfahrungen von jungen Männern und Frauen in Bezug auf soziale und wirtschaftliche Chancen inzwischen wieder deutlicher unterscheiden. So haben junge Frauen bei der Bildung schon seit Jahrzehnten in vielen Bereichen ihre männlichen Altersgenossen überholt. Seit mehr als vierzig Jahren machen mehr junge Frauen als Männer ihr Abitur, auch erhalten sie über alle Fächer hinweg im Schnitt bessere Noten.[10] Gleichzeitig sehen sich junge Männer, insbesondere solche ohne akademischen Hintergrund, zunehmend mit größeren Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert. Traditionelle „Männerberufe“ in Industrie und Handwerk verlieren an Bedeutung, während der Dienstleistungssektor, in dem Frauen stark vertreten sind, wächst. Diese Verschiebungen können bei jungen Männern zu Verunsicherung und einem erlebten Statusverlust führen. Das ist ein Aspekt der Verschiebung.
Ein anderer, auch von rechter Seite stark genannter Grund für den AfD-Erfolg unter Jugendlichen bezieht sich auf den zunehmenden Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung. Kurz gesagt lautet die rechte Argumentation: Es gebe immer mehr Ausländer, weshalb die AfD nun davon profitiere, dass sie seit Jahren migrationsfeindliche Positionen vertritt. Tatsächlich leben in Deutschland mehr Nichtdeutsche als früher. So lag von 1990 bis Mitte der 2010er Jahre der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung stabil bei rund acht Prozent. Seit 2014 steigt dieser Anteil kontinuierlich an und liegt nun bei 14,6 Prozent.[11] Noch viel höher sind die Zahlen, wenn wir auf Deutsche mit Migrationshintergrund schauen: Unter Jugendlichen in Deutschland sind das inzwischen 30 Prozent.[12] In Zeiten knapper werdender Ressourcen, etwa des Wohnungsmangels in Großstädten, ist diese Entwicklung politisch instrumentalisierbar: Wer keine Wohnung findet, weil die Mieten immer weiter steigen und staatlicher Wohnungsbau – anders als angekündigt – weitgehend ausbleibt, und gleichzeitig sieht, dass immer mehr Menschen im Land leben, die teils auch als Neuankömmlinge sichtbar sind, könnte einen Zusammenhang zwischen beiden Entwicklungen für plausibel halten.
Die eingangs genannte Trendstudie liefert Indizien, dass genau das gerade geschieht. So ist die „Zunahme von Flüchtlingsströmen“ demnach zwar nur die zehntgrößte Sorge der Jugendlichen, aber innerhalb von zwei Jahren hat sich die Zahl derer, die diese Sorge teilen, verdoppelt. Keine andere Sorge hat so sehr zugenommen. Damit sind die Jungen nicht allein. Die Bereitschaft, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, sinkt auch in der Gesamtbevölkerung deutlich. 2021 sagten 36 Prozent der Bundesbürger, Deutschland könne nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen, weil es an seiner Belastungsgrenze sei. Inzwischen sind 60 Prozent dieser Auffassung.[13]
Der rechts-autoritäre Block verschränkt die gesellschaftliche Auseinandersetzung um Migration mit Sozialpolitik und bietet mit seinem regressiven Nationalismus eine vermeintliche Lösung sozialer Probleme. Gerade die AfD deutet seit mehr als einem Jahrzehnt sozioökonomische Fragen zu einem Problem nationaler Identität um. Damit stößt sie inzwischen auch bei einem größeren Teil der Jugend auf Resonanz. Das dürfte jedoch weniger mit dem steigenden Migrationsanteil an sich, sondern mehr mit den gleichzeitig auftretenden Verteilungskämpfen zu tun haben.
Damit kommen wir zum wohl wichtigsten Aspekt. Die Krisenerfahrungen der Jugend häufen sich nämlich weiter an. Die Adoleszenz ist zwar grundsätzlich eine krisenhafte Phase, sowohl affektiv als auch sozial und obendrein eingebettet in Klassen- und Geschlechterverhältnisse.[14] Auch prägen Konflikte zwischen Älteren und Jüngeren seit jeher das Generationenverhältnis: Die einen versuchen, das Bestehende weiterzugeben, die anderen wollen sich gerade von diesem Bestehenden lösen und Neues erschaffen. Aber diese Konflikte können sanfter oder schärfer verlaufen und sind stark abhängig von gesellschaftlichen Entwicklungen. Deshalb stellt sich die Frage, welche Krisen in der Wahrnehmung der Jugendlichen besonders dominant sind.
Laut der SINUS-Jugendstudie, die im Juni erschienen ist, nennen 14- bis 17-Jährige am häufigsten die Themen Klimawandel, Ausgrenzung/Rassismus/Diskriminierung, Inflation sowie Krieg, wenn sie nach Krisen befragt werden.[15] Daneben haben auch vergangene Krisenerfahrungen tiefe Spuren im kollektiven Bewusstsein der Jugend hinterlassen. So dürften sich die Erfahrungen während der Coronapandemie nicht nur negativ auf die Psyche, sondern auch prägend auf das Krisenbewusstsein niedergeschlagen haben. Wichtige Lebensereignisse wie Schulabschlüsse oder der Beginn des Studiums mussten viele Jugendliche unter erschwerten Bedingungen bewältigen. Gerade Jüngere hatten während der Pandemie das Gefühl, ausgeliefert zu sein und die eigene Situation kaum oder gar nicht mehr beeinflussen zu können. Solche Kontrollverluste können autoritäre Lösungen begünstigen.[16]
Die Ethnisierung der sozialen Frage: Ein rechtes Angebot
Auch die Auswirkungen des Klimawandels erleben junge Menschen nicht nur als abstrakte Bedrohung, sondern als konkrete Realität, die ihre Zukunftsperspektiven unmittelbar beeinflusst. Die in der SINUS-Jugendstudie befragten 14- bis 17-Jährigen beschäftigt dies sehr stark: „Aus Sicht der Befragten läuft die Menschheit sehenden Auges in eine Katastrophe, jedoch tut niemand etwas dagegen. Auf diese Gemengelage reagieren die Jugendlichen mit Angst, Ohnmacht und Frust.“[17]
Das Angebot der grün-liberalen Modernisierer, den Klimaschutz sozial verträglich zu gestalten, hat die Ampelkoalition nicht verwirklichen können. Die deutlich wahrgenommene Unfähigkeit zur Problemlösung führt auch und gerade unter Jugendlichen schnell zur politischen Entfremdung. Statt einer ökologischen Modernisierung mit wirtschaftlichem Aufschwung erleben die Jugendlichen weder das eine noch das andere. Im Gegenteil: Es geht wirtschaftlich langsam, aber sicher, bergab. Und das spüren Jugendliche und junge Erwachsene. Studienübergreifend fürchten sie sich besonders stark vor der Inflation. Laut der Jugend-Trendstudie ist dies zurzeit sogar ihre größte Sorge. Gleich daneben steht die Befürchtung, keinen bezahlbaren Wohnraum zu finden. Vielleicht zeigt sich aktuell bei jenen Jüngeren, die nach rechts tendieren und sich gleichzeitig vor negativen ökonomischen Entwicklungen fürchten, eine ähnliche Entwicklung wie bei rechten Arbeitern: Klaus Dörre arbeitete mit seinem Team heraus, dass rechts eingestellte Arbeiter dazu tendieren, den Kampf um Statuserhalt und Verbesserung der eigenen Situation mit Hilfe von Ressentiments auszutragen. Anstelle von universeller Solidarität tritt Konkurrenz- und Wettbewerbsdenken. Rechte Arbeiter werten sich demnach selbst auf, indem sie andere entlang ethnisierender Grenzziehungen abwerten.[18] Daraus ergibt sich eine durchaus konsistente, wenn auch wirtschaftlich meist wenig erfolgversprechende Position.
Inzwischen scheint es auch unter einem Teil der jungen Erwachsenen eine gewisse Nachfrage für die Ethnisierung der sozialen Frage zu geben; eine Nachfrage, für die Teile der AfD und ihres Vorfeldes in den vergangenen Jahren mit Konzepten wie dem „Solidarischen Patriotismus“ ein Angebot geschaffen haben. Björn Höcke und Maximilian Krah, die sich positiv auf dieses Konzept beziehen, beantworten die soziale Frage von rechts, indem sie die sozioökonomischen Konflikte zwischen oben und unten zu Konflikten zwischen innen und außen umdeuten.
Besonders in der Soziologie war in diesem Zusammenhang in den vergangenen Jahren sehr viel von Abstiegsängsten bei den Mittelschichten die Rede. Wilhelm Heitmeyer sprach bereits 2010 von einer Verrohung des Bürgertums, Eva Maria Groß und Andreas Hövermann 2014 von einem marktförmigen Extremismus, Oliver Nachtwey diagnostizierte 2016 eine Abstiegsgesellschaft. Dabei ging es, wie Philip Manow erklärt, nicht unbedingt um die direkten Verlierer –, sondern eher um die, die etwas zu verlieren haben. Kurz: Wer Verlustängste hat, stimmt eher rechten Positionen zu.
In der Regel sind junge Menschen aber in einer Lebenssituation, in der sie wenig zu verlieren haben. Sie stehen am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn, haben in Bezug auf Status und Anerkennung eher noch viel zu gewinnen und zu erarbeiten. Unmittelbare Verlustängste sind bei ihnen deshalb vermutlich weniger ausgeprägt. Es gibt aber etwas, das man eine Verlustangst zweiter Ordnung nennen könnte: die Angst davor, eine versprochene Zukunft zu verlieren. Anders ausgedrückt: Die einen sorgen sich um ihren Platz in der Gesellschaft, die anderen müssen sich diesen erst noch erkämpfen. Wird dieser Kampf härter, ist es kein Wunder, wenn sich immer mehr Jugendliche für die anstehenden Verteilungskämpfe rüsten und die Ellbogen ausfahren.
Die Jugend nimmt nun als eine der letzten Bevölkerungsgruppen – es fehlen weiterhin vor allem die Rentner – zunehmend das gegenhegemoniale Angebot der AfD wahr. Deren historische Bedeutung liegt darin, dass sie als erste Partei in der Bundesrepublik weite Teile der deutschen Rechten zu sammeln vermochte. Dieser Erfolg ist nicht nur ein Zeichen der aktuellen politischen Verschiebungen, sondern auch ein Hinweis auf die Nachhaltigkeit des rechtsradikalen Projekts.
Angesichts der Krise des grün-liberalen Modernisierungsprojekts darf bezweifelt werden, ob es Hoffnung auf eine von dort ausgehende erfolgreiche Gegenwehr geben kann. Zudem fehlt ein klares politisches Zentrum, außerdem ist die gesellschaftliche Linke organisatorisch schwach. Bisher gibt es wenig Anzeichen, dass es der Linken in ähnlicher Weise wie der AfD gelingen könnte, sich politisch zu formieren. Ohne in das gern betriebene „Hoffnungs-Hopping“[19] vieler Linken verfallen zu wollen: Dass eine solche Neuformierung grundsätzlich funktionieren könnte, zeigt ein Blick auf die jüngste Parlamentswahl in Frankreich. Das Linksbündnis Nouveau Front populaire konnte bei den 18- bis 24-Jährigen fast die Hälfte der Stimmen auf sich vereinen – mit 15 Prozentpunkten Vorsprung vor der extremen Rechten. Dass die Partei des in der deutschen politischen Elite so beliebten Emmanuel Macron unter ihnen nur neun Prozent überzeugen konnte, verdeutlicht noch einmal, wie umfassend die Hegemoniekrise des politischen Zentrums unter Jugendlichen ist. Diese Krise dürfte sich künftig eher noch verschärfen.
[1] Simon Schnetzer et al., Trendstudie Jugend in Deutschland 2024: Verantwortung für die Zukunft? Ja, aber, Kempten 2024.
[2] Europawahl in Deutschland, tagesschau.de, 9.6.2024.
[3] Forschungsgruppe Wahlen, Wahlanalyse zur Europawahl 2024. Schwache Ampel – Grüne Hauptverlierer, zdf.de, 10.6.2024.
[4] Sonja Süß, AfD-Schub und Grün-Frust. So ticken junge Wähler in Hessen, hessenschau.de, 9.10.2023.
[5] Vgl. Ergebnisse der U18-Wahlen 2024: wahlen.u18.org.
[6] Antonio Gramsci, Gefängnishefte Bd. 2, Hamburg 1991, S. 1578.
[7] Frank Deppe, Überlegungen zum Charakter der politischen Krise, in: „Z“, 117/2019, S. 15-35.
[8] Vgl. Lia Becker, Blockierte Transformation und rechte Offensive, zeitschrift-luxemburg.de, 12/2023.
[9] Simon Schnetzer et al., Trendstudie Jugend in Deutschland. Die Wohlstandsjahre sind vorbei: Psyche, Finanzen, Verzicht, Kempten 2022.
[10] Vgl. Benjamin Edelstein, Welcher Anteil der Jungen und Mädchen erlangt das Abitur? (1950-2018), bpb.de, 9.5.2023 und Daniel Voyer et al., Gender differences in scholastic achievement: A meta-analysis, in: „Psychological Bulletin“, 4/2014, S. 1174-1204.
[11] Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung in Deutschland von 1991 bis 2023, de.statista.com, 10.6.2024.
[12] Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Alter, bpb.de, 1.1.2022.
[13] Bertelsmann Stiftung, Willkommenskultur in Krisenzeiten, bertelsmann-stiftung.de, 5.3.2024.
[14] Marie Frühauf, Adolescence in times of social-ecological crisis. Perspectives for social pedagogical analysis and research, in: „Social Work & Society“, 21/2023.
[15] Marc Clambach et al., Wie ticken Jugendliche? SINUS-Jugendstudie 2024. Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland, Bonn 2024, S. 156.
[16] Vgl. Ulrike Ravens-Sieberer et al., Die COVID-19-Pandemie – Wie hat sie die Kinderpsyche beeinflusst?, in: „Monatsschrift Kinderheilkunde“, 171/2023, S. 608-614; Sabine Andresen et al., Verpasst? Verschoben? Verunsichert? Junge Menschen gestalten ihre Jugend in der Pandemie, Hildesheim 2023; Wilhelm Heitmeyer, Autoritäre Versuchungen. Signaturen der Bedrohung 1, Berlin 2018.
[17] Clambach et al., Wie ticken Jugendliche? SINUS-Jugendstudie 2024. a.a.O., S. 158.
[18] Klaus Dörre et al., Arbeiterbewegung von rechts? Motive und Grenzen einer imaginären Revolte, in: „Berliner Journal für Soziologie“, 28/2018, S. 55-89.
[19] Nelli Tügel, Neue Volksfront: Bitte kein neues Hoffnungs-Hopping à la Syriza und Bernie Sanders, freitag.de, 12.7.2024.