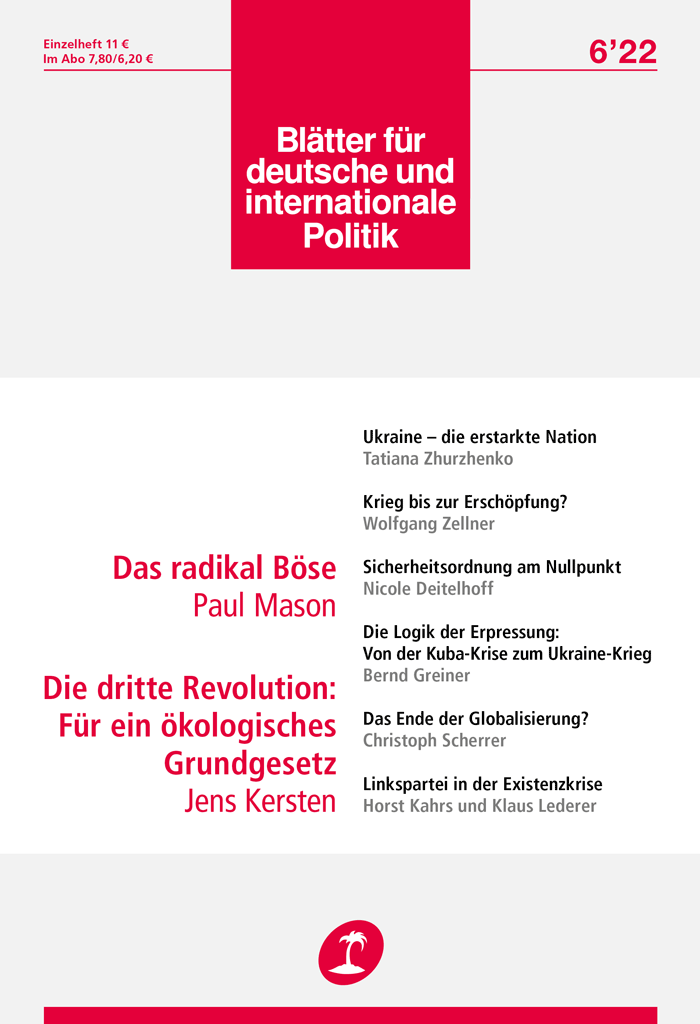Bild: Jean-Luc Mélenchon bei einer 1. Mai-Demonstration in Paris (IMAGO / PanoramiC)
Nehmen wir eines gleich vorweg: Das Abkommen zwischen den französischen linken Parteien im Rahmen der „Neuen Volksunion“ (NUPES) ist eine hervorragende Nachricht für die französische und die europäische Demokratie.[1] Wer darin bloß einen Triumph der Radikalität und des Extremismus sieht, hat offenkundig nichts von den Entwicklungen des Kapitalismus sowie den sozialen und ökologischen Herausforderungen verstanden, denen wir gegenüberstehen. Tatsächlich zeigt eine gelassene Beschäftigung mit dem Transformationsprogramm der NUPES: Es ist weniger ambitioniert als jenes der Volksfront, die ab 1936 regierte, oder auch als jenes der Mitterrand-Regierung von 1981. Statt sich also dem herrschenden Konservatismus zu beugen, sollte man dieses Programm für das nehmen, was es ist: eine gute Ausgangsbasis, um weiterzugehen.
Das Programm steht zunächst dafür, dass soziale Gerechtigkeit und Steuergerechtigkeit zurück auf der politischen Agenda sind. Da die Inflation bereits die Einnahmen und Ersparnisse der einfachen Leute beschneidet, müssen wir dringend den Kurs wechseln. Wer behauptet, für Emmanuel Macrons Politik müsse niemand bezahlen, belügt bloß die Bürger: Um die Schwächsten für die Auswirkungen der Inflation zu entschädigen und die Investitionen in Gesundheit, Bildung und Umwelt zu finanzieren, ist es unerlässlich, die Wohlhabenden in die Pflicht zu nehmen. Zwischen 2010 und 2022 sind die 500 größten französischen Vermögen laut dem Magazin „Challenges“ (das linker Neigungen unverdächtig ist) von 200 Mrd. auf fast 1000 Mrd. Euro angewachsen, das heißt von zehn Prozent des BIP auf fast 50 Prozent des BIP. Dieser Anstieg ist sogar noch stärker, wenn man den Fokus weitet und die 500 000 größten Vermögen in den Blick nimmt, die von einem Prozent der erwachsenen Bevölkerung gehalten werden: Sie übersteigen heute 3000 Mrd. Euro – oder sechs Millionen Euro pro Person, laut der World Inequality Database. Dem stehen nicht einmal 500 Mrd. Euro für die 25 Millionen ärmsten Franzosen gegenüber – also für 50 Prozent der erwachsenen Bevölkerung, von denen jeder im Schnitt über 20 000 Euro verfügt. In der heutigen Zeit leben die größten Vermögensbesitzer also in spektakulärem Wohlstand, während die einfachen Leute auf der Stelle treten. Wer angesichts dessen, wie es Macron getan hat, die magere Vermögenssteuer streicht, zeigt einen merkwürdigen Sinn für Prioritäten. Tatsächlich spricht doch jedwede Evidenz für ihre Anhebung. Historiker, die sich einst dieser Periode widmen werden, werden nicht freundlich mit den Regierungen Macron und ihren Unterstützern umgehen.
Das wesentliche Verdienst der linken Parteien besteht daher darin, dass sie es vermocht haben, ihre Konflikte zu überwinden, um sich gemeinsam dieser ökonomischen Schieflage entgegenzustellen. Zusätzlich zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer schlagen sie vor, die Grundsteuer in eine progressive Steuer auf das Nettovermögen umzuwandeln. Dies würde zu starken Steuererleichterungen für Millionen überschuldeter Franzosen aus der Arbeiter- und Mittelklasse führen. Um den Zugang zu Eigentum zu erleichtern, ließe sich das langfristig um ein System des Mindesterbes für alle ergänzen.
Die Nebenvereinbarung zwischen Mélenchons LFI und den Sozialisten sieht außerdem vor, Arbeitnehmerrechte auf die Beschäftigten der Plattformökonomie auszuweiten und die Präsenz der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten zu stärken. Ein solches System existiert in Schweden und Deutschland bereits seit der Nachkriegszeit. Dabei sind in großen Unternehmen bis zu 50 Prozent der Sitze für Arbeitnehmervertreter reserviert, was zu einer besseren Einbindung aller in die langfristigen Investitionsstrategien geführt hat.
In Frankreich steckt ein solches System leider immer noch in den Kinderschuhen: Die Rechte stand ihm stets extrem feindselig gegenüber. Die Gaullisten haben zwar mitunter so getan, als ob sie eine Gewinnbeteiligung der Beschäftigten fördern würden – tatsächlich ging es nur um ein paar Brosamen –, aber das Monopol der Aktionärsmacht haben sie nie infrage gestellt. Und die Linke hat sich lange auf Nationalisierungen konzentriert (wie 1981). Die derzeitige Wende hin zu einem weniger etatistischen und stärker partizipativen Ansatz erinnert an die bedeutenden Kollektivverträge von 1936 und ebnet den Weg für ein neues Paradigma. Auch hierbei wird man langfristig weitergehen müssen, beispielsweise indem man in allen Unternehmen, kleinen wie großen, 50 Prozent der Sitze für Arbeitnehmervertreter garantiert und das Stimmrecht eines Einzelaktionärs in den Großunternehmen auf 10 Prozent begrenzt.
Kommen wir zur europäischen Frage: Alle Mitglieder der NUPES befürworten die soziale und steuerliche Harmonisierung in Europa und den Übergang zu Mehrheitsentscheidungen. Der Versuch, sie als Anti-Europäer darzustellen, wo sie doch die größten Föderalisten von allen sind, ist ein plumpes Manöver. Die Liberalen, die vorgeblich Europäer sind, tun in Wirklichkeit nichts anderes, als die europäische Idee für ihre antisoziale Politik zu instrumentalisieren. Damit sind sie es, die Europa gefährden.
Die Arbeiterklasse hat wiederholt massiv gegen Europa gestimmt: bei den Volksabstimmungen über den Maastricht-Vertrag 1992, die Europäische Verfassung 2005 und erneut beim Brexit-Referendum von 2016. Das liegt vor allem daran, dass die europäische Integration, so wie sie bislang konzipiert wurde, strukturell die mächtigsten und mobilsten ökonomischen Akteure bevorzugt – auf Kosten der Schwächsten. Es ist Europa, das die Welt dazu verleitet hat, die Profite der Multinationalen immer schwächer zu besteuern. Heute beglückwünschen sich manche Länder zu einem Mindeststeuersatz von 15 Prozent, kaum mehr als der irische Satz von 12,5 Prozent und überdies leicht zu umgehen. Auf jeden Fall ist es viel weniger als das, was mittelständische Betriebe sowie die Mittel- und Arbeiterklasse bezahlen. Wer vorgibt, man könne dieses Problem lösen, wenn man beim Prinzip der Einstimmigkeit bleibt, der lügt. Um das Steuerdumping, das Sozialdumping und das Umweltdumping in Europa zu beenden, müssen wir unseren Partnern präzise sozial-föderale Vorschläge machen und zugleich unilaterale Maßnahmen ergreifen, um die Blockaden zu überwinden. So könnte Frankreich, wie das European Tax Observatory gezeigt hat, ab sofort einen Mindeststeuersatz von 25 oder 30 Prozent auf diejenigen Unternehmen erheben, die in Steueroasen angesiedelt sind und in Frankreich Güter oder Dienstleistungen verkaufen.
Hoffen wir, dass der Parlamentswahlkampf die Gelegenheit bietet, die karikaturhaften Darstellungen der „Neuen Volksunion“ hinter sich zu lassen und bei den entscheidenden Fragen wirklich voranzukommen.
© Le Monde
Aus dem Französischen von Steffen Vogel.
[1] Bei der französischen Parlamentswahl am 12. und 19. Juni kandidieren La France Insoumise (LFI), Grüne, Sozialisten, Kommunisten und weitere kleinere Parteien gemeinsam, um mit einer Mehrheit in der Nationalversammlung LFI-Chef Jean-Luc Mélenchon zum Premier wählen und Präsident Emmanuel Macron eine Cohabitation aufzwingen zu können. – D. Red.