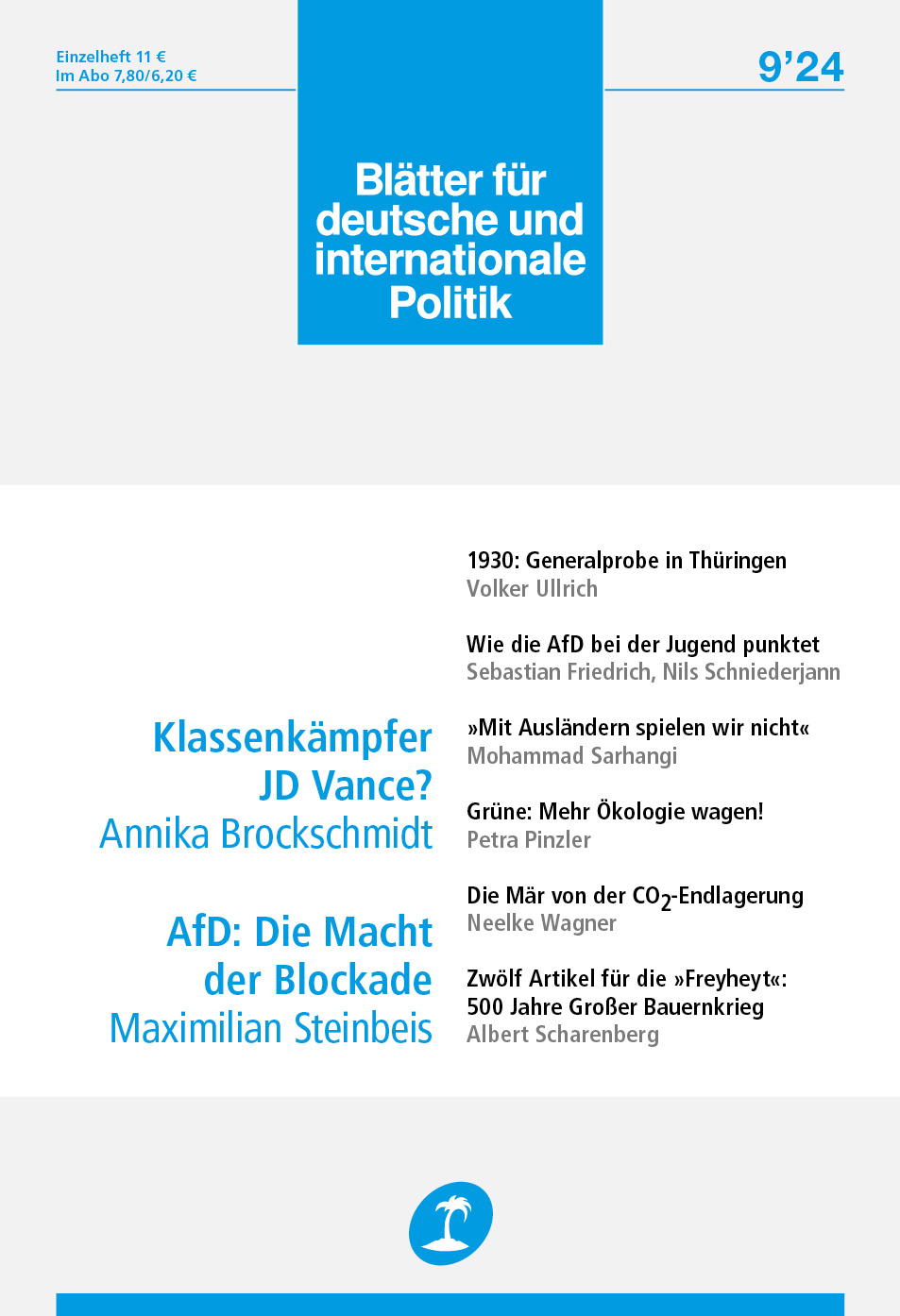Bild: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius neben Oberst Sammy Mbassa bei seinem Besuch im Fliegerhorst in Büchel, 18.7.2024 (IMAGO / Panama Pictures)
Die gemeinsame deutsch-amerikanische Erklärung am Rande des Nato-Gipfels Anfang Juli 2024 hatte es in sich. Zum ersten Mal seit Ende des Kalten Krieges wollen die USA ab 2026 bodengestützte Mittelstreckenraketen in Deutschland stationieren, darunter Tomahawk-Marschflugkörper, ballistische Raketen des Typs Standard Missile 6 und die Hyperschallrakete Dark Eagle. Während Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius die Entscheidung verteidigen, häufen sich zunehmend auch kritische Stimmen.[1] Gefordert wird mittlerweile eine offene Aussprache im Bundestag. Auch das Auswärtige Amt reagierte. In einem Schreiben an die Fachausschüsse des Bundestages betonten die Parlamentarischen Staatssekretäre, dass die geplanten Systeme zu einer effektiven Abschreckung beitragen würden und als Reaktion auf die Bedrohung durch Russland notwendig seien.[2] Dennoch bleiben viele Fragen unbeantwortet. Das zeigt: Es ist Zeit für eine strategische Debatte über deutsche Verteidigungspolitik.
Für Fachleute kommt die geplante US-Stationierung von bodengestützten Mittelstreckenraketen in Europa nicht überraschend. Sie ist Teil einer umfassenden Strategie der USA, die seit mehreren Jahren präzise Abstandswaffen großer Reichweite in den Mittelpunkt ihres vernetzten Ansatzes zur Abschreckung und Kriegsführung stellt. Hintergrund dafür sind Überlegungen, wie die bisherige Vormachtstellung trotz zunehmender Konkurrenz mit Staaten wie Russland, insbesondere aber mit China, auch in Zukunft aufrechterhalten werden kann.
Denn aufgrund ihres globalen Machtanspruchs sind die USA darauf angewiesen, jederzeit den Zugang zu geopolitischen Brennpunkten sicherzustellen, um im Konfliktfall ihre militärische Überlegenheit ausspielen zu können. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben einige Staaten jedoch asymmetrische Mittel entwickelt, um diese Form der Kontrolle zu erschweren. Sie werden oft unter dem Begriff Anti-Access und Area Denial (A2/AD) zusammengefasst. Der Effekt dieser Mittel: Indem US-Streitkräfte und militärische Anlagen über große Entfernungen hinweg bedroht werden, wird deren Bewegungsfreiheit eingeschränkt und der Zugang zum Konfliktschauplatz erschwert.
Als Antwort darauf haben die USA einen integrierten Verteidigungsansatz entwickelt. Alle Teilstreitkräfte sollen gemeinsam agieren und dabei helfen, A2/AD-Zonen zu überwinden. Zentrum dieses Ansatzes ist die Multi-Domain Task Force (MDTF) der US-Armee. Eines der wichtigsten Elemente dabei: präzise Abstandswaffen. Fünf solcher Task Forces gibt es mittlerweile. Seit September 2021 befindet sich das Kommando der zweiten MDTF in Deutschland.[3]
Seitdem ist viel passiert. Im Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Russland eine Vielzahl verschiedener Abstandswaffen eingesetzt. Aus Sicht Moskaus ist dieses Vorgehen ein militärischer Erfolg. Noch im Krieg gegen Georgien 2008 besaß Russland nur eine sehr überschaubare Anzahl an modernen Abstandswaffen großer Reichweite. Das hat sich mittlerweile geändert.
Zwischen 2012 und 2020 vergrößerte sich das russische Arsenal an Marschflugkörpern großer Reichweite um den Faktor 37, während die Anzahl der Startrampen für diese Flugkörper um das Zwölffache zunahm. Zur selben Zeit ersetzte Russland die bestehenden Totschka-U-Raketenbrigaden durch Iskander-Systeme mit einer vierfach größeren Reichweite. Die Entwicklung des Marschflugkörpers 9M729 (SSC-8) trug 2019 schließlich zum Ende des Vertrags über bodengestützte Mittelstreckensysteme (INF-Vertrag) bei. Die Nato-Partner gehen davon aus, dass dieser Marschflugkörper eine damals verbotene Reichweite von über 2000 Kilometern besitzt. Moskau bestreitet dies jedoch bis heute.
Mit der Aufrüstung verfolgt der Kreml mehrere Ziele. Einerseits richtet sie sich explizit gegen die seit Jahrzehnten forcierte amerikanische Raketenabwehr. Andererseits möchte Russland Mittel der Abschreckung unterhalb der nuklearen Ebene aufbauen. Für die europäischen Nato-Mitglieder wiederum ist dies problematisch, da ihnen ohne die USA diverse militärische Fähigkeiten fehlen. Im Bereich der Abstandswaffen verfügen sie hauptsächlich über luft- und seegestützte Systeme mit Reichweiten von bis zu 500 Kilometern. Mehrere Staaten haben deshalb bereits damit begonnen, weiterreichende luftgestützte US-Marschflugkörper zu erwerben.
Eigene europäische Projekte zur Aufrüstung bei Abstandswaffen bis in die späten 2030er Jahre sind ebenfalls in Planung. Manche Beobachter gehen davon aus, dass diese Aufrüstung in Europa im Verbund mit der geplanten Stationierung von amerikanischen Mittelstreckensystemen in Deutschland langfristig die notwendige Voraussetzung für neue Rüstungskontrollgespräche mit Russland bieten wird. Aus einer Position der Stärke heraus wäre es möglich, so heißt es, ein Umdenken in Moskau zu erreichen.[4] Auch eine Rückkehr zum Format der vollständigen Abrüstung wie im INF-Vertrag sei dann denkbar.[5]
Welt ohne Rüstungskontrolle
Ein ähnlicher Ansatz lag auch dem Nato-Doppelbeschluss von 1979 zugrunde. Damals reagierte der Westen auf die Aufrüstung der Sowjetunion mit nuklearen SS-20-Raketen, die eine wesentlich größere Reichweite und Zielgenauigkeit als ihre Vorgängermodelle besaßen. In Moskau folgte die Stationierung unter anderem dem Wunsch, in Europa stationierten US-amerikanischen sowie französischen und britischen Nuklearwaffen zu begegnen, die von Europa aus sowjetisches Territorium bedrohen konnten.
Der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt befürchtete jedoch, dass die sowjetische Aufrüstung das Versprechen des amerikanischen Nuklearschutzschirms gegenüber Europa infrage stellen würde. Angesichts der Überlegenheit des Ostens bei konventionellen Waffen und des Gleichgewichts bei strategischen Nuklearwaffen hätten die USA nicht glaubwürdig damit drohen können, einen auf Europa beschränkten Angriff auch mit einem Nuklearschlag zu vergelten, ohne damit selbst einen nuklearen Gegenschlag auf US-amerikanisches Territorium zu riskieren. Die im Doppelbeschluss angekündigte Stationierung von nuklearen Pershing-II-Raketen und von BGM-109G Gryphon-Marschflugkörpern sollte diese Lücke schließen und zur Rückversicherung der europäischen Alliierten beitragen.
Zugleich setzte die Nato jedoch auf Rüstungskontrollgespräche. Die USA schlugen früh die sogenannte doppelte Nulllösung vor: Beide Seiten würden auf alle ihre landgestützten Mittelstreckensysteme weltweit verzichten. Doch für die Sowjetunion hätte dies in Europa eine asymmetrische Abrüstung zu ihrem Nachteil bedeutet. Nach Beginn der US-Stationierung Ende 1983 brach Moskau die Gespräche daher ab. Erst unter Michael Gorbatschow wurden sie wieder aufgenommen. Entscheidend für den Erfolg des INF-Vertrags 1987 blieb die persönliche Haltung Gorbatschows, der bereit war, mögliche militärische Nachteile gegen ökonomische und politische Vorteile einzutauschen.
Diese Bedingungen bestehen heute nicht mehr. Anders als im Kalten Krieg ist Russland der Nato heute konventionell unterlegen. Abstandswaffen großer Reichweite bieten eine Möglichkeit, dem zu begegnen. Gleichzeitig verfügt Russland jedoch über ein großes Arsenal an taktischen Nuklearsprengköpfen.[6] Diesen stehen aufseiten der Nato lediglich rund einhundert taktische B-61 Freifallbomben im Rahmen der nuklearen Teilhabe gegenüber. Für die Verbündeten bieten konventionelle Abstandswaffen großer Reichweite daher eine Option, um im Ernstfall auf die russischen taktischen Nuklearsprengköpfe reagieren zu können. Beiden Seiten fehlt deshalb ein strategisch begründbares Interesse an einer Abrüstung dieser Waffenkategorie. Wichtiger noch: Eine Neuauflage des INF-Vertrags müsste global angelegt sein, da die äußerst mobilen Waffensysteme ansonsten jederzeit verlegt werden können. Doch mittlerweile hat vor allem China bodengestützte Mittelstreckenraketen stationiert. Der Fokus der USA auf den Indopazifik wird primär von dieser Entwicklung bestimmt, aber auch regionale Verbündete wie Japan und Südkorea rüsten bei Abstandswaffen auf. Dieser Prozess berührt wiederum die militärpolitischen Interessen Russlands im Fernen Osten. Eine solche Konstellation macht Rüstungskontrolle nicht völlig unmöglich, aber äußerst voraussetzungsreich.
Eskalationskontrolle ist nötig
In Europa spielen dieselben Waffensysteme noch eine weitere Rolle. Sie sind ein wesentliches Element für die Verlegung und den Einsatz von Fähigkeiten, um Zugang und Bewegungsfreiheit auf einem möglichen Kriegsschauplatz sicherzustellen. Die aktuelle Nato-Militärstrategie fokussiert im Verteidigungsfall ausdrücklich auf horizontale Eskalation, also die Ausweitung des Kampfgebiets.[7] Ziel ist es, Russland daran zu hindern, einen begrenzten Krieg, etwa im Baltikum, erfolgreich zu führen und früh zu seinen Gunsten zu entscheiden.
Gleichzeitig würde eine horizontale Eskalation durch die Nato Russland angesichts der konventionellen Kräfteverhältnisse größere Anreize zum Einsatz von Nuklearwaffen bieten. Aus russischer Sicht liegt es zudem nahe, gerade durch die weitere Verflechtung konventioneller und nuklearer Systeme die Nato von der Durchführung konventioneller „Deep Strike“-Optionen abzuschrecken. Der Westen müsste dann umso mehr mit einer nuklearen Reaktion Moskaus rechnen. Im Fall einer direkten Konfrontation stünden beide Seiten unter Druck, möglichst als Erste zu agieren, um die Fähigkeiten des Gegners zu zerstören und damit einen Vorteil zu erzielen.
Für die europäischen Nato-Mitglieder, die von einem begrenzten Krieg mit Russland in Europa primär betroffen wären – allen voran Lettland, Estland und Litauen – , stellt sich deshalb die Frage, ob die derzeitige Strategie, verbunden mit einem massiven Ausbau von Fähigkeiten bei Abstandswaffen, tatsächlich den bestmöglichen Kompromiss zwischen glaubwürdiger Abschreckung, militärischer Verteidigung im Kriegsfall und Eskalationskontrolle darstellt. Derartige Abwägungsfragen werden in der bisherigen Debatte jedoch kaum thematisiert.
Strategische Alternativen
Angesichts dessen wäre es wichtig, sich hierzulande über verteidigungspolitische Strategien und mögliche alternative Perspektiven auf Abschreckung und Kriegsführung zu verständigen. Zwar ist Deutschland, anders als zu Zeiten des Kalten Krieges, kein Frontstaat mehr, aber als wichtiger Standort von US-Streitkräften und logistischer Dreh- und Angelpunkt im Rahmen der Nato wäre es weiterhin direkt und unmittelbar von einem regionalen Krieg betroffen. Eine Debatte über strategische Alternativen stünde zudem in einer langen Tradition.
Schon die Nato-Strategie der „Flexiblen Reaktion“ im Kalten Krieg war ein politisch-militärischer Kompromiss. Angesichts unterschiedlicher Interessen, Risikowahrnehmungen und Eskalationsbereitschaft war dies auch kaum anders vorstellbar. Daraus resultierte eine widersprüchliche Militärstrategie, die wiederum eine öffentliche Auseinandersetzung beförderte. In Westdeutschland erreichte diese Debatte durch das infolge des Nato-Doppelbeschlusses gesteigerte Interesse an Verteidigungspolitik in den späten 1980er Jahren ihren Höhepunkt. Die damalige Debatte kann auch heute noch konzeptionelle Inspiration liefern, wenn es darum geht, nach Möglichkeiten der Eskalationskontrolle zu suchen.[8]
Dazu könnte gehören, die Anzahl von zu stationierenden Waffensystemen ebenso in den Blick zu nehmen wie die Wahl von Stationierungsorten und einen möglichen Austausch über Militärdoktrinen mit dem Gegner. Darüber hinaus wären Ansätze der Verteidigung denkbar, die Prinzipien der Krisenstabilität einbeziehen, etwa indem Präemption[9] vermieden wird und keine lukrativen Ziele für konventionell- wie nuklearbewaffnete Abstandswaffen geboten werden. Dies kann etwa durch die Verteilung der militärischen Infrastruktur im Raum, Härtung (Verbunkerung) von Anlagen, Tarnung und Redundanzen, also dem Bereitstellen zusätzlicher militärischer Fähigkeiten, erreicht werden.
Dass eine offene Auseinandersetzung über den Umgang mit derartigen Zielkonflikten in der Verteidigungspolitik möglich ist, zeigt die jahrelange Kontroverse in den USA über den richtigen Ansatz gegenüber China. Während die Streitkräfte auch hier den Einsatz von Abstandswaffen großer Reichweite bevorzugen, existieren angesichts nuklearer Eskalationsrisiken auch Vorschläge für potenzielle Alternativen und zusätzliche Strategien, darunter Seeblockaden und der Ausbau eigener A2/AD-Systeme. In der Zeitenwende darf sich auch die deutsche Politik nicht nur mit dem Ausbau europäischer Fähigkeiten begnügen. Sie sollte auch lernen, selbst über angemessene Strategien der Verteidigung zu streiten.
[1] Uli Hauck, Abschreckung oder Provokation?, tagesschau.de, 2.8.2024.
[2] Thomas Wiegold, Dokumentation: die – nun doch anlaufende? – Debatte über US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland, augengeradeaus.net, 20.7.2024.
[3] Congressional Research Service, The Army’s Multi-Domain Task Force (MDTF), crsreports.congress.gov, 10.7.2024.
[4] Jasper Wieck, Nachgefragt – US-Mittelstreckenraketen in Deutschland, Bundeswehr, youtube.com, 27.7.2024.
[5] Sebastian Fischer, Regierungspressekonferenz | BPK , youtube.com, 15.7.2024.
[6] Taktische Nuklearwaffen sind primär für den Kriegseinsatz, auch gegen konventionelle Ziele, vorgesehen, haben eine geringere Reichweite als strategische Nuklearwaffen und sind bis heute unreguliert. Strategische Nuklearwaffen haben eine große Sprengkraft und eine interkontinentale Reichweite. Sie dienen vornehmlich der Abschreckung und wurden in Abkommen zwischen der Sowjetunion/Russland und den USA reguliert.
[7] Sten Rynning, Deterrence Rediscovered: NATO and Russia, in: „NL ARMS Netherlands Annual Review of Military Studies 2020“, S. 29-45, link.springer.com, 2021.
[8] Lukas Mengelkamp, Alexander Graef und Ulrich Kühn, A Confidence-Building Defense for NATO, warontherocks.com, 27.6.2022.
[9] Von einem präemptiven Angriff spricht man, wenn dieser vor einem unmittelbar zu erwartenden gegnerischen Angriff stattfindet.