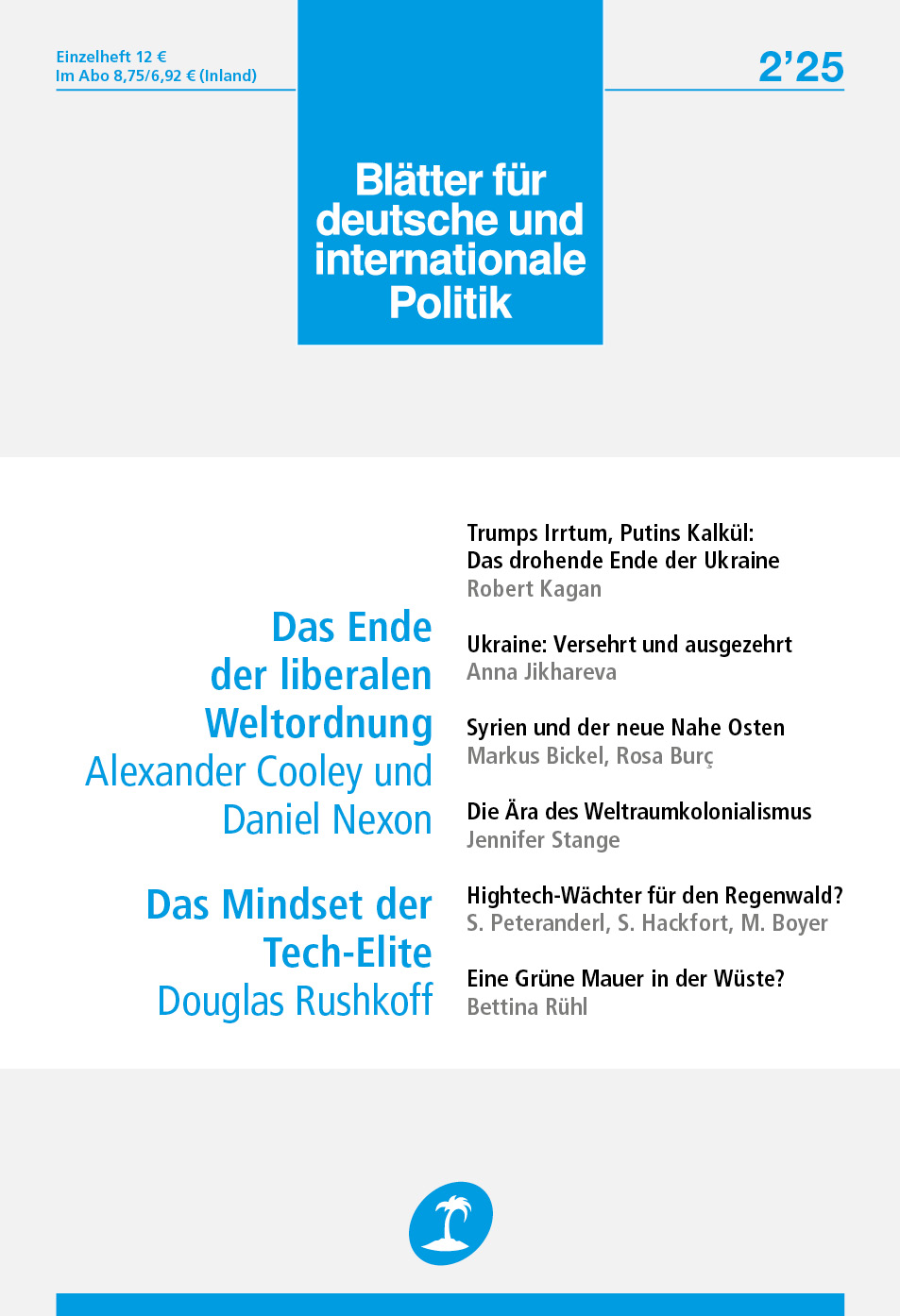Bild: Werbung für die Debatte zwischen Alice Weidel und Elon Musk auf X, 9.1.2025 (Andreas Haas / IMAGO / dieBildmanufaktur)
Einen Wahlkampf wie diesen hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Zum ersten Mal seit 1945 herrscht wieder ein großer Krieg in Europa, bei dem Russland versucht, sein Nachbarland zu annektieren. Und zum ersten Mal haben es Europa und speziell die Bundesrepublik zugleich mit Vereinigten Staaten zu tun, die sich unter einem wiedergewählten Präsidenten Donald Trump nicht als Alliierte und Freunde begreifen, sondern dezidiert als Gegner. Kurzum: Noch nie war ein Bundestagswahlkampf von derart dramatisch veränderten äußeren Faktoren bestimmt, die zugleich voll auf die Innenpolitik durchschlagen.
Bereits die ersten Ankündigungen Trumps vor seiner Inauguration, die USA bräuchten Grönland wie auch den Panamakanal für ihre „wirtschaftliche Sicherheit“, und um diese Ziele zu erreichen, würde er weder wirtschaftlichen Druck noch Militärgewalt ausschließen, brachten zum Ausdruck, dass dieser Präsident nicht „nur“ den Multilateralismus (raus aus WHO und dem Pariser Klimaabkommen) und die Transatlantische Partnerschaft fundamental infrage stellt, sondern im schlimmsten Fall auch die Unantastbarkeit der Grenzen. Man kann von einer Strategie des „Shock and awe“ sprechen, um durch Schock Furcht einzuflößen und so am Ende maximale Vorteile für die USA zu erzielen.
Exemplarisch dafür ist der Fall Grönlands, völkerrechtlich ein autonomer Teil Dänemarks. Jahrzehntelang war Dänemark einer der engsten europäischen US-Verbündeten in Europa, ja sogar Teilnehmer am völkerrechtswidrigen Irakkrieg 2003. Doch die Gründe hinter dieser ersten, zunächst nur rhetorischen Eskalation Trumps liegen auf der Hand: Laut der grönländischen Ministerin für Handel und Rohstoffe, Naaja H. Nathanielsen, verfügt ihr Land über 39 der 50 Mineralien, die von den USA „als kritisch für die nationale Sicherheit und die wirtschaftliche Stabilität“ eingestuft würden. Doch während Kanada und Großbritannien jeweils 23 Bergbaulizenzen in Grönland besäßen, hätten die USA nur eine einzige, so Nathanielsen, um besänftigend hinzuzufügen: „Ich bin mir sicher, dass sich dieses Bild ändern kann.“[1]
Hier zeigt sich die Maxime Trumps: Seine bloßen Drohungen zeitigten bereits Wirkung, bevor er überhaupt sein Amt angetreten hatte. Vor allem aber zeigen sich hier erhebliche Ähnlichkeiten, ja eine strukturelle Verwandtschaft im Agieren von Trump und Wladimir Putin: Beide stehen außenpolitisch für eine in Einflusszonen und Großräumen denkende Machtpolitik, die auf maximale, notfalls sogar militärische Disruption setzt, und innenpolitisch für die Förderung antidemokratischer, oligarchischer Strukturen, die jeglicher politischer oder medialer Kontrolle enthoben sind – bei Trumps Inauguration verkörpert durch die ihn umringenden Tech-Milliardäre und den eigenen Familienclan.
„Heute bildet sich in Amerika eine Oligarchie mit extremem Reichtum, Macht und Einfluss heraus, die buchstäblich unsere gesamte Demokratie bedroht“, lauteten denn auch die warnenden Abschiedsworte von Trumps Vorgänger Joe Biden. Ganz offensichtlich will sich Trump innen- wie außenpolitisch möglichst von jeglicher Bindung an Recht und Gesetz befreien, um so maximalen Bewegungsspielraum zu erlangen, ganz wie seine totalitären Gegen- oder – genauer gesagt – Mitspieler. Denn wie im Falle von Putin oder Xi Jinping handelt es sich auch bei Trump zweifellos um einen Antidemokraten, wie sein Verhalten nach der verlorenen Wahl 2020 bewiesen hat.
Das bedeutet aus deutscher Sicht allerdings keineswegs, dass es keinen Unterschied mehr gäbe zwischen dem russischen Präsidenten, der längst den „kollektiven Westen“ ausdrücklich als seinen Feind begreift und gegen die Staaten der EU einen hybriden Krieg führt, und dem amerikanischen, dessen jeweilige Position nur einem Maßstab unterliegt: Allein „America first“ werde seine Devise sein, so Trumps Leitsatz bei seiner zweiten Amtseinführung, keiner werde länger auf Kosten Amerikas leben und es gehe nicht mehr um die Verteidigung fremder Grenzen, sondern nur noch um den Schutz der eigenen Angelegenheiten. Für Europa, die Ukraine und nicht zuletzt für Deutschland als Exportnation müssen diese Sätze zwar wie eine Drohung klingen, aber zugleich demonstrieren sie, dass Trump ganz generell jeden anderen Staat als Gegner begreift und folglich seine Haltung zu bestehenden Partnerschaften, etwa der Nato, immer und ausschließlich von nationalen oder gar individual-egoistischen, allein auf den Vorteil des Trump-Clans gerichteten Nützlichkeitserwägungen abhängig machen wird.
Diese rein nationalistische Nutzenmaximierung, die keine gewachsenen Allianzen mehr kennt, schlägt auch in der deutschen Innenpolitik voll durch: War bisher die Union der klassische Verbündete der US-Republikaner, richten sich Trumps Begehrlichkeiten und Erwartungen jetzt auf die AfD, als natürlicher Partner bei der Aushebelung einer regelbasierten Ordnung.
Chrupalla statt Merz
Symptomatisch dafür war, dass nicht der CDU-Chef und wahrscheinliche künftige Bundeskanzler Friedrich Merz zu Trumps Inaugurationsfeier eingeladen war, sondern ausgerechnet AfD-Chef Tino Chrupalla, der für den Pro-Putin-Kurs der AfD steht und noch vor zwei Jahren den Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in der russischen Botschaft in Berlin begangen hatte.[2] Nun feierte er mit den libertären Staats- und rechtsradikalen Demokratieverächtern Javier Milei (Argentinien), Giorgia Meloni (Italien), Nigel Farage (Großbritannien), Éric Zemmour (Frankreich) und Gianni Infantino (FIFA). Gestern Putin, heute Trump, doch die antidemokratische Grundhaltung der AfD bleibt sich gleich.
Dabei hatte zu Beginn des Wahlkampfs noch Christian Lindner um die Zuneigung des US-amerikanischen Disruptors gebuhlt, mit seiner Forderung, man solle „mehr Milei oder Musk wagen“. Der große Fehler speziell der Neoliberalen, aber auch der Konservativen besteht jedoch darin, dass sie in den vergangenen Jahren den Staat im Allgemeinen – und im Falle der Lindner-FDP die Ampelregierung im Speziellen – derart verächtlich gemacht haben, dass sie den radikalen Libertären auch in Deutschland den Boden bereitet und so der AfD in die Hände gespielt haben. Indem die FDP im Einklang mit den Springer-Medien die Grünen als Verkörperung des „tiefen Staates“ dämonisierte, der bis in den eigenen Heizungskeller hineinregiere, wurde sie am Ende zum Opfer ihrer eigenen Strategie. Aus staats- und bürokratiekritischem Liberalismus wurde Staatsverachtung und aus dem Ruf nach der „Heckenschere“ (Lindner) die Forderung nach der „Kettensäge“ (Weidel nach Milei). Insofern ist es kein Zufall, dass sich Trumps „first buddy“ Elon Musk trotz Lindners Liebedienerei gar nicht mit der FDP aufhielt, sondern gleich bei der AfD gelandet ist – zur fast unbändigen Freude von deren Spitzenkandidatin Alice Weidel. Dass der reichste Mann der Welt und Trump-Intimus sich in Springers „Welt“ offen für die AfD aussprach und Weidel persönlich ein einstündiges Gespräch auf seiner eigenen Plattform X einräumte, war für die AfD offensichtlich das Startsignal, um im Wahlkampf alle rhetorischen Hemmungen fallen zu lassen.
Zur Erinnerung: Noch vor einem Jahr hatte es nach den großen Protestdemonstrationen im Gefolge des Potsdamer Geheimtreffens, bei dem der österreichische Identitäre Martin Sellner in Anwesenheit von AfD- (und CDU-)Politikern seine Remigrationspläne vorstellte, erhebliche Diskussionen in der AfD über den zukünftigen Kurs der Partei gegeben. Nachdem sich selbst Marine Le Pen von der AfD abgesetzt und die europäische Zusammenarbeit mit ihr aufgekündigt hatte, verstieg sich der eigentliche Scharfmacher und rechte Parteiideologe Björn Höcke sogar zu der absurden Position, mit Remigration habe man nur das Zurückholen von aus Deutschland Ausgewanderten gemeint. Jetzt hingegen, mit dem Rückenwind von Elon Musk, benutzte Weidel bei ihrer Kür zur Spitzenkandidatin ganz offensiv den rechtsradikalen Begriff für das Ziel massenhafter Abschiebung und Ausbürgerung: „Dann heißt das eben Remigration!“ Und das ist nur eine von zahlreichen Positionen, bei denen die Partei inzwischen offen mit dem Rechtsradikalismus kokettiert, vom Wahl-Slogan „Alice für Deutschland“, angelehnt an die verbotene SA-Parole „Alles für Deutschland“, bis zur Verdammung der „Windmühlen der Schande“ in Anspielung auf Höckes „Denkmal der Schande“ (für das Berliner Holocaust-Denkmal).[3] Obwohl die AfD mit derartigen Äußerungen einem Verbotsverfahren zweifellos näher rückt, zeigt sie doch zugleich, wie wenig sie sich davor fürchtet. Im Gegenteil: Speziell Weidel gibt sich radikal im Wissen darum, dass es ihr nicht schadet. Denn so sehr sich die AfD radikalisiert, so wenig erleidet sie dabei Verluste, sondern wächst unvermindert weiter. Mittlerweile liegt sie in den Umfragen bei über 20 Prozent und fast alles spricht dafür, dass sie am 23. Februar als zweitstärkste Kraft und damit als Oppositionsführerin in den Bundestag einziehen wird.
Vor diesem Hintergrund ist derzeit in der Partei keine Rede mehr davon, sich zu mäßigen oder gar zu „entdämonisieren“ (Le Pen). Statt einer Annäherung an Giorgia Meloni im Sinne einer partiellen, speziell außenpolitischen Normalisierung, sprich: Westbindung im traditionellen Sinne, geht man den österreichischen Weg der Radikalisierung. Angesichts der Erfolge von Trump, Kickl und Orbán begreift die AfD sich als Teil einer rechtsradikalen Welle, die sie, so ihre Überzeugung, über kurz oder lang auch in Deutschland an die Macht spülen wird, vielleicht schon 2029, aber spätestens 2033.
Kannibalisierung der Demokraten
Die anderen Parteien setzen der Radikalität der AfD kaum etwas entgegen. Das ist der Kern des AfD-Momentums in diesem Wahlkampf: Anstatt die Rechtsradikalen offensiv zu attackieren und ihre eklatanten Widersprüche aufzudecken, drohen die demokratischen Parteien sich aus eigener Schwäche selbst weiter zu kannibalisieren. Aufgrund des kläglichen Endes der Ampel kämpfen – auch das eine historische Novität – mit Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner drei Spitzenkandidaten gegeneinander, deren Koalition soeben erst fundamental gescheitert ist. Zugleich verfügt auch die Union mit Friedrich Merz über einen Kandidaten, der wie seine Kontrahenten ausgesprochen schwache Zustimmungswerte aufweist. Hinzu kommt ein weiteres Spezifikum dieser Wahl: Gerade weil diesmal so viele Parteien in den Bundestag einziehen könnten wie seit Beginn der Republik nicht mehr, sind die Koalitionsoptionen minimal. Die AfD scheidet schon aufgrund ihres Extremismus als potenzieller Koalitionspartner aus (genau wie auf Bundesebene aufgrund seiner außenpolitischen Orientierung das Bündnis Sahra Wagenknecht), wenn denn die Union nicht massenhafte Proteste auch in den eigenen Reihen riskieren will. Dem von der FDP propagierten schwarz-gelben Bündnis fehlt es hingegen, so denn die Liberalen überhaupt den Sprung über die Fünfprozenthürde schaffen, in jedem Fall an der erforderlichen Mehrheit. Bleiben letztlich nur zwei denkbare Optionen: Eine Koalition der Union mit den Grünen und vor allem die Wiederauflage der „großen Koalition“.
Die Ironie der Geschichte: Nach dem Ampel-Desaster zeigen die Wählerumfragen, dass die Bevölkerung am ehesten das herbeisehnt, was sie noch vor drei Jahren vehement abgelehnt hat, nämlich eine Koalition aus Union und SPD. Stabilität und Sicherheit lautet in Zeiten der Disruption das Bedürfnis der Stunde. Ob es allerdings noch einmal für die große Koalition reicht, ist völlig offen. Der SPD, unter der Nicht-Führung von Olaf Scholz von der vormaligen Volkspartei endgültig zu einer bloßen Ergänzungspartei geschrumpft, droht auch im Bund ein Ergebnis von klar unter 20 Prozent, wie es in vielen Bundesländern bereits der Fall ist. Zugleich könnte die Union unter 30 Prozent bleiben, was für Merz ebenfalls desaströs wäre und eine große Koalition verunmöglichen könnte.
Vor allem die Merz-CDU steckt damit in der Falle der Kannibalisierung. Von links versucht Scholz angesichts der eigenen miserablen Werte Merz als den Kandidaten der sozialen Kälte und der kriegerischen Eskalation darzustellen, genau wie Gerhard Schröder Angela Merkel im Wahlkampf 2005. Doch als wäre das für Merz nicht fatal genug, hat er es auf der rechten Seite mit einem weiteren Disruptor der deutschen Politik zu tun, nämlich mit seinem Parteifreund Markus Söder. Dieser treibt die Merz-Union von rechts vor sich her, attackiert sie ständig als zu lasch – und schließt, allein an den eigenen Werten in Bayern interessiert, vor allem jegliche Koalition mit den Grünen kategorisch aus. Während die Union also mit der Migration vor allem das Kernthema der AfD bespielt und sie damit beileibe nicht schwächt, heißt es gegenüber den Grünen wieder „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“, ganz wie zu Beginn der grünen Parlamentsgeschichte.
Abgesehen davon, dass die Negierung des ökologischen Jahrhundertthemas angesichts der jüngsten Brände in Kalifornien politisch völlig aberwitzig erscheint, könnte dies fatale Konsequenzen für die zukünftige Regierungsbildung haben: Sollte es am Ende für eine große Koalition nicht reichen, würde sich am 23. Februar die Verengung des Koalitionsspektrums durch die „Ausschließeritis“ eines Markus Söder brutal rächen. Denn dann wären die Grünen plötzlich wieder gefragt und niemand würde sich angesichts dieses Umfallens der Union mehr über die willkommene Munition für die Wahlkämpfe der nächsten Jahre freuen als die AfD. Damit aber führte die verheerende Verteufelung der Grünen zu einer neuerlichen direkten Stärkung der Rechtsradikalen – und zu einer massiven Hypothek für die kommende Regierung.
* Der Text ist vor Drucklegung am 22.1.2025 entstanden.
[1] „Süddeutsche Zeitung“, 17.1.2025.
[2] Allerdings handelte es sich dabei eher um eine Einladung zweiter Wahl, die am Ende nicht zum Eintritt ins Kapitol, sondern lediglich in die Capital-One-Arena berechtigte.
[3] Dass Weidel Hitler zum Linken und Kommunisten umetikettierte, um rechtes Denken zu exkulpieren, war dagegen eine schon fast satirisch anmutende Geschichtsklitterung.