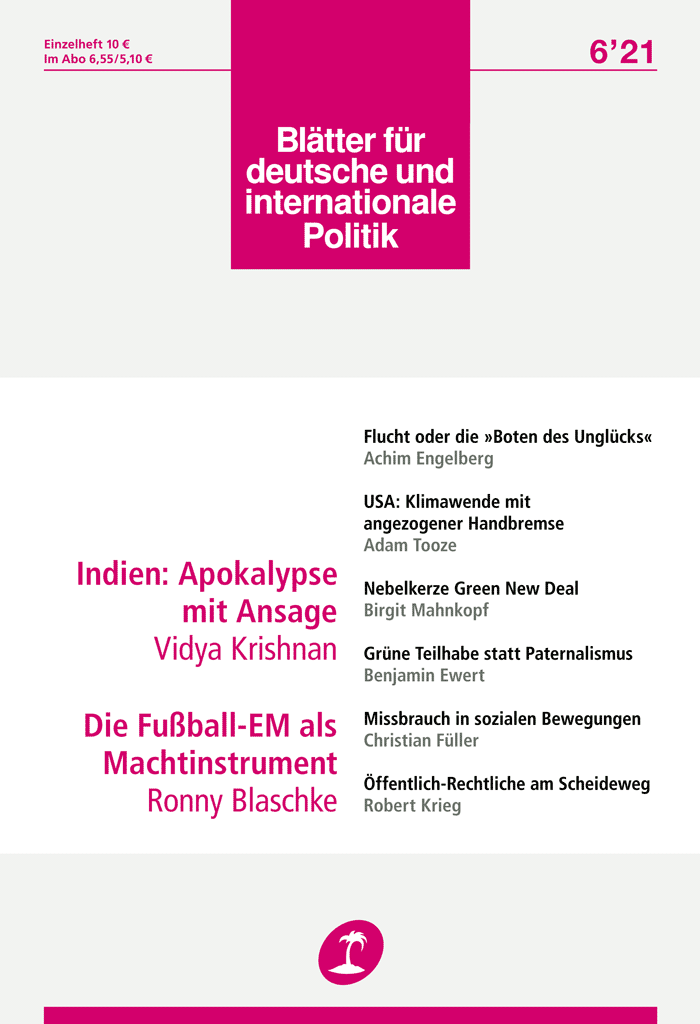Die leeren Versprechungen eines »grünen Kapitalismus«

Bild: Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, während einer Pressekonferenz zum Europäischen Green Deal in Brüssel, 11. Dezember 2019 (IMAGO / Xinhua)
Wer politisch ernst genommen werden will, muss heute Wunder versprechen. Der Trick kann gelingen, wenn vielstimmig das Lied von der nahen „Klimaneutralität“ kapitalistischer Industriegesellschaften gesungen wird. Bei aller ernsten Sorge um den Zustand unseres Planeten obsiegt die Hoffnung, dass das Weltsystem des Kapitalismus – das zugleich eine Weltökologie hervorgebracht hat – gestärkt, verjüngt und von Grund auf erneuert aus jenen chaotischen Prozessen hervorgehen möge, die seine Ausdehnung bis in die entlegensten Winkel der Erde nach wenig mehr als drei Jahrhunderten ausgelöst hat.
Das Lied von der „Klimaneutralität“ zukünftiger und unbedingt „moderner“ Industriegesellschaften beginnt stets mit dem Versprechen einer gewaltigen und blitzschnellen Reduktion von CO2-Eintragungen in die Atmosphäre – und häufig endet es damit auch.[1] Die EU will dieses Ziel mit ihrem „Green New Deal“ spätestens zur Jahrhundertmitte erreicht haben. China will dies ebenso, nur ein bisschen später, und US-Präsident Joe Biden wird allein schon dafür gefeiert, dass er sich auch auf ein solches Versprechen festgelegt hat. Kleinlich wirkt es da, wenn auf unterschiedliche Bezugsjahre (die frühen 1990er oder erst die Mitte der 2000er Jahre) und Zielgrößen (eine 50prozentige oder gar 100prozentige Senkung der Emissionen gegenüber dem jeweils gewählten Bezugsjahr) verwiesen wird. Und wer auf die komplexen Zusammenhänge der bio-physischen Sphäre hinweist, die allein durch eine Reduktion des CO2-Eintrags in die Atmosphäre nicht in die Balance zu bringen sind, wird als Störenfried des neuen „grünen Konsens“ gesehen.
Aber mit solchen Versprechen werden Wahlen bestritten. Es kümmert die regierenden Koalitionäre der Bundesregierung vermutlich nicht, dass sie nicht für ihr heutiges Versprechen geradestehen müssen, Deutschland in gerade einmal 24 Jahren „treibhausgasneutral“ zu machen. Fünf Jahre früher als von der EU versprochen. Es fragen ja nur wenige Wähler nach, was denn mit dem Begriff der „Klimaneutralität“ genau gemeint ist, nämlich, dass von 2045 an die von Menschen erzeugten Emissionen nicht höher ausfallen, als sie sich wieder binden lassen. Vor allem wird nicht nachgefragt, wie diese Bindung vonstattengehen soll und wie sich die Zielsetzung mit dem ebenfalls versprochenen Wachstum von Wirtschaft, Infrastruktur und Arbeitsplätzen verträgt.
Hierzulande kommt das wundersame Versprechen der „Klimaneutralität“ nie ohne eine zweite Verdummungsmetapher aus – die der „Digitalisierung“. Ohne sie scheint es keine Zukunft, für wen und was auch immer, zu geben. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch: Mit den derzeit anvisierten politischen Maßnahmen zur „Dekarbonisierung“[2] und „Digitalisierung“ in Europa (sowie in anderen Industrieländern einschließlich China) soll die ins Stocken geratene Akkumulationsdynamik des Industriekapitalismus neuen Schwung erhalten, jetzt über den Weg seiner „Begrünung“. Doch ein „grüner Kapitalismus“ kann keine Entschärfung der ökologischen Krise bewirken, ist diese doch aufs Engste mit dem modernen Industriekapitalismus verwoben, so dass sie sich – wenn überhaupt – nur zusammen mit diesem einer (Auf-)Lösung zuführen lässt.
Das grüne Narrativ
Das grüne Narrativ stellt in Aussicht, dass ein „grünes Wachstum“ mit einer Kombination aus intelligenter makroökonomischer Politik, technologischem Fortschritt und den Marktmechanismen erzielt werden könnte. Ein solches Wachstum werde die Umwelt nicht weiter zerstören und mit weniger Primärressourcen auskommen, aber auch in Zukunft den kapitalistischen Kreislauf erhalten: die Mehrung privaten Eigentums, die Steigerung von Renditen in der Finanzwirtschaft, das Schaffen von mehr Arbeitsplätzen und Lohneinkommen, damit die wachsende Menge an Waren auch konsumiert werden kann, sowie steigende Steuereinnahmen für den Staat. Dieser Weg basiert auf einigen Grundannahmen. Es müssen erstens die unvermeidbaren Externalitäten[3] von wirtschaftlichen Tätigkeiten mit einem Geldausdruck belegt werden, also einen Preis erhalten. Unter dieser Voraussetzung sollen die Märkte ihr Zauberwerk vollbringen und unendliches Wachstum befördern.
Zweitens muss dafür Sorge getragen werden, dass der Staat funktionsfähig bleibt, um Märkte zu schaffen, auszuweiten und unvermeidliches Marktversagen zu kompensieren. Gegenwärtig setzt das voraus, dass nach den „braun-fossilen“ nun vermehrt „grün-ökologische“ Felder für den Privatsektor erschlossen werden.
Hinzu kommt die nahezu abstruse Annahme, dass im „grünen Kapitalismus“ drittens expansives ökonomisches Handeln nicht nur niedrigere CO2-Emissionen nach sich zieht, sondern zugleich eine „Entmaterialisierung der Produktion“ in Gang setzen könnte. So als ließen sich – mit physikalischen Gesetzen wenig vereinbar – Brücken mit deutlich weniger oder gar keinem Zement und Stahl bauen oder als funktionierte die digitale Ökonomie allein auf der Basis von frei verfügbaren Informationen, ohne Energiezufuhr und ihre stofflichen Komponenten. Dass es sich dabei um eine große Mogelpackung handelt, zeigt sich mit Blick auf den „European Green Deal“ (EGD).
Mit Wettbewerb zur grünen Union?
Seit Verabschiedung der Lissabon-Strategie im Jahr 2000, die zehn Jahre später als EU-2020-Agenda eine Neuauflage erlebte, sollte die Integration von Energie- und Umweltpolitik und der Ausbau der Kapazitäten für die Erzeugung von erneuerbarer Energie einen kräftigen Schub für „Wachstum und Jobs“ auslösen. Im Sinne eines strikten Kosten-Nutzen-Kalküls, das die Umweltpolitik in die neoliberale Agenda einbinden wollte, gilt Wettbewerb dabei als effiziente Methode, um umweltpolitisch relevante technologische Innovationen zu befördern. Gleichzeitig wird das Konzept der technologischen Neutralität verfolgt. Demzufolge sollten alle „low-carbon technologies“ gleichermaßen gefördert werden; eine Vorzugsbehandlung der Technologien zur Erzeugung erneuerbarer Energie wurde bewusst ausgeschlossen. Gleichzeitig konnten sich energieintensive Industriebranchen weiterhin öffentlicher Unterstützung erfreuen. Die Begründung: Die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen auf internationalen Märkten dürfe durch eine „ambitionierte Umwelt- und Energiepolitik“ sowie durch hohe Energiekosten nicht gefährdet werden.[4]
„Grüne Investitionen“, vornehmlich verstanden als Ausbau von erneuerbarer Energie im Stromsektor, gelten in der EU somit schon seit vielen Jahren als eine erfolgversprechende Strategie zur Steigerung ökonomischen Wachstums. Sie sollen Wettbewerbsvorteile für EU-basierte Unternehmen in energie- und ressourcenintensiven Branchen durch mehr oder weniger freiwillige Dekarbonisierung sichern und ausbauen. Unterstützt wurde diese Politik durch marktbasierte Anreizsysteme.
Doch können nur Zyniker die EU-2020-Strategie als einen Erfolg bezeichnen: Dass der Emissionsausstoß in den zurückliegenden drei Jahrzehnten seit 1990 um etwa 24 Prozent reduziert wurde, ist nur teilweise auf jene technologischen Fortschritte zurückzuführen, die die Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie deutlich verbilligt haben. Wichtiger war das „größte De-Industrialisierungsprogramm“ im 20. Jahrhundert: die sogenannte „Transformation“ in Ost- und Mitteleuropa seit 1989/90. Wenn nun ab 2020 die Emissionen in der EU – wie in anderen industrialisierten Ländern auch – sehr viel drastischer gesenkt werden sollen, darf mit einer weiteren „List der Geschichte“ wohl nicht gerechnet werden.
Ein anderes wichtiges Ziel der EU-2020-Strategie besteht darin, den Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix deutlich zu erhöhen. Das ist in einigen EU-Mitgliedstaaten auch gelungen, hat jedoch vergleichsweise wenig beim Anteil der erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch aller Wirtschaftssektoren verändert. Im einstigen Vorreiterland Deutschland beträgt dieser heute gerade einmal 17 Prozent, wobei die Hälfte davon auf Biomasse, ein Viertel auf Wind und nur ein Zehntel auf Solarenergie entfällt. Europaweit wurde die Förderung von erneuerbarer Energie schlichtweg vom insgesamt gestiegenen Energieverbrauch aufgezehrt.
Vor dem Hintergrund dieser vermeintlichen Erfolge der EU, die einst als role model für eine kluge Integration von Energie- und Umweltpolitik gelobt wurde, ist absehbar, dass sich auch der European Green Deal der neuen Europäischen Kommission schon im Jahr 2030 als Mogelpackung erweisen wird.
Mit diesem Plan soll CO2-Neutralität bis 2050 erreicht und gleichzeitig eine Wiederbelebung der europäischen Wirtschaft in Gang gesetzt werden. Demnach müssten die Emissionen in den vor uns liegenden knapp drei Jahrzehnten gleich um 75 Prozent gesenkt werden – und dies ohne Hilfe großräumiger Deindustrialisierung in einem Teil Europas!
Der Fokus des European Green Deal liegt nahezu ausschließlich auf Maßnahmen, die helfen sollen, den Ausstoß eines der Treibhausgase zu senken, indem vor allem fossile Brennstoffe durch Strom aus anderen Energiequellen substituiert werden. Der mehr als kritische Zustand der Ökosysteme spielt im avisierten Maßnahmenbündel des EGD eine eher marginale Rolle.
Dass unser Wirtschafts- und Sozialsystem von exosomatischen – also nicht-menschlichen – Energie-Inputs abhängig ist, gilt als unbestrittene und notwendige Existenzvoraussetzung kapitalistischer Industriegesellschaften. Zur Fortführung dieses Gesellschaftssystems bleibt der Green New Deal auf technologische Innovationen fokussiert; mit ihrer Hilfe sollen Energiequellen erschlossen werden, die alle Möglichkeiten, die uns bislang durch die fossilen Ressourcen eröffnet wurden, nicht nur in gleichem, sondern in wachsendem Umfang garantieren.
Doch muss das Versprechen der Klimaneutralität bis 2050 eher als eine Beruhigungspille denn als couragiertes politisches Projekt verstanden werden. Faktisch gibt es bei einer Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten keine Bereitschaft zu einem wirklichen Politikwechsel: So ist etwa die Abschaffung der staatlichen Subventionen für Kohle, Öl und Gas erst ab 2025 geplant. Wann der Export von Fördertechnik für fossile Brennstoffe nicht mehr länger staatlich subventioniert wird (was insbesondere die deutsche und französische Exportwirtschaft treffen würde), steht in den Sternen. Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten ist noch nicht einmal bereit, Verkehr, Gebäudesektor und Landwirtschaft, auf die 60 Prozent der CO2-Emissionen entfallen, in den Emissionshandel einzubeziehen. Im Rahmen des EGD ist auch nicht beabsichtigt, dass die Mitgliedstaaten Flughafen- und Straßenprojekte einfrieren. Angekündigt ist lediglich, dass die European Investment Bank ab 2022 die Investitionen in Flugverkehr strenger regulieren wird, wohl aber weitere Straßenprojekte fördert.
Dass es in den nächsten Jahren tatsächlich zu einem Schub bei der angekündigten Kreislaufwirtschaft in der EU kommen wird, in der Materialien und Produkte so lange wie möglich repariert und recycelt werden, ist ebenfalls unwahrscheinlich.[5]
Verfehlte Landwirtschaftspolitik
Ein weiteres wichtiges Element des neuen Sterns am politischen Himmel ist die Farm-to-Fork-Strategie, die eng mit der seit Jahren überfälligen Reform der Common Agricultural Policy (CAP) verwoben ist. Mittels dieser soll eine nachhaltige und zugleich ökonomisch tragfähige Land- und Ernährungswirtschaft aufgebaut werden.
Fraglos braucht es für eine Reduktion der CO2-Emissionen mehr Kohlenstoffsenken, also intakte Wälder, Wiesen und Feuchtgebiete. Doch in Europa wie auch in vielen anderen Regionen der Welt befinden sich diese mehrheitlich in einem katastrophalen Zustand. Nur 15 Prozent aller Habitate gelten der European Environment Agency (EEA) zufolge als gut erhalten. Um einem weiteren Verlust an Biodiversität entgegenzusteuern, müssten daher mehr Landflächen menschlicher Nutzung entzogen und große Flächen wieder aufgeforstet werden. Das ist seit Jahren bekannt. Doch um diese Ziele erreichen zu können, hätten mindestens 70 Prozent der EU-Agrarsubventionen, die 40 bis 45 Prozent des gesamten EU-Budget ausmachen, darauf ausgerichtet werden müssen. Dafür gibt es aber keinen Konsens, also gelten bis 2022 die alten Regeln. Die CAP ist eine teure und kontraproduktive Angelegenheit – so sehen es auch Teile der Business Community. Denn in dem Maße, in dem Naturräume schrumpfen, werden deren Leistungen systematisch erfasst und als biological and ecological services (BES) von Ökosystemen monetär bewertet und gehandelt. Daher haben Versicherungskonzerne wie Swiss Re ihr Geschäftsfeld erweitert und kalkulieren nun auf Dollarbasis, in welchem Umfang diese „Dienstleistungen“ zum jeweiligen nationalen Bruttoinlandsprodukt eines Landes beitragen. Umgekehrt werden Beeinträchtigungen dieser Geldwertschaffenden Funktion von Ökosystemen als lost assets betrachtet. Unternehmen und Umweltschützer sind deshalb aufgefordert zusammenzuarbeiten, um den Beitragswert der Natur (die benefits) in ihre Operationen und ihre Kultur zu integrieren. Genau das scheint aber im Fall der EU nicht zu funktionieren.
Andere Nutzungsformen von Land werfen nämlich mehr Profit ab. Böden sind inzwischen weltweit zu einem Spekulationsobjekt geworden. Sie müssen als eine Art Parkplatz für akkumuliertes Kapital herhalten, das sich anderweitig nicht rentabel anlegen lässt. In der Erwartung kurzfristiger Gewinne werden dabei nicht nur fruchtbare Agrarböden in Rumänien, sondern auch weit weniger ertragreiche in Deutschland und anderswo von renditehungrigen Investoren aus dem In- und Ausland erworben. Denen geht es nicht primär um eine landwirtschaftliche Nutzung. Doch ihre Nachfrage macht es für landwirtschaftliche Betriebe immer teurer, Land zu pachten, derweil die Preise, die sie für ihre Produkte von Nahrungsmittelindustrie und -handel erhalten, kaum mehr ausreichen, um die Produktionskosten zu decken.
Somit lastet das ganze Gewicht des vollmundigen Versprechens der EU auf technologischen Lösungen zur Energiefrage – genauer: auf der als Dekarbonisierung beschriebenen Elektrifizierung von Verkehr, Wärmeerzeugung und Industrieproduktion sowie auf der Digitalisierung von nahezu sämtlichen gesellschaftlichen und ökonomischen Aktivitäten.
Dekarbonisierung und Digitalisierung – Königswege aus der Krise?
Mit den Schlagworten „Dekarbonisierung“ und „Digitalisierung“ werden in der EU zwei Gleise eines Entwicklungspfades benannt, der nur eine Richtung kennt: Denn auch ein „grün“ getöntes Wirtschaftsmodell basiert, wie das „braun-fossile“ der vergangenen dreihundert Jahre, auf unendlicher Akkumulation von Kapital. Die Eigenart dieses Systems besteht bekanntlich darin, dass es nicht nur auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln und der eigentumslosen Lohnarbeit, sondern auch auf der Trennung von Ökonomie und Politik beruht und von selbstreferenziellen Märkten gesteuert wird. Hinzu kommt, dass Geld in seiner Form als Kredit immer einen Überschuss erwirtschaften muss. Die Ausweitung der Produktion über alle Bedarfe ist also endemisch, und sie gründet auf einem systembedingten und zugleich destruktiven Verhältnis sowohl hinsichtlich der menschlichen als auch der außermenschlichen Natur. Die nicht durch Arbeit erzeugbaren „Geschenke der Natur“ – die Marx zufolge niemandem gehören, keiner Person, keinem Staat und noch nicht einmal der Menschheit als ganzer – werden bearbeitet, stofflich und energetisch transformiert, ökonomisch verwertet und dabei immer stärker verstreut und schließlich irreversibel zerstört.
Um die Aufrechterhaltung dieses die Natur zerstörenden Systems geht es auch beim aktuellen Dekarbonisierungs- und Digitalisierungshype. Es bleibt bei dem Versprechen unendlichen Wachstums einer im materialen Sinne endlichen Welt. Die Fixierung auf wissenschaftlich-technischen Fortschritt als Motor gesellschaftlicher Entwicklung spielt dabei eine zentrale Rolle. Denn seit der Zeit der Aufklärung und mehr noch seit der Industriellen Revolution in England suggeriert das nahezu grenzenlose Vertrauen in Wissenschaft und Technik, dass die Menschen sich durch immer neue technologische Lösungen für alle möglichen Probleme aus den Zwängen einer endlichen Welt befreien könnten.
Nun haben sich aber nicht allein die politischen Entscheidungsträger in der EU auf Dekarbonisierung und Digitalisierung als die Königspfade festgelegt. Selbst China, der Big Player im digitalen Kapitalismus des 21. Jahrhunderts, hat in seinem neuen Fünfjahresplan in Aussicht gestellt, das „Null Emissionen“-Ziel bis 2060 erreichen zu wollen. Aus guten Gründen wird vermutet, dass es dem „strategischen Wettbewerber“ dabei in erster Linie darum geht, beim nächsten Digitalisierungsschub die Nase vorn zu haben. Seine kohlenstoffintensiven Produktionsbereiche der Schwerindustrie könnte China dagegen mittelfristig womöglich in die Staaten entlang der Belt-and-Road-Initiative auslagern. Die dadurch verursachten Emissionen müsste China sich dann eben so wenig anrechnen lassen, wie es heute die EU bei ihren Importen von Industriegütern tut, deren Produktion in China mit hohen Emissionen verbunden ist.
Hinzu kommt, dass sich das Mantra der „CO2-Neutralität“, das bestenfalls um ein paar Lippenbekenntnisse zur Rettung der schrumpfenden Biodiversität ergänzt wird, auf eine zentrale Heilsbotschaft stützt: die Elektrifizierung und Digitalisierung von möglichst vielen industriellen Produktionsprozessen und Dienstleistungen aller Art, vor allem aber von Mobilität. Wobei die Elektrifizierung ebenso wie die Digitalisierung selbstverständlich schnellstmöglich sauber, wahlweise „grün“ oder nachhaltig sein soll.
Mit Hilfe eines neuen industriellen Zyklus, der durch staatliche Industriepolitik (in China ebenso wie in Japan, Südkorea, in Deutschland oder Frankreich) befördert wird, soll die Rohstoffbasis des industriekapitalistischen Entwicklungspfades erneuert werden. Dies geschieht aber nicht anstelle, sondern in Ergänzung zur Ausbeutung und klimaschädlichen Verbrennung von fossilen Rohstoffen. Ihr Anteil am Primärenergieverbrauch mag in längerer Frist zurückgehen, doch verändert dies wenig, wenn die Gesamtgröße gleichzeitig weiter steigt. Wenn die fossilen Energien im Vergleich zu technisch aufwendig zu erschließenden alternativen Energiequellen sich als kostengünstiger erweisen, werden fossile Rohstoffe auch morgen weiter verbrannt werden.
Das fantastische Szenario der Klimaneutralität
Gegenüber dem green brainwashing, das in der Politik und den Medien in der EU dominiert, zeichnen sich die datengestützten Szenarien der International Energy Agency durch einen nüchternen Realismus aus: Wenn tatsächlich in allen Ländern, in denen derzeit Absichtserklärungen vorliegen oder sogar Gesetzesvorlagen vorbereitet sind, um das „Null Emission“-Ziel bis 2050 zu erreichen, auch entsprechende Investitionen in den Ausbau der dafür nötigen Infrastruktur vorgenommen würden, müsste sich der Energieverbrauch im Zeitraum von 2010 bis 2030 fast halbieren. Neun Jahre vor Erreichen dieser Zielmarke aber wird vor allem in den reichen Industrieländern mit allen verfügbaren Mitteln versucht, eine Erholung der Volkswirtschaften von der Covid-19-Krise zu stimulieren.
Also müsste die Nachfrage nach Kohle rasant um fast 60 Prozent auf etwa das Niveau der 1970er Jahre sinken. Für die Kohlekraftwerke, die weiterbetrieben werden, müsste die ökologisch hochriskante und überall umstrittene Technologie des Carbon Capture and Storage zur Anwendung kommen. Gleichzeitig müsste der Anteil der erneuerbaren Energien an der globalen Elektrizitätsversorgung von 27 Prozent im Jahr 2019 auf 60 Prozent im Jahr 2030 steigen, während Kohlekraftwerke dann nur noch 6 Prozent und Atomkraftwerke 10 Prozent der Nachfrage abdecken dürften. Daraus ermittelt die IEA einen gewaltigen Anstieg des Investitionsbedarfs allein für den Ausbau des Elektrizitätssektors von 760 Mrd. US-Dollar im Jahr 2019 auf 2200 Mrd. Dollar im Jahr 2030.[6] Auch ihre Prognosen für den Verkehrs- und den Industriesektor sind geeignet, das Ziel der Klimaneutralität für gänzlich unrealisierbar zu halten: In weniger als zehn Jahren müsste die Hälfte aller Autos mit einem elektrischen Antrieb laufen, in dreißig Jahren dann alle. Wobei weder die IEA noch andere Elektromobilitätsenthusiasten sich über den Verbleib von Millionen gebrauchter Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor Gedanken machen. Diese werden wohl, genauso wie die anwachsenden Berge aus „Secondhand-Elektromüll“, in noch größeren Mengen, als dies heute geschieht, aus den USA, Europa und Japan in die armen Länder verschickt – mit den bekannten ruinösen Auswirkungen auf die Menschen und den ganzen „Rest der Natur“.
Ebenfalls schon bis 2030 müsste die Hälfte aller Industriebetriebe ihre Wärme aus Elektrizität beziehen. Das ist vor allem in den Schwerindustriebranchen Chemie, Stahl und Zement schlichtweg unmöglich. Für die Erzeugnisse dieser Branchen wird für die kommenden Jahrzehnte mit einer Verdopplung oder sogar Verdreifachung der Nachfrage gerechnet. Darüber hinaus sind die Produktionsprozesse in diesen Schlüsselbranchen ungeheuer energieintensiv, und sie lassen sich auf der Basis heute verfügbarer Technologien und zu mehr oder weniger akzeptablen Kosten nur im Rückgriff auf die energiedichten fossilen Rohstoffe erzielen. Hinzu kommt, dass Industrieanlagen dieser Branchen über einen Zeitraum von 15 bis 40 Jahren in Betrieb sind und Reinvestitionen auf einer gänzlich neuen, emissionsarmen oder gar emissionsfreien technologischen Basis heute getätigt werden müssten, wenn sie 2030 die gewünschten Effekte erzielen sollten.
Auf einen Durchbruch bei der Wasserstofftechnologie darf zwar gehofft werden. Doch wann und woher der Wasserstoff bezogen werden soll, zu welchen Kosten und unter welchen geopolitischen Konstellationen, steht derzeit in den Sternen. Weil absehbar ist, dass Energie aus erneuerbaren Quellen in der für ökonomisches Wachstum notwendigen Größenordnung nicht zur Verfügung steht, wird die Öffentlichkeit schon mit neuen Farbspielen verwirrt: Von „grünem Wasserstoff“ wird phantasiert. Angekündigt aber wird, dass Wasserstoff wohl „zunächst“ mit „grauer“ oder mit „violetter“ Energie erzeugt werden müsste – wobei „grau“ das fossile Gas und „violett“ die Atomenergie meint.
Bereits heute sind außerdem die Folgen absehbar, die mit dem Versprechen einer weitgehenden oder gar vollständigen Umstellung des Pkw- und Lkw-Verkehrs auf Elektroantriebe verknüpft sind: die weltweite Produktion von Batterien, zurzeit noch alternativlos auf Lithium-Basis, müsste sich alle zwei Jahre verdoppeln. Faktisch benötigen aber alle Technologien und Produkte, die uns net-carbon-emissions und eine Digitalisierung sichern sollen, mineralische Rohstoffe in gewaltigem Umfang. Dabei handelt es sich zu großen Teilen um Rohstoffe, die einerseits im weiteren, geopolitischen Sinne begrenzt sind, weil sie in ökonomisch relevanter Konzentration und günstiger Lage nur in einer Handvoll Ländern vorkommen. Andererseits sind sie in einem engeren, ökonomischen Sinn knapp, etwa weil die rasant steigende Nachfrage nach Batterien, Brennstoffzellen, Windturbinen, Robotern, 3-D-Druckern, GPS und Drohnen zu eklatanten Preissteigerungen führen wird. Einige Metalle, etwa das Kupfer, sind sogar schon im physischen Sinne knapp.[7] Mittlerweile gibt es zahlreiche Studien, von der Deutschen Energie- und Rohstoffagentur von EU-Institutionen, von Umwelt-NGOs und auch von US-amerikanischen Regierungsstellen, zu den critical raw materials, auf denen fast alle der sogenannten Zukunftstechnologien und damit letztlich auch das Versprechen der Klimaneutralität beruhen. Viele dieser Technologien sind sogenannte Dual-use-Technologien und damit für militärische wie zivile Zwecke gleichermaßen geeignet. Daraus aber lässt sich auch folgende Schlussfolgerung ziehen: Es wird von den critical raw materials für zivile Zwecke genau so viel übrigbleiben, wie von den Sicherheitsapparaten und den Militärs nicht beansprucht wird.
Raus aus dem Kapitalismus !?
Ungeachtet all dieser Widersprüche wird das Narrativ vom „grünen Kapitalismus“ wohl noch einige Zeit als Beruhigungsmittel seine Wirkung tun – obwohl der Pfad des fossil-atomaren Kapitalismus faktisch nicht verlassen wird. Zumal sich in Europa eine Mehrheit der Bürger damit zufriedengeben dürfte, dass doch alle Arten von „Wenden“ unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität und Ernährung in systemverträglichen Dosen eingeleitet werden – ganz gleich, ob diese die versprochene Wirkung haben.
Wer angesichts all dessen einen radikalen Wandel verlangt, manövriert sich schnell ins politische Abseits. Doch ist es unter den gegebenen Bedingungen tatsächlich redlich und klug, „ein gutes Leben für alle“ in Aussicht zu stellen? Kann im Angesicht der ökologischen Krise des Kapitalismus – die sich nach Marx als Krise im System der Gebrauchswerte der Natur bezeichnen lässt – und ihrer spiegelbildlichen Krise im System der monetären Werte tatsächlich noch mit einer kontinuierlichen Veränderung der sozialen und ökonomischen Formen gerechnet werden?
Zumal der Prozess der Herstellung eines Weltmarktes seit dem Zusammenbruch des „Realsozialismus“ in den 1990er Jahren auch die hintersten Erdenwinkel erfasst hat und damit als vollendet angesehen werden kann. Dies geht mit einer schärferen Konfrontation zwischen den Großmächten einher, vergleichbar mit dem Ende der ersten Phase der Globalisierung (1840-1914), in der das britische Empire in die Krise geriet. Damit aber werden nicht nur Aufstände, Revolten und bewaffnete Konflikte innerhalb von Staaten, sondern auch Auseinandersetzungen zwischen diesen wahrscheinlicher.
Wenn die epidemische Ausbreitung ökonomischer und sozialer Ungleichheit weit mehr Menschenleben fordert als die Ausbreitung einer Zoonose, wie Covid-19 es vermag, sind Eingriffe in die Eigentumsordnung unvermeidlich – sowie harte Konflikte mit den Profiteuren eines Systems, das keine Zukunft hat. Wenn die Klimakatastrophe noch abgewendet werden kann, dann wohl nur, wenn achtzig Prozent der fossilen Energie tatsächlich im Boden gelassen werden, wenn schädliche und auch viele unnütze Industriezweige radikal geschrumpft werden – und wenn die Finanzwirtschaft in ihre der Realwirtschaft dienende Funktion zurückgezwungen wird.
Wenn der gesamte Rohstoffverbrauch tatsächlich zurückgefahren werden soll, dann wird es ohne erhebliche Einschränkungen bei der Mobilität wohl nicht gehen. Das bedeutet auch, dass kritische Metalle nicht in kurzer Zeit für E-Mobilität und digitale Produkte und Dienstleistungen unter extrem umweltschädlichen Bedingungen aus der Erde gekratzt werden dürfen, um am Ende ihres Konsums als Giftmüll zu enden. Dann wird wohl eher mehr und nicht weniger physische Arbeit notwendig sein – und dies nicht allein in allen Bereichen der personennahen Dienstleistungen, sondern vor allem beim Wiedernutzen, Umrüsten, Reparieren und beim Recycling der endlichen Materialien, die in den vergangenen Jahrzehnten aus der Erdkruste herausgebrochen, zerlegt, verbrannt und umgeformt wurden.
Wenn soziale Ungleichheit durch Umverteilung reduziert werden soll, dann wird dies gewiss nicht nur die Superreichen treffen, sondern auch jene vierzig Prozent der Weltbevölkerung, die zu den globalen Mittelschichten zählen – wozu in einigen europäischen Ländern, wie etwa Deutschland oder Österreich, fast die gesamte Bevölkerung gehört. Wenn Biodiversität nicht weiter vernichtet werden soll, dann wird dies die Nahrungsmittelpreise in den Städten in die Höhe treiben. Wenn die rohstoffreichen Länder des Globalen Südens sich aus ihrer Abhängigkeit von der Nachfrage durch und die Konkurrenz unter den Industrieländern befreien wollen und darüber hinaus die Endlichkeit der Rohstoffe berücksichtigt werden soll, muss eine Politik der „managed austerity“ ins Auge gefasst werden, die die Bedürfnisse der Abnehmerländer nicht länger priorisiert.
Der erwartbare Einwand gegen eine solche Perspektive, die eher an eine Revolution gemahnt denn an eine Transformation, lautet, dass sich mit deren Ankündigung keine Wahlen gewinnen lassen. Doch eine Bearbeitung der ökologischen Krise verlangt heute von sozialen Bewegungen und politischen Parteien, die tatsächlich Teil der Lösung sein wollen, dass sie das „Unmögliche“ versuchen – schlichtweg deswegen, weil das „Mögliche“ in die ökologische Katastrophe, in tödliche Konflikte und in ein Chaos führt. Daran gemessen dürfte uns die gegenwärtige Lage rückblickend geradezu wie ein Paradies auf Erden erscheinen.
Der Beitrag basiert auf einem längeren Text der Autorin, der soeben im transform! Yearbook 2021 mit dem Titel „Capitalism‘s Deadly Threat“ publiziert wurde, sowie auf einem Beitrag für einen Sammelband aus dem Wissenschaftlichen Beirat von attac Deutschland, der unter dem Titel „Das Chaos verstehen“ soeben im VSA Verlag erschienen ist.
[1] Vgl. dazu Guido Speckmann, Die Chimäre der Klimaneutralität. Über die entlastende Wirkung eines neuen Mantras, in: „Blätter“, 3/2021, S. 99-106.
[2] Dekarbonisierung bezeichnet die Abkehr von kohlenstoffhaltigen Energieträgern vor allem im Energiesektor.
[3] Also all das, was von der Wirtschaftswissenschaft als bloße „Nebenfolge“ rationalen ökonomischen Kalküls abgetan wird.
[4] Vgl. Birgit Mahnkopf, Lessons from the EU: why capitalism cannot be rescued from its on contradictions, in: Gareth Dale et al, Green Growth, London 2016, S. 131-149.
[5] Vgl. dazu Heike Holdinghausen, Deutschlands Kotau vor der Wegwerfindustrie, in: „Blätter“, 1/2021, S. 13-16; dies., Verdörrt und vernutzt: Das Drama des Waldes, in: „Blätter“, 9/2020, S. 9-12; Annett Mängel, Plastik global: Die große Recyclinglüge, in: „Blätter“, 8/2019, S. 25-28.
[6] IEA, World Energy Outlook 2020, Paris.
[7] Vgl. dazu Birgit Mahnkopf, Produktiver, grüner, friedlicher? Die falschen Versprechen des digitalen Kapitalismus, Teil I und II, in: „Blätter“, 10 und 11/2019.