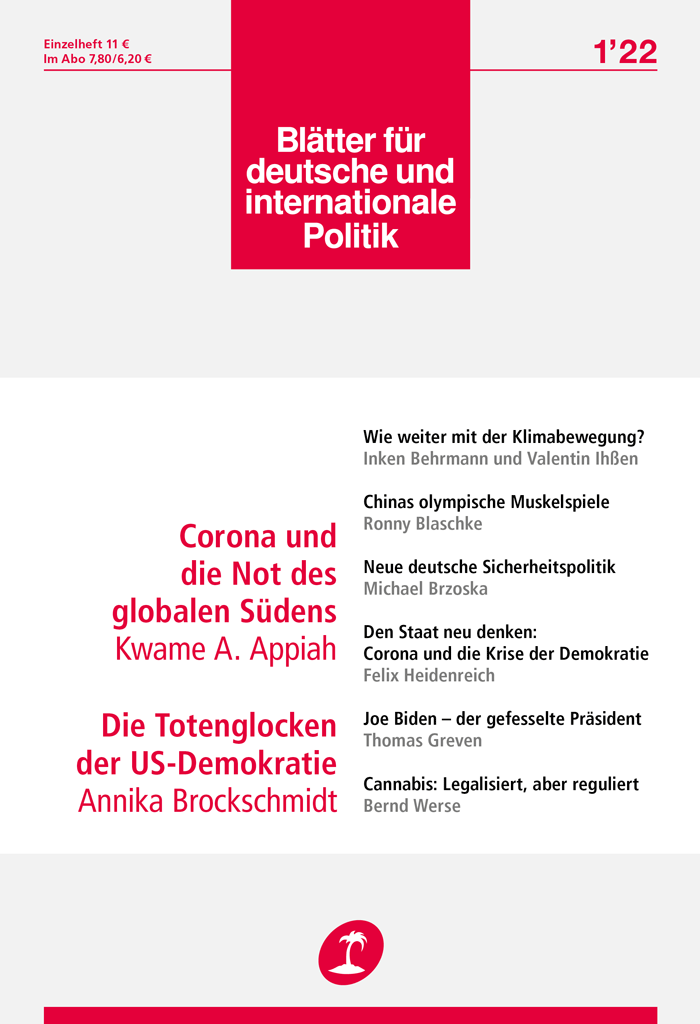Bild: Großvater mit seinem Enkel (IMAGO / Westend61)
Angesichts des sich abzeichnenden »Babyboomerbauchs« plädierte der Soziologe Stefan Schulz in den »Blättern« 10/2021 für grundlegende Reformen des bestehenden Rentensystems. Der Ökonom Gerd Grözinger widerspricht dieser Lesart und zeigt vier Wege auf, die eine umlagefinanzierte Rente auch in der Zukunft garantieren sollen.
Die zukünftige Rentenlage in Deutschland wird allzu gerne als katastrophal beschrieben. Immer weniger jüngere Menschen seien für immer mehr ältere finanziell verantwortlich und das sei ökonomisch langfristig nicht tragbar. Durchaus typisch für diese Sichtweise ist der jüngste „Blätter“-Beitrag von Stefan Schulz. Darin heißt es: „Der Altersquotient, der die jüngeren Einzahler ins Rentensystem und die älteren Geldempfänger ins mathematische Verhältnis setzt, wird von 35 auf mehr als 60 Prozent steigen. Die Erwerbstätigen werden demnach pro Person doppelt so viele Rentner versorgen müssen. Das klingt so dramatisch, wie es tatsächlich sein wird.“[1]
Ähnlich bewertet die Lage offenkundig die Ampelkoalition: Sie hält zwar an der durchschnittlichen Rentenhöhe und dem aktuellen Renteneintrittsalter fest. Gleichzeitig aber will sie das System so umstellen, dass die gesetzliche Rente künftig nicht mehr vollumfänglich umlagefinanziert ist. Stattdessen soll diese in Zukunft teilweise kapitalgedeckt sein. Mit Hilfe der „Aktienrente“ sollen Altersvorsorgesparer so vom Wachstum des Produktivkapitals profitieren.
Allerdings sind die Rentenaussichten weder so dramatisch wie oft beschrieben noch müssen wir unsere Altersversorgung dem Auf und Ab an den Finanzmärkten anvertrauen. Stattdessen will ich vier Möglichkeiten aufzeigen, die dazu beitragen können, die Rente auch in Zukunft sicher, nachhaltig und gerecht zu gestalten: erstens mit Blick auf die Erwerbsbeteiligung nach dem Geschlecht, zweitens unter Einbeziehung der sozialen Schichtung der Sterblichkeit, drittens hinsichtlich des Verhältnisses von Kapital und Arbeit bei der Finanzierung der Rentenbeiträge sowie viertens mit Verweis auf die wichtige Rolle der Zuwanderung nach Deutschland.
»Die bislang schwache Erwerbsbeteiligung von Frauen geht auf das Ehegattensplitting und die unzureichende Kinderbetreuung zurück.«
In der Fachdiskussion wird vor allem der erste Punkt, die Frage nach der Erwerbsbeteiligung, thematisiert. Die Wirtschaft fordert bereits seit längerem, die Lebensarbeitszeit an die gestiegene Lebenserwartung anzupassen. Typisch ist hier das Gutachten des arbeitgeberseitig getragenen Instituts der Deutschen Wirtschaft, das eine „fortgesetzte Anhebung der Regelaltersgrenze nach 2031“ befürwortet.[2]
In der Bevölkerung wird diese Forderung allerdings kritisch gesehen: Einer Umfrage von „YouGov“ vom Sommer 2021 zufolge befürworten nur 20 Prozent der Deutschen, das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln.[3] In der Bevölkerung scheint also durchaus ein Bewusstsein dafür vorzuherrschen, dass eine höhere Lebenserwartung für viele nicht mit einer längeren Arbeitsfähigkeit gleichzusetzen ist.[4] Auch die Ampel-Koalition hat eine Anhebung des Renteneintrittsalters ausgeschlossen.
Und tatsächlich gibt es andere, einleuchtendere Stellschrauben. So tragen Frauen, die hierzulande überwiegend in Teilzeit arbeiten, insgesamt nur zu 40 Prozent zum gesamten bezahlten Arbeitsvolumen bei.[5] Würden sie in Zukunft genauso viele Stunden arbeiten wie Männer, würde dies die insgesamt geleistete Erwerbsarbeit um rund 20 Prozent erhöhen.
Die bislang vergleichsweise schwache Erwerbsbeteiligung von Frauen geht vor allem auf zwei Faktoren zurück: das für Zweitverdienerinnen ungünstige Ehegattensplitting sowie die noch unzureichende Kinderbetreuung. Würden beide Hindernisse beseitigt, ergäben sich daraus Vorteile in gleich mehrfacher Hinsicht. Nicht nur würden insgesamt mehr Frauen einer Erwerbsarbeit nachgehen, sondern es würde auch die implizite Subvention besserverdienender Haushalte gestoppt. In der Folge würden die öffentlichen Haushalte dank zunehmender Steuereinnahmen weitere, vermutlich sogar zweistellige Milliardenbeträge einnehmen – die wiederum der Rentenversicherung zugutekommen könnten.[6]
Allerdings wäre die Wirkung eines erhöhten weiblichen Lohnarbeitsvolumens begrenzt. Denn derzeit geht der Trend in der Erwerbsbevölkerung insgesamt dahin, weniger arbeiten zu wollen. Die Erhöhung der weiblichen Erwerbstätigkeit kann somit zwar zur Entspannung an der Rentenfront beitragen, gänzlich schließen kann sie die Versorgungslücke aber nicht.
»Die Lebenserwartung und damit die Rentenbezugsdauer steigen mit zunehmendem Einkommen kontinuierlich an.«
Das deutsche System differenziert seine Rentenanwartschaft nach Verdiensthöhe und geleisteten Arbeitsmonaten. Es erscheint damit auf den ersten Blick objektiv konstruiert, weil es auf dem sogenannten Äquivalenzprinzip beruht: Wer mehr Jahre als andere gearbeitet hat, erhält am Ende auch eine höhere Rente. Dabei wird jedoch implizit unterstellt, dass alle Rentnerinnen und Rentner in etwa die gleiche Lebenserwartung haben und damit im Alter eine ähnlich hohe Anzahl an Bezugsmonaten genießen können.
Tatsächlich aber steigen die Lebenserwartung und damit die Rentenbezugsdauer mit zunehmendem Einkommen kontinuierlich an, wie unter anderem das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung diagnostiziert hat.[7] Die ärmsten Rentner nehmen demnach ihre Rente nur rund 14 Jahre lang in Anspruch, die reichsten unter ihnen hingegen mehr als 22 Jahre, das entspricht einem Plus von mehr als 50 Prozent.
Diese Spreizung liefert eine starke politische Begründung dafür, die ärmeren Rentenbezieherinnen und -bezieher rasch besserzustellen.[8] Dabei wäre es fair, bei künftigen Generationen die unterschiedliche Lebenserwartung nach Einkommenshöhe zu berücksichtigen. So wäre es denkbar, für obere Einkommensschichten einen Zuschlag auf die Rentenbeiträge einzuführen, der nicht rentensteigernd für die Einzelnen wirkt, sondern zur gesamtgesellschaftlichen Finanzierung des Rentensystems beiträgt. Eine solche Zusatzbelastung der besserverdienenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würde faktische Unterschiede in der Rentenbezugsdauer zumindest teilweise einebnen und die finanzielle Basis der gesetzlichen Rente verbessern.
»Die Gesamtlohnkosten sind hierzulande zu niedrig und führen zu einem kontinuierlichen Handelsbilanzüberschuss gerade auch innerhalb der Eurozone.«
Im deutschen Sozialversicherungssystem werden die Beiträge zwischen der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberseite weitgehend hälftig aufgeteilt. Diese Lohnnebenkosten kritisieren vor allem Arbeitgeber vielfach als zu hoch. Sie fürchten um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen. Geradezu zum Dogma wird dabei die 40-Prozent-Schwelle erhoben, wonach die Summe aller Sozialversicherungsbeiträge auf das Bruttoentgelt 40 Prozent nicht überschreiten dürfe.[9] Ökonomisch ist das allerdings wenig überzeugend, denn tatsächlich gilt das genaue Gegenteil: Die Gesamtlohnkosten sind hierzulande vergleichsweise niedrig und führen deshalb zu einem kontinuierlichen Handelsbilanzüberschuss gerade auch innerhalb der Eurozone, der konkurrierende Ökonomien in der gemeinsamen Währungsunion benachteiligt.[10] Lösen ließe sich dieses Problem derzeit nur durch eine Steigerung der Personalausgaben hierzulande, indem der Gesetzgeber Sozialversicherungsbeiträge erhöht und
diese Mehrbelastung den Arbeitgebern aufbürdet. Dadurch könnten die allgemeinen Staatszuschüsse an die Rentenkassen sinken und die Mittel stattdessen beispielsweise in die Finanzierung der Klimapolitik fließen, eine jetzt schon vorliegende Koppelung.[11] Angesichts eines Exportüberschusses von derzeit fast 180 Mrd. Euro – darunter 68 Mrd. im Euroraum – wären beträchtliche Mehreinnahmen zu erwarten.
»Möglicherweise eröffnet die Koppelung der Zuwanderungs- mit der Rentenfrage eine Chance rationaler Deliberation.«
Nach einem angeblich von Mark Twain stammenden Satz sind „Prognosen immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen“. Das trifft auch auf die Rentendebatte zu – vor allem was den angeblichen Sprung beim Altersquotient von 35 auf über 60 betrifft.
Jede Prognose hat zwei Rahmungen: erstens hinsichtlich des Zeitraums, für den sie gelten soll; zweitens hinsichtlich der getroffenen Annahmen für diesen Zeitraum. Stefan Schulz erweckt in seinem Beitrag den Eindruck, als würden wir die demographischen Grundlagen nur bis 2045 kennen. Tatsächlich aber endet die, auch seinem Beitrag unterliegende, Prognose des Statistischen Bundesamts erst 2060. Vom Publikationszeitpunkt 2021 aus gesehen, stünden also nicht nur 24, sondern 39 Jahre für rentenpolitische Anpassungen zur Verfügung – und damit ganze 15 Jahre mehr als Schulz behauptet.
»Es bedarf eines Staates, der zuvorderst die bestehenden Verzerrungen beseitigt.«
Weitaus gravierender aber ist, dass das Statistische Bundesamt – anders als von Schulz unterstellt – nicht nur eine, sondern insgesamt 21 Varianten berechnet hat, da sich im Zeitverlauf Faktoren wie die Lebenserwartung, die Geburtenrate oder auch der Anteil der Zuwanderung nach Deutschland entsprechend der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen verändern können. Der von Schulz zitierte Anstieg des Altersquotienten auf gut 60 ist nur eine davon, eine andere prognostiziert bestenfalls einen Anstieg auf unter 50. Wenn denn die jährliche Netto-Zuwanderung auf etwas über 300 000, wie sie in den letzten knapp zwei Jahrzehnten gegeben war, beibehalten wird.[12] Ein Überschuss bei der Zuwanderung lässt sich dadurch erzielen, dass nicht nur die Zahl der Zuzüge erhöht wird, sondern auch die Fortzüge künftig minimiert werden – etwa durch Anerkennung von anderswo erworbenen Bildungsabschlüssen, einen besseren Zugang zu Sprachkursen sowie eine Abkehr von den inhumanen wie absurden Abschiebungen lange hier lebender und arbeitender Asylbewerber.[13]
Durch eine gezielte Förderung der Zuwanderung ließe sich somit eine ökonomische Win-win-Situation erzeugen: Deutschland kann und sollte erheblich mehr jüngere Erwerbstätige aufnehmen. Und es gibt zahlreiche Menschen auf der Welt, die hier arbeiten und leben möchten. Durch ihre Beiträge zur Rentenversicherung würde die Finanzierung des umlagebasierten Rentensystems langfristig sichergestellt. Möglicherweise eröffnet die Kopplung der Zuwanderungs- mit der Rentenfrage somit eine Chance für eine rationale Debatte, in der jene, die eine Erhöhung des Renteneintrittsalters ablehnen, von einer liberaleren Zuwanderungspolitik überzeugt werden können.
Dass sich in Deutschland ein demographischer Wandel vollzieht, ist unbestritten. Dass dies auch eine Abkehr vom gegenwärtigen umlage- hin zu einem stärker steuer- oder gar über eine Kapitaldeckung finanzierten Rentensystem erforderlich macht, kann man jedoch sehr wohl bestreiten. Stattdessen bedarf es eines Staates, der zuvorderst die bestehenden Verzerrungen beseitigt – nicht zuletzt die steuerliche Subvention der Hausfrauenehe, die bei der Rente unverdiente Besserstellung der Gutverdienenden sowie die Schonung der Arbeitgeberseite bei den Abgaben – und der durch eine gezielte Förderung der Zuwanderung die Finanzierung des umlagebasierten Rentensystems langfristig sicherstellt.
[1] Stefan Schulz, Der Babyboomerbauch oder: Die Rente als Kampffeld, in: „Blätter“, 10/2021, S. 10-21.
[2] Jochen Pimpertz und Ruth Maria Schüler, IW-Gutachten: Nachhaltigkeit in der gesetzlichen Rentenversicherung, Köln 2021.
[3] Vgl. Anne Hund, Rente erst mit 68? Repräsentative Umfrage kommt zu eindeutigem Ergebnis, www.merkur.de, 11.6.2021.
[4] Gerhard Bäcker, Andreas Jansen und Jutta Schmitz, „Rente erst ab 70?,“ Essen, 2017.
[5] Susanne Wanger, Entwicklung von Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen nach Geschlecht: Ergebnisse der IAB-Arbeitszeitrechnung nach Alter und Geschlecht für die Jahre 1991-2019, IAB-Forschungsbericht 2020.
[6] Stefan Bach u.a., Reform des Ehegattensplittings: Realsplitting mit niedrigem Übertragungsbetrag ist ein guter Kompromiss, in: „DIW Wochenbericht“, 41/2020, S. 785-794.
[7] Peter Haan, Daniel Kemptner und Holger Lüthen, Besserverdienende profitieren in der Rentenversicherung zunehmend von höherer Lebenserwartung, in: „DIW Wochenbericht“, 23/2019, S. 391-399.
[8] Gerhard Bäcker und Andreas Jansen, Entlastung von Niedrigverdienern durch progressive Sozialversicherungsbeiträge?, in: „Sozialer Fortschritt“, 2012, S. 173-182.
[9] Vgl. dazu Katharina Grabietz und Stefanie Janczyk, Sozialkassen nach Corona: Wer zahlt die Rechnung?, in: „Blätter“, 8/2021, S. 29-32.
[10] Vgl. International Monetary Fund, External Sector Report, Washington D.C. 2019.
[11] Vgl. Stefan Bach et al., Ökosteuer-Einnahmen sorgen noch heute für niedrigere Rentenbeiträge und höhere Renten, in: „DIW Wochenbericht“, 13/2019, S. 223-231.
[12] Statistisches Bundesamt, „Bevölkerung im Wandel. Annahmen und Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung“, Wiesbaden 2019, S. 18.
[13] Vgl. Johann Fuchs und Enzo Weber, Migrationspolitik wird bei der Integration gewonnen, www.makronom.de, 2.11.2021.