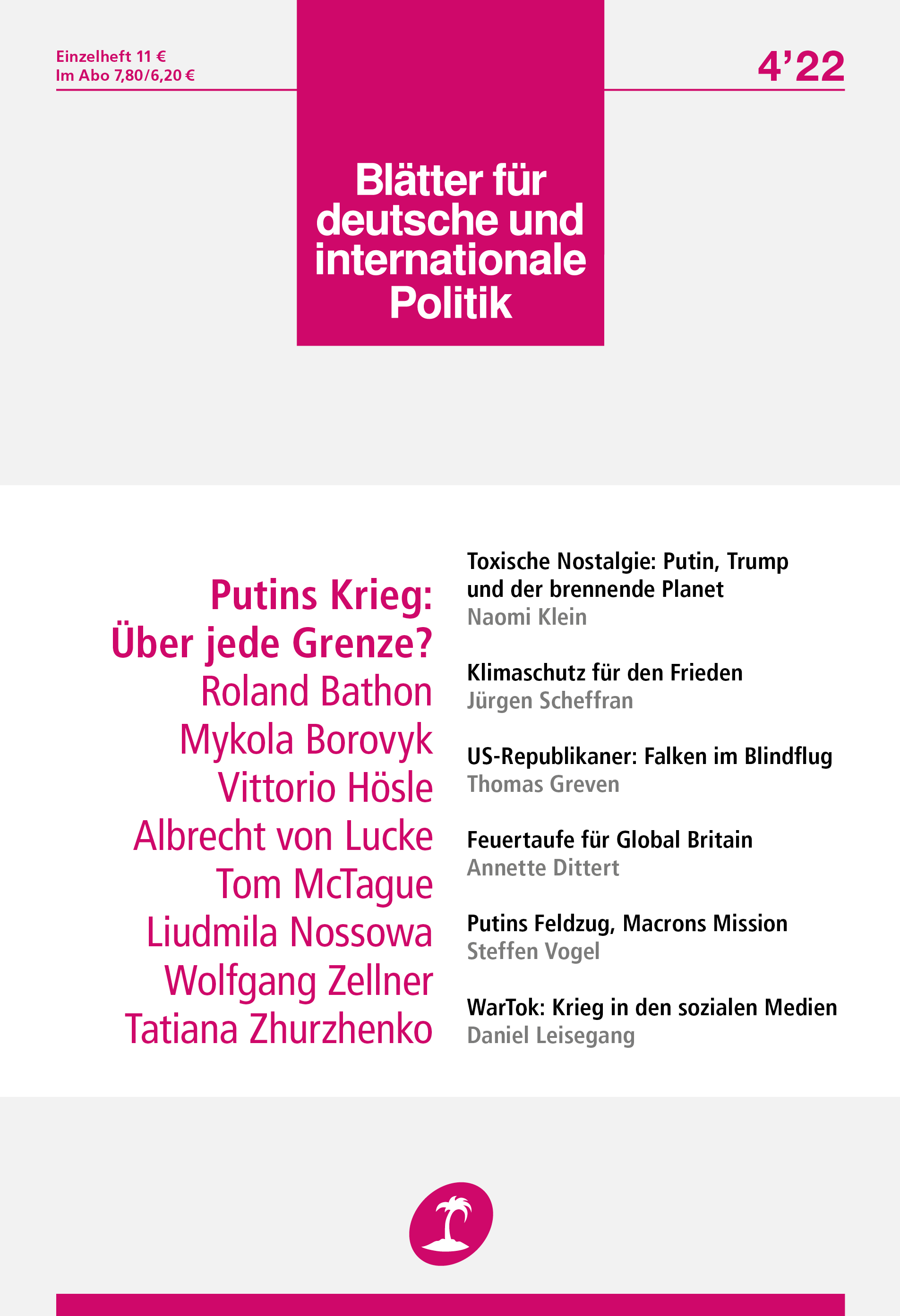Trumps Republikaner und Putins Russland
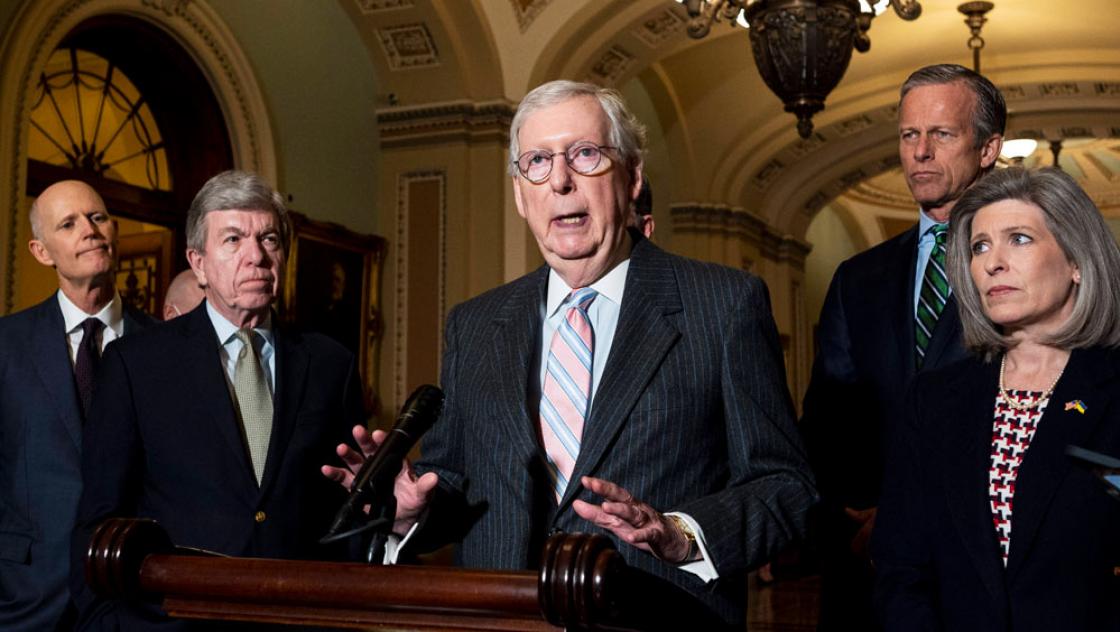
Bild: Der Republikanische Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, bei einer Pressekonferenz der republikanischen Fraktionsführung im Senat, Washington/USA, 22.3.2022 (IMAGO / ZUMA Wire)
Eines hat Wladimir Putin mit seinem Krieg gegen die Ukraine schon erreicht, mutmaßlich unbeabsichtigt: die zuletzt angeblich „hirntote“ (so Emmanuel Macron noch 2019) Nato wiederzubeleben. Eilig wird deren ursprüngliche raison d’être als gen Osten ausgerichtetes Militärbündnis erneuert. Ob Putins Vermutung zutrifft, dass der Westen sich seit Ende des Kalten Kriegs in eine postheroische, das heißt nicht mehr ausreichend opferbereite und damit kaum verteidigungsfähige Dekadenzgesellschaft verwandelt hat, werden wir hoffentlich nicht so bald – besser nie – herausfinden. Was sich schneller zeigen wird: ob die vor allem von Russland gezielt vorgetragenen Desinformations- und Propaganda-Angriffe auf die Wertebasis und Geschlossenheit der westlichen Gesellschaften bereits soweit verfangen haben, dass auch eine gemeinsame politische Antwort auf die russische Aggression mittelfristig nicht durchgehalten werden kann.
Demokratien mit freien Medienöffentlichkeiten sind nicht erst seit dem Siegeszug der sozialen Medien grundsätzlich anfällig für die Verbreitung von Desinformation. Deshalb stellt sich die Frage nach dem Zusammenhalt der Gesellschaft auch in Deutschland und insgesamt in Europa. Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für die Nato sind die USA jedoch der wichtigste Schauplatz für diese Entwicklungen und dort stehen vor allem die Republikanische Partei und konservative Medien im Fokus, nicht nur aufgrund Donald Trumps offenkundiger Bewunderung für Wladimir Putin.
Man mag sich nicht ausmalen, wie die Reaktion des Westens auf den Angriff Russlands mit einem Präsidenten Trump im Weißen Haus ausgefallen wäre. Vor allem in Bezug auf Russland und die Ukraine zeigte sich vor, während und nach dessen Amtszeit, welch unsicherer Kantonist und rein transaktional denkender Hasardeur da zeitweise die Kontrolle über das für die Nato-Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit so entscheidende Nuklearwaffenarsenal der USA hatte. Zur Erinnerung: Die geschäftlichen Beziehungen mit Russland und „Freund“ Putin (so Trump per Twitter) erstreckten sich unter anderem auf einen Schönheitswettbewerb und die Planung eines Trump Towers in Moskau – noch während Trump schon für das Präsidentenamt kandidierte. Trumps zeitweiliger Wahlkampfberater Paul Manafort war zuvor für den Russland-freundlichen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch tätig. Immer wieder äußerte Trump Verständnis für die Sichtweise Putins, dass die Bewohner der Krim und des Donbas zu Russland gehören wollen, und brachte deshalb auch das Ende der Sanktionen ins Spiel – was nur am Widerstand des US-Kongresses scheiterte. Er übernahm, gegen die Einschätzung seiner eigenen Nachrichtendienste, Putins Position, dass Russland sich nicht in den 2016er Wahlkampf eingemischt habe. Trump weckte ständig Zweifel an der Nato und knüpfte schließlich in seinem berüchtigten „perfect phone call“ 400 Mio. US-Dollar vom Kongress bereits bewilligte Militärhilfe für die Ukraine an die Bereitschaft von Präsident Wolodymyr Selenskyj, belastendes Material über Joe Biden und dessen Sohn Hunter (zeitweise im Vorstand des größten ukrainischen Gasproduzenten) für den Wahlkampf 2020 zu liefern. Das führte zum ersten Impeachment-Verfahren gegen Trump.
Die Rückkehr der Falken?
Trotz der Trumpschen putinfreundlichen Eskapaden, zuletzt seine Bemerkungen über dessen Genie, haben nun vordergründig wieder die traditionellen „Falken“ Oberwasser in der Republikanischen Partei bzw. genauer: Viele Republikaner haben im Angesicht der russischen Aggression ihre traditionellen bellizistischen Positionen wiederentdeckt. Als Teil einer überparteilichen Gruppe und individuell drängen unter anderem die Senatoren Rob Portman (Ohio) und Jim Risch (Idaho), ranghöchster Republikaner im Foreign Relations Committee, Präsident Joe Biden angesichts dessen kalkulierter, auf den Zusammenhalt des westlichen Bündnisses und die Vermeidung eines dritten Weltkriegs ausgerichteter Zurückhaltung, auf entschlosseneres Handeln zugunsten der Ukraine. Die Forderung nach einer „no-fly zone“ ist wohl vom Tisch, auch weil der Republikanische Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, sie strikt ablehnt, aber mehr Waffen und härtere Sanktionen sind weiterhin im Spiel.
Angesichts dieser Forderungen und der stehenden Ovationen von US-Senatoren und -Abgeordneten beider Parteien für den am 16. März per Video-Anruf zugeschalteten ukrainischen Präsidenten gerät eines leicht in Vergessenheit: Die Republikanische Partei verhielt sich während Trumps Amtszeit passiv und geradezu duckmäuserisch gegenüber seiner Nähe zu Autokraten wie Putin und Kim Jong-un sowie seiner Nato-Verachtung – und tut dies mit wenigen Ausnahmen immer noch. Eine wirkliche Distanzierung vom möglichen Präsidentschaftskandidaten für die Wahl 2024 ist bislang nicht erfolgt. Man übergeht seine Bemerkungen („Friedenstruppen“) oder tut sie als Witz ab, wie seinen Vorschlag, amerikanische Kampfflugzeuge für einen Angriff auf Russland mit chinesischen Hoheitszeichen auszustatten und dann dabei zuzusehen, wie sich Russland und China bekriegen. Das Narrativ, dass Trumps angebliche Stärke Putin von jeglichen militärischen Aktionen während seiner Amtszeit abgehalten und dass Bidens angeblich offensichtliche Schwäche Putin nun dazu eingeladen habe, ist einfach zu attraktiv für Republikanische Politiker, auch weil es wunderbar von den eigenen Verfehlungen ablenkt.
Ein Gedankenexperiment zeigt, wie sehr die politische Welt in den USA aus den Fugen geraten ist: Barack Obama, Hillary Clinton oder Joe Biden würden nach solchen Aussagen, die man Trump durchgehen lässt, ohne jeden Zweifel als Landesverräter beschimpft werden („lock them up“) und hätten auch in der eigenen Partei einen schweren Stand. Die Republikaner haben dagegen nicht nur die erste Gelegenheit einer klaren Distanzierung von Trump verstreichen lassen – nach der versuchten Erpressung Selenskyjs – sondern auch die zweite, bei dem am 13. Januar 2021 wiederum gescheiterten zweiten Impeachment-Verfahren nach dem versuchten Staatsstreich am 6. Januar 2021. Es sieht derzeit nicht so aus, als ob sie die sich aktuell bietende dritte Gelegenheit zum klaren Bruch mit Trump nutzen wollen. Eine plausible Erklärung dafür ist Trumps fast ungebrochene Macht über die Basis der Partei, insbesondere weil die Vorwahlen für die Kongresswahlen im November anlaufen.
Aber es steckt leider mehr dahinter als Wahlkalkül und es zeigt, wie brüchig die Position der USA in der westlichen Werte- und Verteidigungsgemeinschaft geworden ist. Zwar ist der von Liz Cheney – der wegen ihrer Trump-Kritik entmachteten Abgeordneten aus Wyoming – geprägte Begriff des „Putin-Flügels“ der Republikanischen Partei vor allem polemisch gemeint, aber die Bemerkung des ehemaligen Vize-Präsidenten, Mike Pence, dass es in der Partei keinen Platz für Putin-Apologeten gebe, trifft eindeutig nicht zu. Neben unsäglichen Interviews und Fernsehauftritten etwa von Mike Pompeo, der Außenminister unter Trump war, und vom ehemaligen General Douglas McGregor, zuletzt in Trumps Pentagon tätig, der unter anderem dem russischen Militär bescheinigte, am Anfang zu schwach aufgetreten zu sein und der die Verantwortung für das fortgesetzte Leid in der Ukraine bei Selenskyj ablud, tritt vor allem Tucker Carlson als Einpeitscher in Erscheinung.
Der Fox-Moderator ist bei der Trump-Basis – der MAGA-Crowd, nach Trumps von Ronald Reagan geklautem Slogan „Make America Great Again“ – äußerst beliebt und verbreitet in seiner erfolgreichen Abendshow Verschwörungserzählungen für ein Millionenpublikum. Dabei setzt er bevorzugt auf vordergründig harmlos und zumindest legitim klingende Fragen, die allerdings stets mit gezielten Auslassungen und Falschinformationen beantwortet werden. Er hat sich derzeit auf die unter anderem vom russischen Außenminister Sergej Lawrow vorgebrachte Kriegsbegründung verlegt, dass die USA die Entwicklung von chemischen und biologischen Waffen in ukrainischen Laboren unterstützt hätten, gegen die Russland quasi „präemptiv“ vorgehen musste. Im Kongress sind die Anhänger dieser und anderer Verschwörungserzählungen („QAnon“) noch in der Minderheit, aber die Abgeordneten Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert und Matt Gaetz gehören bei der MAGA-Crowd zu den beliebtesten Politikern, auch weil sie sehr konsequente Trump-Apologeten sind.
Doch was für den verschwörungsgläubigen Rand der GOP gelten mag – dass ihr auch von russischer Desinformation gezielt angestachelter Hass auf „liberals“ und „wokeness“ so groß ist, dass sie im Zweifel lieber von Putin als von Biden regiert werden möchten –, gilt wohl nicht einmal für das Gros der MAGA-Crowd, geschweige denn für die Mehrheit der Wähler und Amtsträger der Republikanischen Partei. Diesen müsste sich bei Tucker Carlsons Nacherzählung der Lawrowschen Version der Geschichte die Frage stellen, ob sie im Zweifel nicht trotzdem zur Ukraine halten sollten, weil diese ja nun von den USA unterstützt wird, ihrem Land. Im Kern geht es also um das Verhältnis der Republikaner zur Nation, zu den nationalen Interessen der USA.
Neo-Isolationismus und White Supremacy
Es hieß einmal „politics stops at the water’s edge” und „right or wrong, my country”. Selbstverständlich war der im ersten Bonmot zum Ausdruck kommende außenpolitische Konsens selbst während der Hochphase des Kalten Krieges nie vollständig, gestritten wurde immer. Und die Schattenseiten eines unbedingten Patriotismus sind offenkundig; zu oft haben sich US-Regierungen mit Unterstützung der Bevölkerung in außenpolitische und militärische Abenteuer gestürzt. Hier traf – ausgerechnet – Donald Trump einen wunden Punkt, als er auf die Frage, ob Putin nicht ein „Killer“ sei, antwortete: „Es gibt eine Menge Killer. Glauben Sie, unser Land ist so unschuldig?“ Wie bei seiner Globalisierungskritik konnte Trump hier linke und konservative Positionen gleichermaßen bedienen, Anti-Imperialismus wie Neo-Isolationismus.
Der klassische Isolationismus in der Republikanischen Partei, begründet etwa durch die berechtigte Kritik an der mangelnden Lastenteilung in der Nato, trifft in Trumps America-First-Bewegung auf eine Art „Working class-Neo-Isolationismus“, der vor allem auf einer breiten Kriegsmüdigkeit der Bevölkerung nach den jahrzehntelangen Engagements im „war on terror“ beruht. J. D. Vance, Autor des auch hierzulande gefeierten Bestsellers „Hillbilly Elegy“, der im November für die Republikaner Senator von Ohio werden will, drückte es in einem Podcast so aus: „Mir ist ziemlich egal, was mit der Ukraine passiert – wie auch immer es ausgeht.“ Hilfen für die Ukraine lehnt er strikt ab. „America first“ fokussiert auf die Konkurrenz mit China und sieht scharfe protektionistische Maßnahmen vor. Sanktionen gegen China könnten deshalb durchaus auf Zustimmung stoßen, wenn Peking sein „doppeltes Spiel“ aufgibt und deutlich zugunsten Russlands agiert.
Der US-amerikanische Neo-Isolationismus ist eine Herausforderung für die ohnehin schon angegriffene liberale Weltordnung und ihre Unterstützer – nachdem der Glaube an „Wandel durch Handel“ zuletzt tiefe Kratzer bekommen hat – und für die hegemoniale Stellung der USA. Er ist aber einfacher zu bewältigen als die wachsende Strömung des Ethno-Nationalismus. Ein völkisch verstandener Nationalismus der Weißen – für manche enger: der weißen Christen – schließt innerhalb der USA nicht-weiße Bürger von der Gemeinschaft aus und verfolgt grenzüberschreitend das Projekt einer globalen extremistischen Rechten. Jenseits des klassischen territorialen Nationalismus sieht man inzwischen auch Berührungspunkte mit ähnlich denkenden slawischen Ethno-Nationalisten. In dieser Strömung ist dann auch die Putin-Nähe am größten, weil man in ihm einen Bündnispartner bei der Bekämpfung der liberalen Demokratien und pluralistischen Gesellschaften sieht. „Putin, Putin“, skandierten zwei Tage nach Kriegsbeginn die Teilnehmer der ersten America First Political Action Conference in Orlando, an der auch Politiker der Republikanischen Partei teilnahmen, unter anderem Paul Gosar, Abgeordneter aus Arizona, und die schon genannte Greene, die auch schon von „Nato Nazis“ gesprochen hat.[1] Ein anderer Abgeordneter, Madison Cawthorn aus North Carolina, nannte jüngst Wolodymyr Selenskyj einen Ganoven („thug“) und die Ukraine „unglaublich böse“, was genau wie Tuckers Tiraden vom russischen Staatsfernsehen gerne aufgegriffen wird.Trumps Ex-Berater Stephen Bannon, der in seinem Podcast für den Autokraten Putin schwärmt, unternimmt immer wieder Versuche, grenzüberschreitende Bündnisse der Ethno-Nationalisten zu schmieden. Doch die Ideologen der russischen Seite sehen bisher nur in den weißen Europäern Verbündete, die weißen Amerikaner („Atlantiker“) sind für sie der Feind.
Die Erben Trumps
Für die Trump-nahen pragmatischen Machtpolitiker in der GOP hingegen geht es vor allem darum, Trumps Basis zu erben und mit ihrer Hilfe politisch Karriere zu machen, am liebsten bis ins Weiße Haus. Wie Trump können sie dem Autoritarismus von Putin und anderen Diktatoren mutmaßlich einiges abgewinnen, aber sie lassen sich außenpolitisch nicht in die Karten schauen, weil es da wenig zu gewinnen gibt. Trumps Vize Mike Pence und die anderen Präsidentschaftsaspiranten, Senator Tom Cotton aus Arkansas und Floridas Gouverneur Ron DeSantis, nutzen ohne Beleg das bequeme Narrativ, dass Putin aufgrund von Trumps Stärke keinen Angriff gewagt hätte. Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton hat eine weniger schmeichelhafte Erklärung: Putin habe darauf spekuliert, dass ein wiedergewählter Trump die USA aus der Nato zurückzieht.
Und so sind es wohl vor allem die außenpolitischen Falken und die opportunistischen Machtpolitiker ohne Präsidentschaftsambitionen (Mitch McConnell und vielleicht der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy), die noch einen klassischen Nationalismus vertreten und eine Führungsrolle der USA in der Welt anstreben, Mit ihnen kann Biden am ehesten kooperieren – jedenfalls in der Außenpolitik.
Es gibt Überschneidungen zwischen den Strömungen in der Republikanischen Partei. Allen gemeinsam ist der Versuch der Untergrabung der amerikanischen Demokratie zum Zwecke des Machtgewinns und dauerhaften Machterhalts. Auch die Never-Trumper um Liz Cheney und Mitt Romney befürworten die vielen Gesetze zur Erschwerung der Wahlbeteiligung.
Dass jetzt in der Ukraine Demokratie und Freiheit auch mit amerikanischer Hilfe verteidigt werden sollen, während in den USA die demokratischen Institutionen untergraben werden, ist durchaus nichts Neues. Auch in der Vergangenheit wurden Demokratie und Freiheit in der Welt gepredigt, während in vielen US-Staaten noch die Gesetze der Segregation herrschten. Immerhin konnten früher mit dem Hinweis auf die offensichtliche Doppelmoral landesweit Verbesserungen erzielt werden; heute treiben die Kulturkämpfe von links und rechts – vor allem von rechts – die nur noch auf dem Papier „Vereinigten“ Staaten immer weiter auseinander.
Wie man an der Ukraine sehen kann, braucht es insbesondere für militärische Konfrontationen eine nationale Geschlossenheit. Doch selbst die außenpolitischen Herausforderungen können Republikaner und Demokraten wohl nicht mehr einen. Der „rally effect“ für Joe Biden ist schwach und die leicht erhöhten Zustimmungswerte sind wohl auch nicht von Dauer. Wenn die ökonomischen Kosten der – mehrheitlich befürworteten – Sanktionen spürbar werden, werden die Republikaner das Geschenk vor den Kongresswahlen ohne zu zögern nutzen.
Politisch haben Biden und die Demokraten vermutlich kaum etwas zu gewinnen, egal wie der Konflikt ausgeht. Ein „schmutziger Friede“ ist nicht unwahrscheinlich, egal wie viel Hilfe man der Ukraine noch zukommen lässt. Und ein „neues Afghanistan“ für Russland, also ein langer Abnutzungs- und Partisanenkrieg, der Moskau schwächen würde, könnte angesichts der dann zu erwartenden Opfer wohl nur von Zynikern als geopolitischer Erfolg gefeiert werden.
Die Kongresswahl im November 2022 ist bereits jetzt eine Schicksalswahl für den Bestand der amerikanischen Demokratie.[2] Der zu erwartende Sieg der Republikaner, zumindest im Repräsentantenhaus, lässt unter anderem angesichts der verstärkten Maßnahmen zu Wählerunterdrückung die Hoffnung schwinden, dass die Präsidentschaftswahl 2024 regulär durchgeführt werden kann. Angesichts der Ukraine-Krise kommt der Wahl auch eine weltpolitische Bedeutung zu, weil ein Sieg der Republikaner möglicherweise die ohnehin prekäre Rolle der USA im westlichen Verteidigungsbündnis infragestellt – oder jedenfalls die Bühne dafür durch den Nachfolger Bidens bereitet.
Zwar könnte Präsident Biden auch nach einem Wahlsieg der Republikaner im November außenpolitisch weiter viel gestalten. Aber er oder jeder andere Kandidat der Demokraten würde 2024 dafür sicher einen Preis bezahlen. Gewinnt dann Trump oder einer seiner autoritären, isolationistischen oder gar ethno-nationalistischen Adepten, dann könnte es zur Erosion der gerade erst wiederbelebten Nato kommen, etwa durch den Abzug der Amerikaner aus Europa. Dann wäre die Nato – ihrem Selbstverständnis als europäisches Verteidigungsbündnis nach – tatsächlich nicht nur hirntot, sondern ganz tot.
Die osteuropäischen Staaten scheinen sich darauf durch verstärkte eigene Rüstungsanstrengungen bereits einzustellen, allen voran Polen, und das trotz der Nähe der regierenden PiS zu Trump. Aber: Populisten sind bekanntlich wandlungsfähig. Möglicherweise entpuppt sich Trump noch als der größte Falke, den man sich denken kann. Kein Zweifel, dass er ein solcher würde, wenn er meint, dass es ihm nützt – politisch oder geschäftlich.
[1] Sasha Abramasky, Putin’s Republican Sympathizers, www.thenation.com, 3.4.2022.
[2] Thomas Greven, Staatskrise mit Ansage. Die US-Republikaner vor der autokratischen Wende, in: „Blätter“, 8/2021, S. 81-90.