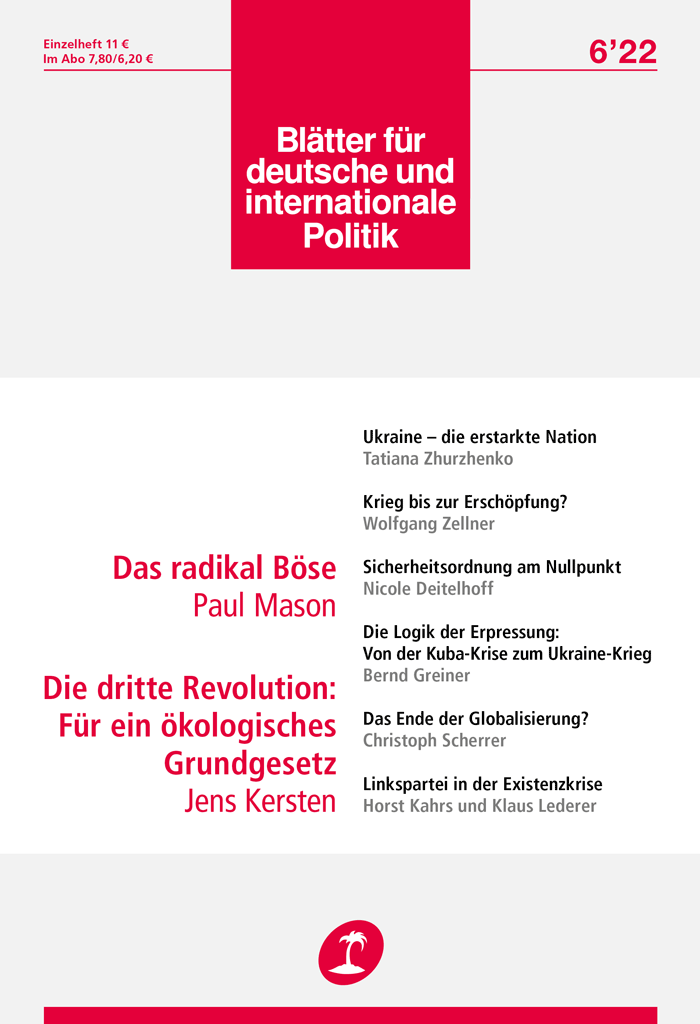Putins Krieg und die Europäische Sicherheitsordnung

Bild: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew, 8.4.2022 (IMAGO / ZUMA Press)
Russlands Krieg in der Ukraine hat die internationale Ordnung um Jahrzehnte zurückgeworfen. Die europäische Friedens- und Sicherheitsarchitektur liegt bereits in Trümmern, und auch wenn noch nicht ausgemacht ist, wie dieser Krieg enden wird, ist schon jetzt klar, dass es keinen Weg zurück zur kooperativen Europäischen Sicherheitsordnung geben wird, wie wir sie kannten. Doch trotz aller Rede von einer Zeitenwende, die mit diesem Krieg verbunden ist, sollte Vorsicht walten, ob dieser Entwicklungen alle Erfahrungen und bisherigen Grundlagen einer kooperativen Sicherheitsordnung zu verwerfen. Genau das droht aber in der gegenwärtigen politischen Debatte zu geschehen. So wird argumentiert, dass der Ukraine-Krieg zeige, dass Diplomatie und kooperative Sicherheit gescheitert seien und nur Abschreckung und Wehrhaftigkeit helfen würden, den Frieden in Europa abzusichern. Damit einher geht die Annahme, dass der Krieg auch die Idee vom Wandel durch Handel, das heißt von Friedensförderung durch wechselseitige Verflechtung, ganz grundsätzlich diskreditiere, ja, es sich sogar um einen „epochalen Irrtum“ handele.[1]
Die Außen- und Sicherheitspolitik müsse sich endlich wieder, so ist zu hören, an den politischen Realitäten orientieren, ganz wie es Vertreter des Realismus in den Internationalen Beziehungen fordern, etwa John Mearsheimer, aber auch der Politische Theoretiker Herfried Münkler, der sogar die alte Idee einer EU-Nuklearwaffenoption wieder ins Spiel bringt.[2] Der teils schrille Ton der Debatte, wie Jürgen Habermas ihn zu Recht in der „Süddeutschen Zeitung“ beklagte,[3] droht die basale Erkenntnis zu übertönen, dass weder Frieden noch Sicherheit allein auf militärischer Abschreckung und Eindämmung gegründet werden können. Frieden ist, wenn er nachhaltig sein soll, immer auch auf Interdependenz und Kooperation in gemeinsamen Institutionen angewiesen. „Zurück auf Null“ sollte mithin nicht heißen, alles umzuwerfen und neu zu machen, sondern aus Fehlern zu lernen und eine kooperative Sicherheitsordnung 2.0 intellektuell und praktisch vorzubereiten.
In einem ersten Schritt stellt sich dabei die Frage, wie wir überhaupt an diesen Punkt kommen konnten, an dem ein Nuklearkrieg in Europa wieder eine reale Gefahr geworden ist. Um diese Frage zu beantworten, gilt es kritisch die Fehler zu diskutieren, die dem Westen bzw. westlichen Regierungen unterstellt werden und die als Ursache für diesen Krieg breit geteilt werden. Diese Fehler sind jedoch, wie ich nachweisen möchte, weit weniger eindeutig oder drastisch zu bewerten als in der Debatte dargestellt. Vor allem aber dienen sie dazu, die Leistungen der kooperativen Sicherheitsordnung völlig auszublenden. Nimmt man diese Leistungen ernst, so zeigt sich, dass Abschreckung und Kooperation eng aufeinander bezogen werden müssen, wenn wir eine nachhaltige Friedensordnung etablieren möchten. Daher kommt es heute auf kontrollierte Entflechtung und Koexistenz an – als Basis einer künftigen Ordnung in Europa.
Gründe und Abgründe des gegenwärtigen Konflikts
Mit Blick auf Putins Krieg in der Ukraine überschlagen sich viele Kommentatorinnen geradezu darin, die Naivität und das Versagen des Westens als Gründe des Kriegsausbruchs zu markieren. Natürlich ist es in der Rückschau immer besonders verführerisch, markante Wendepunkte als Fehler zu markieren, die zu diesem Krieg geführt haben. Dabei fallen zwei Kritikstränge besonders ins Auge, die gemeinhin recht wenig miteinander zu tun haben.
Der erste geht davon aus, dass der Westen Putins Aggression jahrzehntelang unterschätzt oder sogar ignoriert habe. Tschetschenien, Georgien, Moldau oder Syrien werden in diesem Strang als klare Belege eines konstanten russischen Expansionsdrangs verstanden. Spätestens mit der russischen Annexion der Krim, so das Argument, hätte der Westen aufwachen und der russischen Annexion entgegentreten müssen. Stattdessen habe man aber, nicht zuletzt, um die Aussichten auf billige Energieimporte nicht zu riskieren, mit Appeasement auf die russische Aggression reagiert statt mit Abschreckung und Eindämmung. Dieser Kritikstrang verweist auf Putins eigene Texte und Reden über ein neues russisches Imperium und seine Verneinung eines Staatsanspruchs der Ukraine, die alle lang bekannt waren und die er jüngst in seiner Rede anlässlich des 9. Mai wiederholt hat, als er davon sprach, dass Nato-Truppen historisch russischen Boden bedroht hätten.[4]
Der zweite Kritikstrang entspringt eher der Realistischen Denkschule der Internationalen Beziehungen. Dabei geht es gerade nicht um die Aggression Putins, sondern um die des Westens, allen voran der USA, ihren Einflussbereich vermittels der Nato immer weiter in den Osten und damit an die Türschwelle Russlands ausgedehnt zu haben. Der Fehler des Westens liegt demzufolge darin, übersehen zu haben, dass Russland als Großmacht keinen an den Westen orientierten Staat an seinen Grenzen dulden würde. Diese Kritik verweist auf die berühmte Brandrede Putins auf der Sicherheitskonferenz 2007, in der er die Nato eindrücklich davor warnte, Georgien oder die Ukraine als Mitglieder zu akzeptieren.[5] Der Krieg mit Georgien 2008 und die Annexion der Krim 2014 sowie die Destabilisierung im Donbass waren in dieser Perspektive klare Signale, dass rote Linien überschritten wurden, die der Westen aber leichtfertig ignorierte. Der Westen hat insofern die Realitäten von Großmachtpolitik nicht beachtet und dafür muss die Ukraine nun den Preis zahlen. „It’s not imperialism; this is great-power politics“, wie John Mearsheimer es so prägnant im Interview mit dem „New Yorker“ formulierte.[6]
Es waren also entweder das Appeasement gegenüber Russland oder die Aggression gegenüber Russland, die diesen Krieg (mit-)hervorgebracht haben. Keiner der beiden Kritikstränge ist gänzlich von der Hand zu weisen, denn der starke Wunsch nach billigen Energieimporten ist ebenso wenig bestreitbar wie die mehrfachen Osterweiterungen der Nato, obwohl hinlänglich bekannt war, dass Russland diese ablehnte.[7] Zugleich sind diese entgegengensetzten Ursachen ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Lektionen aus der Geschichte oftmals weniger eindeutig sind, als viele meinen. Wir wissen nämlich nicht, ob wir heute nicht in derselben Situation wären, hätten wir Russland schon in den 2010er Jahren deutlicher abgeschreckt oder Georgien und der Ukraine 2008 keine Beitrittsperspektive zur Nato eröffnet. Vielleicht wäre ein Krieg dann früher ausgebrochen, vielleicht später, vielleicht auch woanders oder ganz anders. Wir wissen es nicht. Was beide Kritikstränge aber dennoch eint, ist, dass sie beide die Idee kooperativer Sicherheit in Europa mitverantwortlich machen für das Versagen des Westens. Dabei übersehen sie aber sehr großzügig alle Leistungen dieser Ordnung. Mit der Implosion der Sowjetunion bzw. des Ostblocks in den späten 1980er Jahren setzte die strategische Debatte über den Umgang mit der Sowjetunion ein: Containment oder Integration war eine der zentralen Fragen. Während es durchaus Stimmen gab, die für ein weiteres Containment der Sowjetunion warben, um ihre damalige Schwäche ausnutzen zu können, setzten sich diejenigen durch, die für deren Integration in eine gemeinsame kooperative Sicherheitsordnung argumentierten. Letztlich war es auch das Ziel einer raschen Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten, die der Integration und das heißt einer kooperativen Sicherheitsstruktur in Europa den Vorzug gab. Denn ohne sowjetische Zustimmung wäre das nicht möglich gewesen.
Mit der Transformation der Schlussakte von Helsinki aus dem Jahr 1975 in ein bindendes Vertragssystem, niedergelegt und umgesetzt durch die Charta von Paris von 1990, die OSZE und den Europarat, wurde eine neue Ordnung etabliert, „ein gemeinsames Haus Europa“, wie Gorbatschow es nannte, das auf den Pfeilern territorialer Integrität, souveräner Gleichheit und der Pflicht zur friedlichen Konfliktbeilegung gründet.[8] Diese kooperative Sicherheitsordnung, abgestützt durch gemeinsame Rüstungskontrollabkommen und vertrauensbildende Maßnahmen sowie die Förderung von Demokratie und Menschenrechten auf dem Kontinent, schaffte die Rahmenbedingungen für den Übergang zu einer Friedensordnung in Europa:[9] Sie ermöglichte ein Ende des Rüstungswettlaufs zwischen West und Ost, die Liberalisierungs- und Demokratisierungswellen in Ost- und Mitteleuropa, und sie sorgte für die schnelle Wiedervereinigung zwischen DDR und Bundesrepublik. Ohne Bekenntnis zu kooperativer Sicherheit wäre das in dieser Zeitspanne nicht denkbar gewesen.
Die kooperative Sicherheitsordnung hat nicht gehalten, daran gibt es keinen Zweifel. Die Probleme setzten bereits Ende der 1990er Jahre ein und verschärften sich in den 2000er Jahren. Ein Grund dafür waren auch die sukzessiven Erweiterungen von Nato und EU. In den 1990ern war das noch händelbar, weil die Nato die Konsultation mit Russland über ihre Erweiterungen suchte und substanzielle Zugeständnisse machte, etwa die Versicherung, keine permanente Truppenstationierung in den osteuropäischen Nato-Staaten vorzunehmen, oder die Einrichtung des Nato-Russland-Rates in Reaktion auf die Aufnahme der baltischen Staaten. Die Rolle der Nato in den Balkankriegen, die immer deutlichere Anlehnung Georgiens und der Ukraine an Westeuropa und die Nato und nicht zuletzt der gefühlte Absturz Russlands als Großmacht (man denke nur an Obamas berühmt gewordene Charakterisierung Russlands als bloße Regionalmacht) sorgten dann allerdings dafür, dass die Spannungen und Krisen sich zusehends verschärften. Vor allem aber wurden unter Putin als Präsident die Androhung militärischer Gewalt und ihre tatsächliche Anwendung wieder möglich in Europa, in Tschetschenien, in Georgien und in der Ukraine seit 2014.
Letztlich hat Putins Invasion der Ukraine die kooperative Sicherheitsordnung in Europa zerstört, aber nicht diese Ordnung war verantwortlich für diesen Krieg. Nein, Putin trägt dafür die Verantwortung. Seine Entscheidung zum Einmarsch in die Ukraine kam nicht zu einer Zeit, in der die Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato virulent gewesen wäre. Ganz im Gegenteil war diese eigentlich vom Tisch, wie der ukrainische Präsident bereits im Kontext der Nato-Gespräche im Sommer 2021 selbst eingeräumt hatte. Eine tatsächliche Sicherheitsbedrohung Russlands gab es mithin nicht. Auch für den von Putin behaupteten Genozid an der russischstämmigen Bevölkerung im Donbas gab es zu keinem Zeitpunkt Anhaltspunkte. Das kaltblütige Zusammenziehen russischer Truppen, die Inszenierung der zahllosen Gespräche, die Staatsoberhäupter, Nato- und EU-Vertreter*innen mit Putin führten, zeigen stattdessen seine Verachtung für die gemeinsamen Normen und Institutionen sowohl der europäischen Sicherheitsordnung als auch der globalen: Der russische Präsident war entschlossen, diesen Krieg zu führen, weil er dachte, damit durchzukommen. Er nahm an, der Westen sei weitestgehend mit sich selbst beschäftigt: Der überhastete Abzug westlicher Truppen aus Afghanistan im Sommer 2021, die durch Corona wundgescheuerten liberalen Gesellschaften und nicht zuletzt die vielen Konflikte in der EU boten eine günstige Gelegenheit, die er willens war zu ergreifen. Gegen einen solchen Aggressor, der gewillt ist, seine Interessen militärisch durchzusetzen, können Normen und Institutionen allein nichts ausrichten. So wenig wie innerstaatliche Normen alle und jedes Rechtssubjekt in jeder Situation dazu programmieren können, sie zu befolgen, so wenig können internationale Normen dies erreichen. Alle politischen Ordnungen kennen solche Aggressoren oder „rogues“, die generell eine sehr geringe Bereitschaft zeigen, sich an gemeinsame Normen und Vereinbarungen zu halten. In staatlichen Ordnungen existieren Strafrecht und Sicherheitsbehörden, um die Gefahren, die diese „rogues“ für andere und gegebenenfalls für die Ordnung als Ganzes bedeuten, einzudämmen. In übernationalen Ordnungen gibt es das internationale Recht und das Völkerstrafrecht, aber keine vergleichbaren Sicherheitsbehörden, die es zentral durchsetzen könnten. Stattdessen ist die Ordnung auf die dezentrale Rechtsdurchsetzung in Form von Sanktionierung und Gewalt durch einzelne Staaten angewiesen, das heißt auf militärische und zivile Zwangsmaßnahmen bzw. deren glaubwürdige Androhung, wie wir es derzeit gegenüber Russland erleben. Worauf sollten nun aber politische Ordnungen gegründet werden? Auf die wenigen „rogues“ oder die durchschnittlichen Regelbefolger?
Das Sonderproblem der Massenvernichtungswaffen
Politische Ordnungen sind vor allem dann stabil, wenn sie sich an den Regelbefolgern ausrichten. Primär auf Repression und entsprechende Überwachung zu setzen, wäre nicht nur enorm kostspielig für die jeweilige Ordnung, es würde darüber hinaus noch die letzten Reste intrinsischer Motivation zerstören, aus der heraus sich Regeladressaten an vereinbarte Normen und Verfahren gebunden fühlen. Und damit ist die normative Qualität einer solchen Ordnung noch nicht einmal angerissen. Im Idealfall dient Repression daher der generellen Vergewisserung aller Mitglieder in einer Ordnung, dass die vereinbarten Regeln für alle gleichermaßen gelten, während im Regelfall Normen aus Einsicht in ihren kollektiven Nutzen befolgt werden können.
In internationalen Ordnungen haben wir es allerdings mit einer anderen Qualität von „Rogues“ zu tun, denn diese verfügen im ungünstigsten Fall über Massenvernichtungswaffen, und es gibt jenseits aller Institutionalisierungsschübe in der internationalen Politik auch kein ähnlich intensives und extensives System von aufeinander bezogenen Verfahren und Institutionen, das die Mitglieder in einer regelmäßigen Interaktion hält. Deswegen stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Einsicht und Zwang in übernationalen Ordnungen noch einmal anders. Das heißt aber nicht, dass sich übernationale Ordnungen allein an diesen „rogues“ ausrichten und rein auf Repression bzw. hier Abschreckung setzen müssen, denn auch hier zeigen die Erfahrungen, dass die ausschließliche Ausrichtung an Abschreckung keine belastbare Grundlage für Stabilität ist. Auch diese Ordnungen sind ausgesprochen kostspielig. Das zeigte sich auch in der Ära des Kalten Krieges, dessen Rüstungswettläufe und Stellvertreterkriege enorme Belastungen für die Volkswirtschaften der Supermächte zur Folge hatten.
Sie sind aber auch, was heute leider oft verdrängt wird, sehr instabil. Die vielen „near misses“ bzw. Beinahe-Katastrophen des Kalten Krieges, die bekannteren davon die Berlin-Blockaden von 1948 bis 1949 und von 1958 bis 1959 oder die Kubakrise von 1961, brachten die Welt mehrfach an den Rand der nuklearen Vernichtung – gerade weil es keine gemeinsamen Normen, Verfahren oder Regeln gab, die es erlaubt hätten, die Absichten des jeweils anderen korrekt einzuschätzen. Dafür hätte es regelmäßiger Kommunikation und eines Rahmens bedurft, in dem sie stattfinden konnte, wie sie sich in der Phase der Detente entwickelte, und der Erfahrung gemeinsamer Erwirtschaftung von Gewinnen, die der Kooperation einen eigenen Wert zuweisen konnten.Auch international sind mithin diejenigen Ordnungen besser aufgestellt, die nicht allein auf Repression und Abschreckung setzen, sondern die zugleich ein Netz gemeinsamer Normen, Regeln und Verfahren pflegen, das die Interaktionen zwischen ihren Mitgliedern strukturiert und in das diese hinein sozialisiert werden. Dazu zählt im weiteren Sinne auch die Förderung von Verflechtung zwischen ihren Mitgliedern, denn diese sind ein wesentlicher Faktor, um das Interesse an Kooperation zu stabilisieren.
Für eine zukünftige Sicherheits- und Friedensordnung wird darum mehr als militärische Abschreckung und Wehrfähigkeit benötigt, auch wenn diese unbedingt geboten sind, um den wenigen, aber potenten „rogues“ zunächst Einhalt zu gebieten und die Gefahr einzudämmen, die von ihnen für andere und für die Ordnung im Ganzen ausgeht. Um nachhaltig stabil zu sein, sind Verflechtung wichtig sowie gemeinsame Normen und Institutionen, um diese zu managen. Angesichts der brutalisierten Kriegsführung des russischen Regimes in der Ukraine und der offensichtlichen Kriegsverbrechen in Mariupol oder Butscha ist diese neue Ordnung gegenwärtig kaum mehr als ein flüchtiger Gedanke. Und dennoch lohnt es sich, den Blick in die Zukunft zu wagen, die mittelfristig vor allem auf kontrollierte Entflechtung und Koexistenz fokussiert sein dürfte. Obwohl der Krieg in der Ukraine im Mai 2022 noch wütet und noch nicht abzusehen ist, wie er enden wird, schälen sich in seinem Schatten die ersten zarten Konturen einer künftigen Europäischen Sicherheitsordnung heraus. Gegenwärtig erleben wir den Abbau der alten Ordnung. Politisch lässt sich das im Ausschluss Russlands aus dem Europarat beobachten oder in russischen Andeutungen, auch die OSZE oder etwa die verbleibenden Rüstungskontrollabkommen stünden zur Disposition. Natürlich sind nicht alle diese Entwicklungen gänzlich neu. Die Regime der Rüstungskontrolle stecken bereits seit Jahren in einer Krise. Alle Bemühungen um eine Neubelebung der Rüstungskontrolle haben mit diesem Krieg aber einen nachhaltigen Dämpfer erhalten.
Wirtschaftlich hat die Entflechtung bereits mit den Sanktionspaketen eingesetzt, die in weiten Bereichen die Entflechtung der Volkswirtschaften vorantreiben. Und auch über die konkreten Sanktionen hinaus ziehen sich immer mehr Firmen aus Russland zurück, um zukünftigen Sanktionen zuvorzukommen oder eine negative Presse zu vermeiden. Schließlich wird auch die längerfristige Entflechtung vorangetrieben, etwa im Bereich kritischer Infrastrukturen und Ressourcen. Diese Form der kontrollierten Entflechtung ist auch notwendig, um zu verhindern, dass Russland die Verflechtung als Druckmittel im Konflikt nutzen kann. Dieses Phänomen einer „weaponized interdependence“ tritt immer dann auf, wenn die wechselseitige Verflechtung extrem asymmetrisch ausgeprägt ist, also eine Seite eine so zentrale Position in einem Netzwerk oder in einer Wertschöpfungskette einnehmen kann (beispielsweise durch die Verfügung über Rohstoffe oder zentrale Technologien), dass sie in der Lage ist, die andere Seite zu erpressen.[10] Russland hat genau dies mit Blick auf die Energieversorgung in Europa angedroht und mit Blick auf Polen und Rumänien bereits angewendet.
Kontrollierte Entflechtung und Koexistenz
Diese Strategie ist aber nicht nur im Falle Russlands zu beobachten. Weaponized interdependence ist weit verbreitet. China hat sie im Bereich der Hochtechnologie genutzt und auch die USA machen davon Gebrauch im Bereich der Finanzmarkttransaktionen, weil sie dort eine zentrale Stellung einnehmen. Ein besonders eindrückliches Beispiel dafür waren die letztlich erfolglosen Bemühungen der Europäischen Union, die Finanzsanktionen der USA gegenüber dem Iran im Streit um das JCPOA auszuhebeln, indem sie einen alternativen Finanzierungsmechanismus entwickeln wollte.[11] Solche extrem asymmetrischen Verflechtungen sind hochproblematisch, weil sie kein Interesse an Kooperation erzeugen oder stabilisieren, sondern an Dominanz. Sie müssen sinnvollerweise durch den Aufbau von Redundanzen und Flexibilisierungen abgebaut werden, um zukünftige Konflikte zu vermeiden oder zumindest nicht zu verschärfen. Interdependenz bzw. Verflechtung erzeugt jedoch nicht automatisch positive Effekte für internationale Ordnungen, entscheidend sind deren Qualität und Form sowie ihre Absicherung. Jede Form der Verflechtung erzeugt immer auch Kosten für die beteiligten Akteure, weil sie deren Handlungsfreiheiten einschränkt. Im Idealfall sind diese Kosten symmetrisch verteilt, aber in der Regel sind sie eher asymmetrisch ausgeprägt. Das ist im Prinzip auch nicht dramatisch, weil sich solche Ungleichgewichte durch weitere Interdependenzen wieder ausgleichen. Je gravierender aber die Asymmetrie, das heißt die Verwundbarkeit, die dadurch für eine Seite erzeugt wird, und je weniger Ausgleich, also Gegenseitigkeit, desto problematischer ist es.[12] Denn dann wird das Ausscheren aus der Kooperation für eine Seite zu einer nahezu risikolosen Strategie, weil die andere Seite keine Möglichkeiten zur Bestrafung hat. Darin liegt auch ein bedeutsamer strategischer Fehler, den man für die Vergangenheit im Umgang mit Putins Russland markieren könnte: Auf Kosten der Sicherheit wurden stark asymmetrische Interdependenzen zuungunsten des Westens eingegangen und es wurde zugleich versäumt, dafür Möglichkeiten der Vergeltung miteinzuplanen. Schwierig wird es, wenn die sinnvolle kontrollierte Entflechtung, das heißt der Abbau extrem asymmetrischer Verflechtungen durch den Aufbau alternativer Lieferketten und eigener Redundanzen, übergeht in eine unkontrollierte Entflechtung, in der wahllos weitere Verflechtungsbeziehungen zerstört werden. Das ist zum einen deshalb misslich, weil eher symmetrische Formen von ökonomischer Verflechtung eben auch Interessen an der Aufrechterhaltung von Kooperation erzeugen, die sich tendenziell daher gegen Konflikte stellen. Zum anderen gibt es auch einen negativen Spillover-Effekt der Entflechtung auf ganz andere Bereiche, etwa Kultur, Kunst oder Wissenschaft. Durch die gegenwärtig zu beobachtende Absage an gemeinsame Programme, Förderungen und Austausch gehen auch Kanäle in die jeweils andere Gesellschaft verloren. Dadurch wird die Fähigkeit geringer, Einblick in die jeweils andere soziale Realität zu nehmen und dadurch auch Empathie füreinander zu entwickeln.
Natürlich muss sich niemand mit Putin aussöhnen oder jenen, die Kriegsverbrechen begangen haben, die Hand reichen; und selbstverständlich muss man keine Institutionen fördern, die offensiv diesen Angriffskrieg unterstützen. Dennoch ist es für die Zukunft von immenser Bedeutung, Kommunikationskanäle offenzuhalten und eine Basis gemeinsamer Interessen zu verteidigen, an die man irgendwann in einer Zukunft nach Putin wieder anknüpfen kann. Um das aber leisten zu können, braucht es zweierlei: Erstens effektive Abschreckung, wie wir sie bereits in der Verstärkung der Verteidigungskapazitäten der Nato-Partner beobachten, wie sie auch das 100 Mrd. Euro Sondervermögen anvisiert, und wie sie sich noch im Ausbau und der Intensivierung der europäischen militärischen Kooperation niederschlagen muss, um „rogues“ in Schach zu halten. Denn ohne basale Sicherheit ist keine Kooperation möglich.
Zweitens braucht es aber auch Institutionen, die einerseits die Abschreckung in Schach halten, indem sie Transparenz zwischen den Seiten erzeugen und einen kommunikativen Rahmen etablieren helfen, der vor Fehleinschätzungen bewahrt, und die andererseits Verflechtungen absichern, indem sie Verfahren und Ressourcen bereitstellen, die das Ausscheren aus Kooperation effektiv sanktionierbar machen. Ein mögliches Ausscheren aus der Kooperation muss beobachtet und dann auch bearbeitet werden können, so dass alle „Partner“ sicher sein können, dass sie bei einem Ausscheren schwerwiegende Konsequenzen zu erwarten haben – und dass zugleich diejenigen, die kooperieren, dabei nicht „ihren Kopf“ riskieren. Nur dann ist in Zukunft so etwas wie friedliche Koexistenz wieder denkbar – oder eben, noch weiter gedacht, eine neue kooperative Sicherheitsordnung.
Ja, wir sind wieder zurück auf Null. Doch angesichts der gewaltigen Herausforderungen, vor denen die Weltgemeinschaft steht – die drängendste zweifellos die Abwendung der Klimakatastrophe –, können wir es uns schlicht nicht leisten, lange an diesem Nullpunkt stehen zu bleiben.
Eine Vorfassung dieses Artikels – „Für den Frieden rüsten? Die Zeitenwende für eine nachhaltige Friedensordnung in Europa“ – ist am 6. April im Verfassungsblog erschienen, www.verfassungsblog.de (DOI: 10.17176/20220407-011248-0).
[1] Ursula Weidenfeld, „Wandel durch Handel“? Dieser epochale Irrtum trifft Deutschland besonders hart, www.welt.de, 18.4.2022.
[2] „Weltfrieden ist eine Illusion“: Star-Politologe Herfried Münkler rät der EU zu eigenen Atombomben, www.luzernerzeitung.ch, 2.3.2022.
[3] Jürgen Habermas, Krieg und Empörung, in: „Süddeutsche Zeitung“, 28.4.2022.
[4] Putins Rede am „Tag des Sieges“, www.tagesspiegel.de, 9.5.2022.
[5] Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf der 43. Münchner „Sicherheitskonferenz“ in deutscher Übersetzung, www.ag-friedensforschung.de.
[6]Isaac Chotiner, Why John Mearsheimer blames the U.S. for the crisis in Ukraine, www.newyorker.com, 1.3.2022.
[7] Mary Elise Sarotte, Not One Inch: America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate, Yale 2021.
[8] Michail Gorbatschow, Das gemeinsame Haus Europa und die Zukunft der Perestroika, Düsseldorf 1990.
[9] Statt vieler: Ines-Jacqueline Werkner und Martina Fischer (Hg.), Europäische Friedensordnungen und Sicherheitsarchitekturen, Wiesbaden 2018.
[10] Henry Farrell und Abraham L. Newman, Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion, in: „International Security“, 1/2019, S. 42-79.
[11] Gemeint ist der Joint Comprehensive Plan of Action, das Nuklearabkommen zwischen den P5 plus Deutschland und dem Iran, den die USA unter der damaligen Trump-Administration 2018 aufkündigte.
[12] Der Klassiker hierzu nach wie vor Robert O. Keohane und Joseph S. Nye, Power and Interdependence: World Politics in Transition, Boston 1977.