Von der Aktualität des großen Friedensphilosophen zu seinem 300. Geburtstag
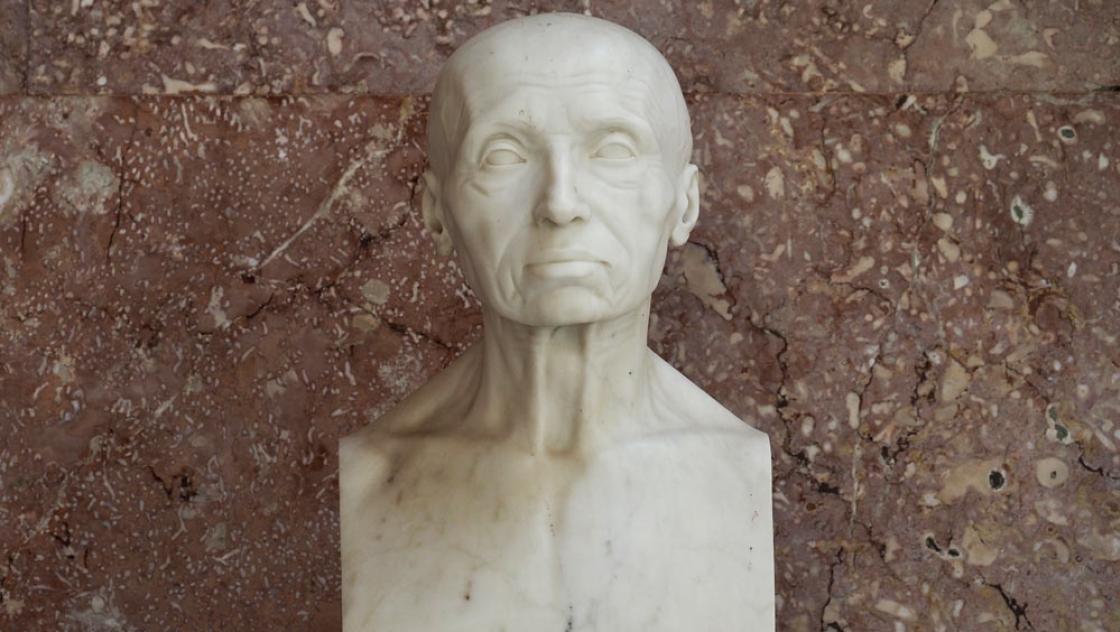
Bild: Büste von Immanuel Kant in Donaustauf, 12.9.2022 (IMAGO / Claudio Divizia / Panthermedia)
Selten schienen die Zeiten ungünstiger für den Universalismus Immanuel Kants und speziell für seine Ideen „Zum Ewigen Frieden“ als im Jahr seines 300. Geburtstags am 22. April 2024. Vor gut zwei Jahren hat Russland die Ukraine mit der Absicht überfallen, die angeblich faschistische Regierung in Kiew zu stürzen und das Land zu annektieren. Mittlerweile tobt ein Territorialkrieg in Osteuropa, von dem man befürchten muss, dass bald weitere Länder in ihn hineingezogen werden. Im Nahen Osten hat die Terrororganisation Hamas über tausend Menschen niedergemetzelt und über zweihundert entführt, in der großen Mehrheit Zivilisten. Israel beantwortet die Anschläge mit einem Feldzug, der den Gazastreifen in Schutt und Asche legt und eine humanitäre Katastrophe ausgelöst hat. Die Vereinten Nationen, blockiert im Sicherheitsrat, zeigen sich bei alledem ohnmächtig; und die Europäische Union ist hochgradig uneins. Schlechte Zeiten also für Friedenspläne, Abrüstungsvorschläge und Verhandlungslösungen. „Der Traum, militärische Macht durch wirtschaftliche Macht zu ersetzen und internationale Politik mit Gratifikationen, Sanktionen und internationalen Schiedsgerichten zu steuern, ist ausgeträumt“, so Herfried Münkler in seinem unsentimentalen Nachruf auf die Vision einer internationalen Staaten- und Friedensgemeinschaft.[1] Es tue für Europa not, die Frage der Macht – und zwar der militärischen Macht – endlich anzunehmen und sich zum Akteur mit nuklearem Abschreckungspotential zu machen.
Dies mag für den Moment so erscheinen, und angesichts der Rhetorik aus dem Kreml ist der Wunsch nach einer militärischen Verteidigungsbereitschaft gut zu verstehen. Das von Münkler avisierte „System der fünf Mächte“, das „Weltordnungsdirektorium“, das in einer globalen Neuauflage des Konzerts der Mächte eine geopolitische Balance herstellen soll,[2] kann jedoch nicht erreichen, was es zu erreichen verspricht: Sicherheit für ein demokratisches Europa und Entwicklungspfade zur Demokratie. Schon das erste europäische Konzert der Mächte nach dem postnapoleonischen Wiener Kongress erreichte seine Stabilität durch die Ausschaltung der demokratischen Bewegungen und fand darin sozusagen seinen Gründungsgedanken. Das Konzert der Mächte beließ den monarchischen Herrschern gleichermaßen das Recht zum Kriege und zur alleinigen Gesetzgebung, die äußere und die innere Souveränität. Es endete bekanntermaßen im Ersten Weltkrieg. Ein modernes System der fünf Mächte, bestehend aus China, Russland, Indien, den USA und der EU, dürfte den herrschenden autokratischen Trend in den USA und der EU nur weiter verstärken. Im Konzert der Mächte wollen Regierungen mit ähnlicher Ellbogenfreiheit „Deals“ machen können wie die Präsidenten Russlands und Chinas – und wie möglicherweise ab dem 5. November auch wieder die Vereinigten Staaten unter Donald Trump. Wer dagegen heute die Demokratie wehrhaft verteidigen will, muss die Wechselwirkung von demokratischer und internationaler Ordnung in den Blick nehmen. Eben das tat Immanuel Kant und daher ist er keineswegs so überholt, wie es manche vorschnell verkünden.
Vom Eskalationsvorteil der Despotien
Es ist vielleicht weniger die Angst vor dem Atomkrieg, die jüngere Generationen nicht mehr so recht kennen, als vielmehr das Unvermögen, sich eine konventionelle Eskalation vorzustellen, die Jürgen Habermas angesichts des Stellungskriegs in der Ukraine beobachtete, der ihn an die Schlachtfelder Verduns erinnerte.[3] Als Habermas im Februar 2023 seinen zweiten Text zum Ukrainekrieg veröffentlichte, war gerade die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine beschlossen worden, die als kriegsentscheidend beschrieben worden waren. Heute wird über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern gestritten, ohne die die Ukraine die Übermacht Russlands nicht ausgleichen könne. Auf Waffe folgt Waffe. Auf die darin liegende Eskalationsgefahr wies Habermas hin und mahnte eine Verantwortung der waffenliefernden Länder an, eine solche Eskalationsspirale zu verhindern.
Auch Habermas vertrat die Position, dass die Ukraine den Krieg nicht verlieren dürfe. Er machte aber zugleich darauf aufmerksam, dass Russland diesen Krieg konventionell wohl kaum verlieren werde. Bevor dies geschehe, müsste mit einem Atomschlag gerechnet werden. Wer Waffen liefere, müsse sich daher gleichzeitig für Verhandlungen einsetzen.
Habermas wurde erwidert, man könne nur aus einer Position der Stärke mit Russland erfolgreich Verhandlungen führen, daher müsse der Krieg so lange geführt werden, bis Russland erschöpft sei. Ein Jahr später zeigt sich, dass die Ukraine der Erschöpfung näher ist als Russland und dass immer neue Waffensysteme und immer neue Einberufungen nötig sind, um die aktuelle Stellung zu halten. Hier zeigt sich: In einer kriegerischen Eskalationsspirale haben Despotien gegenüber Demokratien immer einen Vorteil. Demokratien müssen auf die Zustimmung der Bevölkerung bauen und können Maßnahmen nicht einfach durchsetzen. Zwar muss auch Putin überlegen, welche Belastungen er seiner Bevölkerung zumuten kann. Ihm aber nutzt der Krieg, steigern seine Eroberungen doch seine Popularität, und im Zweifelsfalle stehen ihm mehr repressive Mittel zur Verfügung als der Ukraine. Insofern stellt sich, auch wenn es dem Gerechtigkeitsempfinden widerspricht, die Frage: Ist die Herstellung einer vorteilhaften Verhandlungsposition für die Ukraine, nämlich die einer militärisch überlegenen Position, nicht von vornherein eine unrealistische Vorstellung, wohingegen die Akzeptanz des Kräfteungleichgewichts der realen Lage weit eher entspricht und daher Verhandlungen wünschenswert erscheinen?
Wie schafft man Vertrauen im Krieg?
Auch Kant argumentierte in und aus einer Situation des Krieges, als er 1795 seine Schrift „Zum ewigen Frieden“ veröffentlichte. Konkreter Anlass war der soeben geschlossene Basler Frieden zwischen Preußen und Frankreich: Nicht länger wollte sich Preußen in die Verfassung Frankreichs einmischen, nicht länger Frankreich die Revolution expansiv vorantreiben. Die Vorzeichen waren insofern gänzlich andere als heute, da momentan kein Friedensschluss in Sicht ist. Damals wollte der Philosoph aus Königsberg einer erschöpften Öffentlichkeit und kriegsmüden Herrschern den Weg zu einer dauerhaften friedlichen Koexistenz aufzeigen, die über den konkreten Frieden von Basel hinauswies. In Form eines Vertrages legte Kant die Grundsätze eines künftigen Völkerrechts dar. In sechs Präliminarartikeln formulierte er Verbote von Praktiken der Kriegsvorbereitung und Kriegsführung, nämlich stehende Heere (Präliminarartikel 3), Schulden für Krieg (Präliminarartikel 4) und den Tausch von Ländern (Präliminarartikel 2). Der Friedensschluss soll aber auch die Politik des Regime Change beenden, ob als Demokratie- oder als Diktaturexport. Kant verewigte diesen Schritt im fünften Präliminarartikel der Friedensschrift, der bestimmt: „Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines andern Staats gewalttätig einmischen.“[4]
Hier erweist sich, dass Kant keineswegs jener weltfremde Idealist gewesen ist, zu dem einige ihn seit Jahrhunderten deklarieren. Im Gegenteil: Der Realist Kant zügelt das Verlangen, den Schurken mit allen Mitteln besiegen und bestrafen zu wollen, weil er weiß, dass das einen künftigen Frieden unmöglich macht. Er wendet sich gegen die Idee, dem geschlagenen ungerechten Feind eine neue Regierung oder eine neue Verfassung zu geben. Er präferiert eigene Wege zur Demokratie statt Regime Change. Auch dies ist eine Deeskalationsstrategie, denn es verhindert, dass der ungerechte Feind (lies: Russland) nicht nur gegen seine Niederlage ankämpft, sondern der Despot sein Schicksal mit dem des Landes untrennbar verknüpft und einen Krieg bis zum Letzten führen wird, weil er genau weiß, dass ihn andernfalls nur der Galgen oder das internationale Strafgericht erwartet. Auf dieser Grundlage bleibt Vertrauensbildung auch im Krieg möglich. Die einfache Regel lautet: Auch im Krieg müssen wir an die Zeit nach dem Krieg denken und wie wir einen möglichen Friedenszustand erreichen können. Diesen Moment, so erinnern uns Kant wie Habermas, müssen wir auch anstreben, während die Waffen noch sprechen. Was aber geschieht, wenn der Gegner genau dies unterläuft?
„150 Jahre vor Erfindung der modernen Massenvernichtungswaffen hat Kant die Eskalationslogik eines Krieges erkannt, in dem durch extreme Handlungen – oder auch nur deren Androhung – das Grundvertrauen in die Möglichkeit eines Friedensschlusses untergraben wird“, schreibt Jörg Lau anlässlich von Kants Geburtstag.[5] Der „Zeit“-Redakteur denkt dabei an die Massaker russischer Soldaten in Butscha oder der Hamas-Terroristen in Israel und deutet jene Massaker als Versuche, das Vertrauen der Gegenseite in die eigene Berechenbarkeit zu zerstören und so den Krieg maximal zu eskalieren. Auch dies verweist auf den Vorteil, den Despotien in der Eskalation sehen. Doch während Lau nicht auflöst, was das für die eigene, die demokratische Seite bedeutet, bleibt Kant die Antwort nicht schuldig: Auch gegen einen „ungerechten Feind“, nämlich jenen Staat, der den Krieg „völkerrechtswidrig“ begonnen oder geführt hat, seien nicht alle Mittel zulässig. Im Krieg, so der sechste Präliminarartikel, sind auch gegen den „ungerechten Feind“ jene Mittel verboten, „welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen“.[6] Das bedeutet, dass man, unabhängig vom Verhalten der anderen Seite, immer verpflichtet ist, eine weitere Eskalation zu verhindern.
Wie aber sieht er nun aus, der Weg Immanuel Kants zum Frieden? Im ersten Präliminarartikel erklärt Kant, ein Waffenstillstand sei bloßer „Aufschub der Feindlichkeiten, nicht Friede, der das Ende aller Hostilitäten bedeutet“. Nicht der Waffenstillstand beendet also den Krieg, sondern es bedarf grundlegender Strukturen der Konfliktbearbeitung im Völkerrecht und seinen Institutionen. Kant formulierte die dazu erforderlichen Prinzipien in drei Definitivartikeln aus.
Nie war diese Position einer völkerrechtlichen Konfliktbeilegung aktueller und notwendiger. Aber nicht immer ist populär, was aktuell ist – diese Verwechslung hat die lange Zeit enthusiastische Kant-Rezeption bestimmt.[7] Das gilt vor allem für die 1990er Jahre, als Kants Beschreibung der Französischen Republik als „ein mächtiges und aufgeklärtes Volk“[8] noch umstandslos auf die USA als wohlmeinender Hegemon und als Kernland eines liberalen Völkerrechts übertragen wurde. Doch seit dem 11. September 2001 und dem an-schließenden Scheitern der kriegerischen Interventionen des US-geführten Westens in Afghanistan und im Irak ist diese Variante eines vermeintlichen „Endes der Geschichte“ durch Ausbreitung der Demokratie abrupt abhandengekommen. Dabei war Kant niemals Fürsprecher einer interventionistischen liberalen Weltordnung mit einem Völkerrecht der liberalen Demokratien, wie die Vertreter eines hegemonialen Liberalismus absichtsvoll interpretierten.[9]
Kant wollte Frieden gerade auch zwischen heterogenen Regierungsformen stiften, alles andere wäre zu seiner Zeit nachgerade lächerlich gewesen. Denn, so bereits Kants Grunderkenntnis: Demokratie braucht Frieden, Krieg dagegen fördert Despotismus. Gerade deshalb kommt Putin der Krieg so entgegen, beschädigt der russische Diktator doch indirekt die Demokratie der Ukraine durch aufgeschobene Wahlen, Parteienverbote, Korruption und Not und Elend. Je länger der Krieg dauert, umso mehr werden die Ukraine (und sicher ebenso Russland) auf dem Weg zur rechtsstaatlichen Demokratie zurückgeworfen. Um diesen Kreislauf zu stoppen, bedarf es eines Waffenstillstands, der zum Ausgangspunkt weiterer Entwicklungen werden kann.
Der Krieg hat nichts Heldenhaftes
Kant widersprach ganz grundsätzlich dem zu seiner Zeit gängigen Lob des Krieges: „Der Krieg ist darin schlimm, daß er mehr böse Leute macht, als er deren wegnimmt“, zitiert Kant einen griechischen Philosophen.[10] Ritter und indigene Amerikaner hätten im Krieg zwar noch die Möglichkeit gesehen, Tapferkeit und Mut zu beweisen, und ihn daher begrüßt. Aber für Kant waren diese Zeiten endgültig vorbei. Schon ein Ernst Jünger musste sich größte Mühe geben, in den tosenden Materialschlachten des Ersten Weltkrieges noch Raum für individuellen Mut zu finden, und er fand ihn nur noch in den Stoßtrupps, die im Aufeinandertreffen Mann gegen Mann mit Seitengewehr und bloßen Händen kämpften. Diesem Heldenmut wohnte schon immer ein fahler Selbstbetrug inne. Eher belegt er doch, dass der Krieg die Leute böse macht. Sie werden zu Kämpfern erst gedrillt, dann im Feuer „gestählt“ und lernen so, dass Zurückzahlen die einzige Genugtuung ist, die es in diesem Leiden gibt. Schon deshalb darf der Krieg in Demokratien nicht der Vater aller Dinge sein, muss er, so schnell es geht, beendet werden.
Der Krieg nimmt den Menschen auch ihre Rechte und Würde. Das meint nicht nur die unmittelbar betroffenen Soldaten und Zivilisten. Es meint auch jene, die nicht kämpfen wollen. Für Soldaten, die nicht freiwillig kämpfen, gilt, „daß zum Töten, oder getötet zu werden in Sold genommen zu sein einen Gebrauch von Menschen als bloßen Maschinen und Werkzeugen in der Hand eines andern (des Staats) zu enthalten scheint, der sich nicht wohl mit dem Rechte der Menschheit in unserer eigenen Person vereinigen läßt“.[11] Um dieses Problem zu beheben, sieht Kant zwei Maßnahmen vor: nur Freiwillige kämpfen zu lassen und eine demokratische Entscheidung über den Krieg zu fällen. Dass dies in Despotien nicht gelingt, ist klar. Das Problem ist aber, dass dies im Krieg auch in Demokratien nicht gelingt. Menschen, die gegen ihren Willen kämpfen müssen, werden zu Werkzeugen in den Händen eines andern, nämlich des Staates. Aus diesem Grund müsste es ein Asylrecht für Kriegsdienstverweigerer aller Seiten geben. Und aus diesem Grund verbietet es sich, kriegsunwillige Ukrainer, die nach Deutschland geflüchtet sind, in ihr Heimatland zurückzuschieben.
Die Demokratie verlangt nach Frieden
Die Republik beziehungsweise die Demokratie ist für Kant eine Friedensgarantin, weil in ihr das Volk gefragt werden muss, ob Krieg sein solle oder nicht, und sie in ihrer Verfassung den Verzicht auf expansive Außenpolitik erklärt. Der Verwirklichungsraum von Demokratie sind für Kant jedoch die Staaten. Sie sollen daher nicht in einem Weltstaat aufgelöst werden. Auch hier ist Kant also weit realistischer, als ihm unterstellt wird. Aber Staaten sind, das macht seine Dialektik aus, auch die Friedensgefährder, sie müssen deshalb erstens demokratisiert und zweitens international eingehegt werden. Das bedeutet vor allem, dass ihnen das „Recht zum Kriege“ genommen werden muss. Dazu bedarf es Systeme internationaler Streitbeilegung und kollektiver Sicherheit.
Ob „Krieg sein solle oder nicht“, soll laut Kant von den Bürgern entschieden werden. Gibt es dazu keine Möglichkeit, entscheidet der Staat selbst, das heißt undemokratisch, despotisch – ob im Falle Putins, Erdoğans oder möglicherweise eines vielleicht schon baldigen Tages auch Xi Jingpings.
Das bedeutet heute, im Sinne der Friedensbewahrung: Regierungen müssten ihre Ziele offenlegen, denn erst dann könnte demokratisch beschlossen werden, ob diese Ziele geteilt werden und die Bürger dafür kämpfen wollen. Dann müsste die Regierung sich auch Wahlen stellen, damit erkennbar wird, ob diese Ziele und die ergriffenen Maßnahmen noch geteilt werden.
Kant war also nicht, wie oft unterstellt, der naive Weltstaatsutopist. Im Gegenteil: Kant wollte den Staaten eigene Wege zur Demokratie ermöglichen. Keineswegs sollte Frankreich die Demokratie gewaltsam einführen, auch wenn dies von deutschen Revolutionären begrüßt wurde. Der vorsichtigere Kant wollte zwar die Republik, aber er sah den Makel eines solchen Ursprungs fortwirken und – so würden wir es heute sagen – eine gesellschaftliche Spaltung herbeiführen. Demokratie soll die Möglichkeit haben, sich in der Gesellschaft selbst zu entwickeln, als eine Selbstaufklärung des Volkes.[12] Einmischung von außen ist da wenig hilfreich, weil es die Entwicklung zur Demokratie zu einer internationalen Angelegenheit und damit zu einem potentiellen Kriegsgrund macht. Diese grundlegende Erkenntnis wurde in den letzten dreißig Jahren verdrängt, Regime Change war das Gebot der Stunde im Überschwang der Zeitenwende von 1989/90. Die Folgen sind die massive Ablehnung des Westens in den von Intervention betroffenen Ländern, aber auch in den aufsteigenden BRICS-Staaten, wie auch die Ablehnung der Verantwortung für die Verteidigung der Demokratie in den ehemals intervenierenden USA. Auch hier erweist sich der geduldigere Kant als der weitsichtigere Stratege als jene liberalen und neokonservativen Interventionisten.
Völkerrecht statt Recht zum Krieg
Das wichtigste Ziel Kants ist es, den Staaten das freie Recht zum Kriege zu nehmen. Dies ist sein zentrales und bleibendes Erbe: Staaten, seien sie demokratisch oder despotisch, haben kein Recht, andere Staaten anzugreifen. Einzig die Selbstverteidigung steht ihnen zu. Dieses Argument macht Kant gegen Grotius, Pufendorf und Vattel,[13] aber es gilt auch gegen heutige Theoretiker des gerechten Krieges und gegen Großraumstrategen in der Tradition Carl Schmitts. Und nichts könnte die Richtigkeit der Unangreifbarkeit und Unverletzlichkeit eines jeden Staates deutlicher zeigen als Putins Eroberungskrieg gegen die Ukraine.
In einem schier endlosen „Jahrhundertsatz“ im Zweiten Definitivartikel steckt die gesamte Friedensphilosophie Kants.[14] Seine Kernaussagen lauten: 1. Staaten (im Naturzustand) suchen ihr Recht nicht durch Prozess, sondern durch Krieg. 2. Ein Sieg bedeutet nicht Recht, er ist kein gerechtes Urteil, sondern nur der Zwischenstand eines anhaltenden faktischen Kräftemessens. 3. Ein Friedensvertrag beendet nicht grundsätzlich den Zustand des Krieges, weil immer wieder ein neuer Vorwand zum Krieg gefunden werden kann. 4. Dies ist nicht einmal ungerecht, weil eben in diesem Zustand jeder Staat Richter in eigener Sache ist. 5. Dieser Zustand kann nicht in Analogie zur Staatsbildung aufgehoben werden, Staaten bilden keinen neuen (Welt-)Staat, weil sie innerlich schon eine Verfassung haben. 6. Die Vernunft verdammt den Krieg und fordert den Friedenszustand. 7. Um diesen zu stiften, bedarf es eines Vertrags der Völker, mit dem ein Friedensbund geschlossen wird. 8. Jener Völkerbund beendet das Recht zum Kriege und schafft eine gerichtsähnliche Verrechtlichung des Völkerrechts.
Diese Kantsche Vision hat – nach dem Scheitern des Wilsonschen Völkerbundes – mit der Gründung der Vereinten Nationen 1948 den Versuch einer Umsetzung erfahren. Zentrales Motiv ist dabei der eine Satz: Staaten haben kein Recht zum Kriege. Alle daraus erwachsenden Fragen, wie zum Beispiel, ob Schiedsgerichte schon dem bei Kant angelegten Gericht entsprechen, ob es eine Strafgerichtsbarkeit braucht oder ob das Recht des Bundes auch für Nichtmitglieder gilt, sind Folgefragen, die sich aus der Geltung dieses einen Prinzips ergeben. Aus diesem Satz lassen sich übrigens auch politische Bewegungen wie Pazifismus und Antimilitarismus, aber auch Abrüstungsforderungen, Wehrdienstverweigerung oder Forderungen nach internationalen Schiedsgerichtsverfahren ableiten.[15] Gibt man diesen zentralen Satz vom Verbot des Krieges auf, dann ist – wie uns Putin, aber auch bereits George W. Bush vor 20 Jahren dramatisch belehrt haben – der Weg frei für die mächtigsten Staaten (oder „Imperien“), ihre Expansionspläne zu verwirklichen. Ihre Einhegung kann dann nur durch die Macht der anderen Großmächte geschehen: das Schmittsche Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Will man Russland heute wirksam begegnen, muss man an Kants zentralen Satz festhalten: Staaten haben kein Recht, ihre Nachbarn zu überfallen, deren Verfassungen zu ändern, deren Bevölkerung zu entführen und deren Territorium zu annektieren. Daraus leitet sich das Recht der Ukraine zum Widerstand und zur Verteidigung ab, inklusive der Rückeroberung der verlorenen Gebiete. Doch verbleibt diese Logik, wie Kant sagt, weiter im Naturzustand. Aus dieser Situation hinaus führt nur ein kollektives Völkerrecht mit Kriegsverbot.
Im von Kant anvisierten Völkerbund einigen sich die Staaten darauf, diesen Satz zu befolgen. Sie sollen keine Zwangsgewalt gegeneinander haben. Auch soll es keine zwingende Macht über den Staaten geben. Kant ist dabei sehr vorsichtig gegenüber weiteren Institutionen des Gewaltmonopols, lieber will er die existierenden einhegen. Die angestrebte Gewöhnung an die Rechtsbefolgung beschreibt er wie folgt: von Waffenruhe über Waffenstillstandsverhandlungen zum Friedensschluss zu einem Völkerbund, der durch Schiedsgerichte und Verhandlungsforen Konflikte bearbeiten hilft. Das heißt nicht, dass damit alle Konflikte gelöst sind, und es heißt auch nicht, dass es keinen Krieg mehr geben wird. Es heißt aber, dass damit Institutionen existieren, mittels derer Eskalationen verhindert und belastbare Waffenstillstände vorbereitet werden können. Es ist das Gegenprogramm zur absolutistischen und staatlichen Machtpolitik. Der Kerngedanke ist, dass bloße Macht keinen dauerhaften Frieden erreichen kann, weil sie kein Recht schafft. Das Recht des Stärkeren ist nur ein momentanes Kräfteverhältnis, das nur so lange gilt, bis es erneut herausgefordert wird.[16] Diese simple Wahrheit widerlegt alle Theorien der Machtbalance. Um im Konzert der Mächte bestehen zu können, bedarf es der Macht. Also wird der Erwerb von Macht prämiert und folglich zum Ziel aller, aber insbesondere der mächtigen Staaten – ob es nun zwei oder fünf sind.
Nicht das Völkerrecht, der Internationale Gerichtshof oder die UNO haben zum Angriffskrieg Russlands geführt, sondern sie stehen diesem entgegen. Putin setzte gegen diese Institutionen imperiale Machtpolitik. Ihm nun einen geopolitischen Rahmen zu bereiten, in dem Machtpolitik normalisiert wird, muss seine Politik – und ähnliche Bestrebungen – zusätzlich begünstigen. Es wäre daher ein fataler Fehler, den Universalismus der UNO mit ihren Verfahren für obsolet zu erklären und stattdessen auf ein Gleichgewicht der Mächte zu setzen. Dies würde nicht nur diejenigen ermuntern, ihre Macht einzusetzen und zu erweitern, die keine Skrupel haben, dies zu tun, sondern es würde in ein globales Streben nach neuen Machtpositionen führen, dem kein Einhalt mehr geboten werden könnte. Denn die universalistischen Mittel dazu hätte man leichtfertig aus der Hand gegeben.
Kant und der Globale Süden
Kant hat mit seiner Idee eines Weltbürgerrechts auch jene Gruppen und Länder erfasst, die vom Völkerrecht bis dahin vergessen worden waren und kolonialer Expansion offenstanden: außereuropäische Staaten, staatenlose Nomaden und nichtstaatliche Akteure der internationalen Beziehungen. In Anbetracht dieser vergessenen Bereiche ist das Weltbürgerrecht eine weitere Regelungsebene zwischen dem Recht der Staaten und dem Recht in Staaten, nämlich die Ebene, wo sich Staaten und Bürger begegnen. Eindeutig beklagt Kant „Unterdrückung der Eingebornen, Aufwiegelung der verschiedenen Staaten desselben zu weit ausgebreiteten Kriegen, Hungersnot, Aufruhr, Treulosigkeit, und wie die Litanei aller Übel, die das menschliche Geschlecht drücken, weiter lauten mag“. Europa ist nicht der Heilsbringer der Welt, weder Zivilisation noch Menschenrechte bringt es in ferne Länder und koloniale Besitzungen, sondern Unterdrückung, Hungersnot und Krieg. Daher begrüßt es Kant auch, dass China und Japan die europäischen Händler und Missionare nicht ins Land einlassen, sondern nur unter strengen Auflagen mit ihnen Kontakte pflegen. Anders ist sich gegen die europäischen Staaten nicht zu wehren, „denn die Einwohner rechneten sie für nichts“. Kant verurteilt auch die Sklaverei und wünscht den Handelsgesellschaften ihren baldigen Untergang. Kant ist hier ein Fürsprecher des Globalen Südens, der den denkwürdigen Satz prägt, „daß die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird“. Diese Passagen[17] zeigen, dass es für Kant keine rechtsfreien Räume außerhalb Europas und außerhalb der Staatenordnung geben darf.
Doch bekanntermaßen ist das nicht das einzige Wort Kants zu nichteuropäischen Völkern. In seinen Schriften zum Begriff der Rasse und seinen Vorlesungen zur Anthropologie und Physischen Geographie sind unzählige abwertende Äußerungen über vor allem schwarze Menschen und indigene Amerikaner zu finden, die im Widerspruch zu den Verurteilungen des Kolonialismus in der Friedensschrift zu stehen scheinen.[18] Die Auseinandersetzung über den Stellenwert dieses Widerspruchs überlagert mittlerweile Kants Beitrag zum Frieden. Es wäre aber fatal, wenn dadurch die Kritik Kants an der kolonialen Praxis der Staaten, ihren Kriegen, ihrem Despotismus und ihrem Beharren auf Machtpolitik als irrelevant erschiene. Kants Friedenstheorie ist nicht aufgrund seiner falschen Rassentheorie überholt. Im Gegenteil: Erst durch das Abwerfen dieser falschen Annahmen kommt die ganze Wucht des Arguments zum Vorschein, das heute gerade in der Integration der nichteuropäischen Staaten in ein universales Verhandlungssystem besteht, mit allen Komplikationen, die dies bedeutet.
Es ist klar, dass Kant zu seiner Zeit an einen Bund europäischer Staaten dachte. Selbst den republikanischen Vereinigten Staaten widmete er wenig Aufmerksamkeit. Doch wollte er von diesem europäischen Bund ausgehend alle Konflikte der Welt behandelt wissen. Es ist daher durchaus in Kants Sinne, dass die UNO universale Mitgliedschaft vorsieht und – anders als die EU – keine bestimmte staatliche Verfassung verlangt. Allerdings ist auch das UN-System von der alten Asymmetrie geprägt: Weder aus Afrika noch aus Südamerika gibt es im derzeitigen Weltsicherheitsrat ständige Mitglieder. Dort haben sie nur eine wechselnde Repräsentation. Aber vor allem haben sie Stimmen in der UN-Vollversammlung. Gerade dort zeigt sich, wie sehr sich die Welt geändert hat, dort verschafft sich die Sichtweise des Globalen Südens zunehmend Geltung, setzen die berechtigten Forderungen nach einem dialogischen Kosmopolitismus an.[19] Eine globale Organisation, die diesen Dialog moderieren könnte, wäre eine wesentliche Voraussetzung für die Bewältigung aktueller und künftiger globaler Herausforderungen. Hier wird die Aufarbeitung des Kolonialismus und westlicher Verbrechen noch weit größere Anstrengungen erfordern, um einen echten Dialog zu erreichen.
Gewiss, momentan ist nicht die Zeit für große Reformprojekte; die UNO würde unter der Last solcher Versuche wohl endgültig zusammenbrechen. Aber denkbar wäre, dass ein Verhandlungsformat für aktuelle Konflikte – ob in der Ukraine, in Gaza, aber auch im so tragisch übersehenen Sudan[20] – neben Sicherheitsrat und Vollversammlung etabliert wird, in dessen Rahmen die Konfliktparteien auf neutralem Terrain konkrete Angelegenheiten verhandeln können. Dergleichen könnte klein beginnen, zum Beispiel mit einem Gefangenenaustausch oder einer Feuerpause.
Für all das bietet Kants Friedensschrift bis heute weit mehr als bloß wichtige Anregungen. Seine wiederkehrende Beschreibung als „Idealist“ ist daher vor allem ein Motiv derjenigen, die als Antwort auf den Krieg allein auf militärische Macht setzen. Es sei realistisch, sagen sie, auf Waffen mit mehr Waffen zu antworten. Diesen heillosen Zirkel zu durchbrechen, ist das Ziel und Vermächtnis Kants. Von ihm können wir lernen, dass wir mit dem Kampf gegen den Angriffskrieg in einer langen historischen Auseinandersetzung stehen. Kant liefert uns die Prinzipien, mit denen wir die Positionen der Akteure beurteilen können. Wir werden dazu weiter auf Abrüstung und internationale Abkommen, Verhandlungen und Schiedsgerichte zählen müssen, ob mit Demokraten oder Despoten. Doch wir dürfen hoffen, dass sich der Zynismus der imperialen Kriegstreiber vom Schlage Putins eines Tages selbst entlarvt und dass ihre Argumentation, da auch sie sich auf das Recht berufen, schließlich dem Völkerrecht auf verschlungenem Wege doch noch Geltung verschafft.
[1] Wie bedroht sind wir?, Herfried Münkler im Gespräch mit Rainer Schmidt, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ), 29.2.2024.
[2] Herfried Münkler, Von Putin bis Erdoğan: Wie pazifiziert man die Revisionisten?, in: „Blätter“, 1/2023, S. 61-74.
[3] Jürgen Habermas, Ein Plädoyer für Verhandlungen, in: „Süddeutsche Zeitung“, 14.2.2023.
[4] Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, Text und Kommentar von Oliver Eberl und Peter Niesen, Berlin 2022, S. 15.
[5] Jörg Lau, „Ob Krieg seyn solle oder nicht“, in: „Die Zeit“, 18.2.2024.
[6] Kant, a.a.O., S. 16. Siehe ausführlich Oliver Eberl und Peter Niesen, Kein Frieden mit dem „ungerechten Feind“? Erzwungene Verfassungsgebung im Ausgang aus dem Naturzustand, in: Oliver Eberl (Hg.), Transnationalisierung der Volkssouveränität. Radikale Demokratie diesseits und jenseits des Staates, Stuttgart 2011, S. 219-249.
[7] Siehe die kritische Bestandsaufnahme zum 200. Todestag Kants von Ingeborg Maus, Kants Aktualität und Kants aktuelle Marginalisierung – im Jubiläumsjahr, in: dies. Über Volkssouveränität. Elemente einer Demokratietheorie, Frankfurt a.M. 2011, S. 277-291.
[8] Kant, a.a.O., S. 28.
[9] Siehe Oliver Eberl, Demokratie und Frieden. Kants Friedensschrift in den Kontroversen der Gegenwart, Nomos 2008.
[10] Kant, a.a.O., S. 39.
[11] Kant, a.a.O., S. 14.
[12] Ingeborg Maus, Das Prinzip der Nichtintervention in der Friedensphilosophie Kants oder: Staatssouveränität als Volkssouveränität, in: dies. Menschenrechte, Demokratie und Frieden. Perspektiven globaler Organisation, Frankfurt a. M. 2015, S. 19-61.
[13] Kant, a.a.O., S. 26.
[14] Kant, a.a.O., S. 27.
[15] Karl Holl, Pazifismus in Deutschland, Frankfurt a. M. 1988. Für eine internationale Betrachtung für das 19. Jahrhundert siehe Oliver Eberl, The Cosmopolitan Challenge: Cosmopolitan Ideas in the Eighteenth and Nineteenth Century, in: Howard Williams u.a. (Hg.), London 2023, S. 185-204.
[16] Das war schon Thomas Hobbes klar, weshalb Kant sich sehr eng an dessen Naturzustandsbeschreibung anlehnt.
[17] Kant, a.a.O, S. 31 ff.
[18] Ich habe versucht, die Spannung und die besondere Vorurteilsstruktur von Kant zu erläutern in Oliver Eberl, Naturzustand und Barbarei. Begründung und Kritik staatlicher Ordnung im Zeichen des Kolonialismus, Hamburg 2021, S. 316-361.
[19] Eduardo Mendieta, From imperial to dialogical cosmopolitanism, in: „Ethics & Global Politics”, 2+3/2009, S. 241-258.
[20] Siehe dazu auch den Beitrag von Andreas Bohne in dieser Ausgabe.









