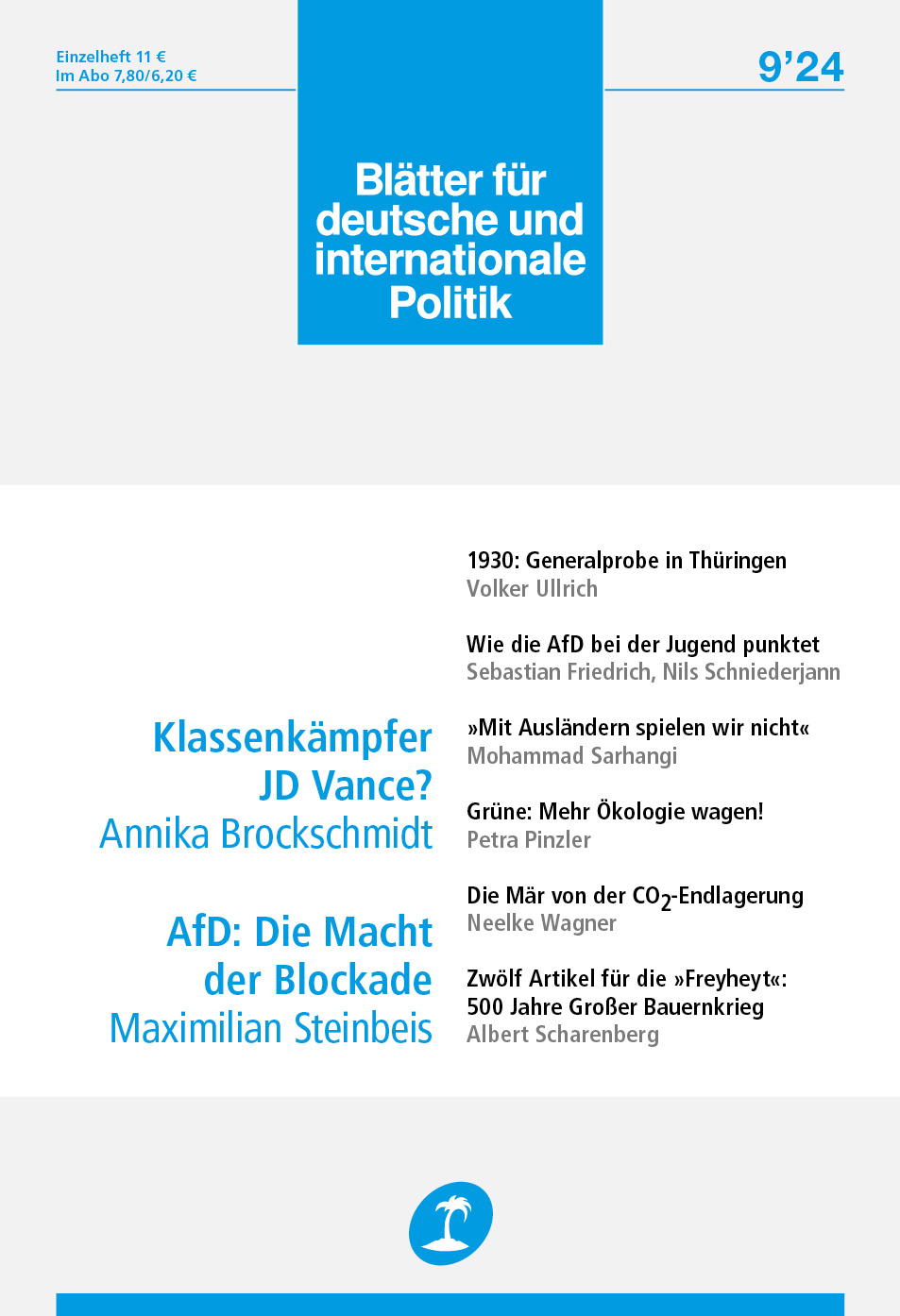Von Gebrauch und Missbrauch der Fotos aus dem Nahen Osten

Bild: Ein Fernsehjournalist im Gazastreifen, 12.5.2018 (IMAGO / Le Pictorium / Michael Bunel)
Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 war ein ebenso gewalttätiges wie bildgewaltiges Ereignis. Noch während des Überfalls kursierten im Internet Fotografien und Videos von Morden, Vergewaltigungen, Folterungen und Geiselnahmen, die die Angreifer mit Handys und Bodycams selbst aufgenommen hatten. Einige davon wurden über die Smartphones der Opfer direkt an deren Kontakte verschickt. Dabei war die Verbreitung der Bilder ganz klar ein Teil der Angriffsstrategie: Sie diente der Terrorisierung der gesamten israelischen Gesellschaft. Seit dem Beginn des darauf folgenden Kriegs im Gazastreifen erreichen uns von dort täglich Fotografien und Videos, die die Ausübung militärischer Gewalt und deren Opfer zeigen. Sie lenken unseren Blick auf das immense Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung, die inzwischen eine fünfstellige Zahl an Toten und ein Vielfaches an Verletzten zu beklagen hat.
Die ganze Region erlebt seit dem 7. Oktober eine Gewaltexplosion, aus der es scheinbar keinen Ausweg gibt. Doch es gibt Wege aus der Eskalationsspirale, nicht nur was die physische Gewalt betrifft. Auch die Ausübung visueller Gewalt und der emotionalisierende Einsatz von Bildern müssen und können eingehegt werden. Dazu gilt es zunächst – und darum soll es hier gehen –, zu differenzieren zwischen Bildern, die den Konflikt aus unterschiedlichen Perspektiven dokumentieren und polarisierend wirken können, und solchen, mit denen eine dezidierte, mitunter gewalttätige Agenda verfolgt wird.
Die Rede von der Kamera als Waffe ist so alt wie die Fotografie selbst. Bereits im 19. Jahrhundert dokumentierten Fotografen Kriege wie den Amerikanischen Bürgerkrieg oder den Krimkrieg. Viele Fotografien wurden zu dokumentarischen Zwecken angefertigt und dienten zunächst der Information der Öffentlichkeit. Doch auch Fotografien, die als Nachrichtenbilder gehandelt werden, können eine stark emotionalisierende Wirkung haben – vor allem dann, wenn sie die Folgen militärischer Auseinandersetzungen für die Zivilbevölkerung zeigen.[1]
Nick Úts im Vietnamkrieg aufgenommenes Foto von Kim Phuc, dem sogenannten Napalm Girl, ist dafür ein gutes Beispiel. Häufig dient es als Beispiel für die hartnäckig durch die Feuilletons geisternde These, Fotografien hätten den Krieg gestoppt. Dafür gibt es allerdings keinerlei Belege. Ausschlaggebend für die Beendigung des Kriegs war die Einsicht, dass man ihn mit militärischen Mitteln nicht gewinnen konnte.
Dokumentation und visuelle Gewalt
Solche Bilder sind, auch wenn sie eine emotionalisierende Wirkung haben, im Kern dokumentarischer Natur. Mit visueller Gewalt haben wir es dagegen zu tun, wenn Gewalt verübt wird, damit man sie zeigen kann, oder wenn Fotografien in der Absicht gemacht werden, Menschen gezielt zu terrorisieren. Adressaten dieser Form von Gewalt sind Menschen, die selbst potenzielle Opfer sind. Das kann eine klar definierte soziale Gruppe sein, zum Beispiel schwarze Menschen, Juden oder Frauen. Die von der Hamas am 7. Oktober verübte visuelle Gewalt richtete sich gegen alle Menschen, die sich gerade auf israelischem Territorium befanden, denn ermordet wurden dort neben jüdischen auch arabische Israelis, Beduinen und Arbeitsmigranten aus Thailand.
Diese Art der Ausübung visueller Gewalt hat eine lange Vorgeschichte. So wurden etwa in den US-amerikanischen Südstaaten Lynchmorde an schwarzen Männern vor Publikum so inszeniert, dass die dabei entstandenen Fotografien anschließend in Form von Postkarten vermarktet werden konnten. Ein jüngeres und besonders einschlägiges Beispiel sind Hinrichtungsvideos des Islamischen Staats, die seit einigen Jahren im Netz kursieren. Die Täter mordeten – nicht nur, aber auch –, um Bilder davon zeigen zu können.
Da unser Gedächtnis nicht über eine Löschtaste verfügt, ist die Ausübung visueller Gewalt sehr nachhaltig. Die Bilder setzen sich im Kopf fest, man wird sie nicht mehr los – vor allem dann nicht, wenn man selbst ein potenzielles Opfer ähnlicher Gewalt ist. Israelische Psychologen haben deshalb schon bald nach dem 7. Oktober ausdrücklich davor gewarnt, die von der Hamas verbreiteten Bilder überhaupt zu sichten. „Ha’aretz“ berichtete, dass das wiederholte Ansehen bei vielen Menschen bereits posttraumatische Belastungsstörungen verursacht habe.[2] Diese Bilder können aber auch ganz anders kontextualisiert werden. Die israelische Armee produzierte binnen weniger Tage einen 43-minütigen Zusammenschnitt der Gewaltvideos vom 7. Oktober. Sie verfolgte damit die Absicht, Beweismaterial für eine Anklage zu produzieren und die Weltöffentlichkeit gegen die palästinensischen Täter in Stellung zu bringen. Gleichwohl hat sich gezeigt, dass Menschen, die die Aufnahmen ohnehin für von der israelischen Regierung produzierte Deep Fakes hielten, in ihrer Haltung eher noch bestärkt wurden. Verschwörungstheorien lassen sich durch Evidenz bekanntermaßen nicht aus der Welt bringen.
Unterdessen hat der Krieg in Gaza ganz andere Bilder in die Öffentlichkeit gebracht: Ein großer Teil der Bilder, die uns seit November 2023 erreichen, zeigt das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Sie feiern nicht die Ausübung von Gewalt, sondern verurteilen sie und rufen zur Solidarität mit den Opfern auf. Auch diese Art der Kriegsfotografie blickt auf eine reiche Bildtradition zurück, für die neben dem bereits erwähnten „Napalm Girl“ zum Beispiel Robert Capas und Gerta Taros Fotografien aus dem Spanischen Bürgerkrieg zu nennen wären.
Capa gründete 1947 mit drei Kollegen die Fotoagentur Magnum, in deren Kreisen in den 1960er Jahren der Begriff des concerned photographers, also des betroffenen und mitfühlenden Fotografen geprägt wurde. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass er (oder sie) Partei ergreift, und zwar stets für die Opfer von Krieg und Gewalt. Concerned photographers fühlen sich der Wahrheitstreue verpflichtet und lehnen die Manipulation von Bildinhalten ab, positionieren sich aber dezidiert durch die Wahl von Motiven, Kontexten und Bildausschnitten – nicht nur im Krieg oder Bürgerkrieg, sondern auch bei der Dokumentation von Gewalt, sozialen Missständen oder, in der jüngeren Vergangenheit, den Folgen des Klimawandels.[3]
In dieser Tradition stehen heute viele Fotografinnen und Fotografen, die für Nichtregierungsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen, Human Rights Watch oder die UNO und ihre zahlreichen Unterorganisationen tätig sind. Sie agieren hochprofessionell, verstehen sich aber nicht als neutrale Beobachter, sondern vertreten die Agenda der jeweils auftraggebenden NGOs. Wenn zum Beispiel die UNRWA, also die für die Versorgung palästinensischer Geflüchteter und ihrer Nachkommen zuständige Unterorganisation der UNO, die Aufgabe hat, das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu dokumentieren, wird sie nicht gleichzeitig das Auge auf das Leid der israelischen Bevölkerung nach dem Massaker vom 7. Oktober richten.
In der Öffentlichkeit dienen die Bilder der Opfer einerseits der Information oder der Beglaubigung von Textnachrichten, die naturgemäß weniger unmittelbar auf das Geschehen verweisen. Sie dienen aber auch der Anklage und der Parteinahme, und im schlechtesten Fall spielen sie die zivilen Opfer in Israel und die zivilen Opfer in Gaza gegeneinander aus, vor allem indem sie das Leid der jeweils anderen Seite systematisch ausblenden.
Fragen der Bildethik
Erstaunlich wenig Beachtung finden dabei bildethische Fragen: Die meisten der dargestellten Opfer werden nicht gefragt (oder können nicht mehr gefragt werden), ob sie der Verbreitung der oft entstellenden Bilder im Netz oder in der Presse zustimmen, und das ist sowohl in juristischer als auch in bildpolitischer Hinsicht problematisch. Das deutsche Recht kennt seit 1907 das „Recht am eigenen Bild“, auf dessen Grundlage Menschen die Publikation von Fotografien, auf denen sie zu sehen sind, verhindern oder sanktionieren können. Aber bei einer Verbreitung über digitale Netzwerke können Betroffene nur darauf hoffen, dass deren Betreiber der Aufforderung nach Entfernung des Fotos nachkommen. Längst haben wir uns deshalb daran gewöhnt, alles Mögliche im Netz zu sehen, was dort – zumindest nach deutschem Recht – eindeutig nicht hingehört. Gleichwohl ist die Frage nach der Legitimität der Verbreitung von Fotografien, die aktuell zivile Opfer im Gazastreifen zeigen, nicht einfach zu beantworten. Denn meist sind es die Opfer selbst oder deren Hinterbliebene, die die Veröffentlichung begrüßen oder gar forcieren. Sie verstehen die Publikation nicht als einen Akt der Entwürdigung, sondern als einen Akt der Würdigung der Opfer von Krieg und Gewalt.
Die Zeitschrift „New Yorker“ veröffentlichte deshalb unlängst unter dem Titel „The Dead Children We Must See“ („Die toten Kinder, die wir sehen müssen“)[4] einen Aufruf, sich den Bildern von toten Kindern nicht zu entziehen, wobei der Hinweis auf Bilder von toten israelischen und palästinensischen Kindern in diesem Fall dazu dient, zu den Opfern von Amokläufen in amerikanischen Schulen überzuleiten. Die Frage, warum gerade die Bilder von toten Kindern gezeigt werden sollen, lässt der Autor dabei letztlich offen. Ein Verweis auf das enorme Mobilisierungspotenzial reicht hier nicht aus. Im Gegenteil: Die Verbreitung der Bilder bleibt nicht nur ethisch fragwürdig, sie beschleunigt – beabsichtigt oder unbeabsichtigt – die Verbreitung visueller Fake News, für die sie die Datenbasis liefert. Denn KI-generierte Bilder spielen inzwischen auch im Nahostkonflikt eine zentrale Rolle.
Visual Fake News
Als „millionenfach gesehen“ beschreibt die „Deutsche Welle“ unter anderem ein Bild von zwei kleinen Jungen in identischen Schlafanzügen, die am Boden eines Zelts schlafend im Schlamm liegen.[5] Vieles weist darauf hin, dass es sich nicht um Fotografien, sondern um KI-generierte Bilder handelt. Zu erkennen ist das daran, dass das Licht unrealistisch ist und dass ein Fuß nur vier Zehen, eine Hand dafür sechs Finger hat. Die Intention, mit der diese Bilder verbreitet werden, ist möglicherweise die gleiche, mit der „echte“ Aufnahmen von Kriegsopfern gezeigt werden. Doch solche Bilder unterminieren nicht nur das Vertrauen in die Fotografie als dokumentarisches Medium. Wer sie produziert und verbreitet, bringt wissentlich Falschnachrichten in Umlauf und trägt damit zur weiteren Eskalation des Konflikts bei.
Als problematisch erweist sich dabei bereits der Umstand, dass wir für fotoähnliche, aber KI-generierte Bilder noch nicht einmal einen tauglichen Begriff haben. Sie sehen „echten“ Fotografien nur deshalb zum Verwechseln ähnlich, weil große Mengen von Fotografien die Datenbasis für diese Rechenoperationen liefern. Tatsächlich aber sind sie eher postmoderne Genrebilder, die gefühlte Wahrheiten in Bilder übersetzen, sich deshalb gut für die Verbreitung in Social Media eignen und dort vor allem diskrepanzverstärkend wirken sollen. Damit soll keineswegs gesagt werden, dass alle außerhalb professioneller Redaktionskontexte verbreiteten Bilder unter Manipulationsverdacht zu stellen sind. Im Gegenteil: Manchmal sind die Aufnahmen, die zufällig anwesende Personen mit Smartphones machen, sogar besser geeignet, Gewalttaten und Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren, denn ihre Produzenten sind schneller und in größerer Zahl vor Ort als professionelle Fotografen. Das gilt für das Massaker vom 7. Oktober ebenso wie für mutmaßliche Kriegsverbrechen im Gazastreifen. Redaktionell verwendet werden sollten sie jedoch nur, wenn es von einer Szene mindestens zwei verschiedene Aufnahmen mit übereinstimmenden Geodaten gibt.
Agenten der Bilder
Bilder erschaffen sich nicht selbst. Hinter ihnen stehen Menschen, die sie produzieren, bearbeiten, auswählen, kaufen und verkaufen, publizieren, zensieren, archivieren oder mit Preisen auszeichnen. Sie entscheiden darüber, was andere Menschen zu sehen bekommen und was sie nicht zu sehen bekommen. Neben den Tätern und Opfern von Gewalt sind das vor allem professionelle Fotografinnen und Fotografen, die allerdings für sehr unterschiedliche Institutionen arbeiten.
Zu dieser Gruppe gehören zunächst Fotojournalisten und -journalistinnen, die für Nachrichtenagenturen wie Reuters oder Associated Press (AP) oder für große Tageszeitungen wie die „New York Times“ unterwegs sind. Sie sind einem Arbeitsethos verpflichtet, das es verbietet, Bildinhalte zu manipulieren, also zum Beispiel Personen oder Gegenstände zu entfernen oder hinzuzufügen. Es sind zahlreiche Fälle bekannt, in denen Fotografen fristlos entlassen wurden, weil sie Bildinhalte per Photoshop verändert hatten. Das heißt nicht, dass es Manipulationen jenseits der ästhetischen Nachbearbeitung nicht gäbe. Aber im Nachrichtenbildgeschäft werden sie streng sanktioniert, denn für die Echtheit von Nachrichtenfotos bürgen die jeweiligen Auftraggeber mit ihrem Namen.
Neben den Pressefotografen sind an der Bildproduktion aber auch Akteure beteiligt, die dezidiert Partei ergreifen. Neben den bereits genannten concerned photographers sowie jenen, die für Nichtregierungsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen arbeiten, sind auch staatliche und parastaatliche Bildproduzenten parteiisch, seien es die Fotografen des Israeli Government Press Office (GPO) und der israelischen Armee (IDF) oder Fotografen, die für die palästinensische Autonomiebehörde oder die Hamas arbeiten.[6] Dass auch sie einen guten Teil der öffentlich kursierenden Bilder liefern, ist den meisten Bildrezipienten wohl nicht bewusst. Da sie den Zweck verfolgen, sich selbst in möglichst positivem Licht zu präsentieren, stehen auch die von ihnen produzierten Bildmedien im Zeichen der Parteinahme.
Bei der Bewertung von Bildern kommt es also immer auch darauf an, von wem sie in welcher Absicht und in wessen Auftrag produziert wurden. Die zuverlässigsten Quellen sind nach wie vor die Bilder der großen Nachrichtenagenturen, aber gerade sie sind im Kontext des 7. Oktobers massiv unter Beschuss geraten. Bei dem Massaker vom 7. Oktober 2023 waren Fotografinnen und Fotografen der großen Agenturen zunächst aus einem einfachen Grund nicht präsent: Sie hatten mit dem Angriff nicht gerechnet. Diejenigen, die als erste vor Ort waren, gerieten schnell in den Verdacht, vom Angriff gewusst und ihn womöglich sogar unterstützt zu haben. Diese Anschuldigungen haben die Nachrichtenagenturen zurückgewiesen und belegt werden konnten sie bisher nicht. Die Agentur Associated Press gewann vielmehr den vom unabhängigen Reynolds Journalism Institute vergebenen (aber von Nikon gesponserten) Preis „Team Picture Story of the Year“ für eine Serie von 21 Fotografien, die von israelischen, palästinensischen und anderen international aktiven Fotojournalisten aufgenommen wurden und die die Ereignisse vom 7. Oktober ebenso zeigen wie die Kriegsfolgen in Gaza – einschließlich mehrerer Aufnahmen, auf denen getötete israelische und palästinensische Kinder zu sehen sind.[7]
Als herausragendes Einzelfoto wurde dabei eine Aufnahme prämiert, die mehrere Hamas-Kämpfer, mutmaßlich mit der Leiche der an diesem Tag auf dem Nova-Festival ermordeten Deutsch-Israelin Shani Louk, auf der Ladefläche eines Pickup-Trucks zeigt. Formal hätte es sich bei der Publikation der Aufnahme um eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts der Toten handeln können, doch deren Eltern begrüßten die Veröffentlichung und Prämierung des Fotos ausdrücklich. Was dieses Foto mit Aufnahmen von zivilen Opfern des Kriegs in Gaza gemeinsam hat, ist zunächst, dass es in einem Prozess – etwa vor dem Internationalen Strafgerichtshof – als Beweismittel verwendet werden könnte. Vor allem aber dienen die Bilder als Waffen in einem Kampf um Meinungen und Emotionen, in dem die Würdigung und die Entwürdigung der Opfer oft nahe beieinander liegen.
Medien sollten versuchen, mit ihrer Berichterstattung nicht zum Teil dieses Kampfes zu werden. Einfache Zuschreibungen von Täter- und Opferrollen fördern nicht das Verständnis der außerordentlich komplexen Lage im Nahen Osten, sie unterminieren es. Nicht jedes Bild zu zeigen heißt nicht, den Opfern Empathie zu verweigern oder dokumentierte Verbrechen zu leugnen. Es gibt kein einfaches Rezept, um sich der Eskalationsdynamik zu entziehen, aber ein medien- und ideologiekritischer Umgang mit Fotos und Videos ist dafür unabdingbar. Bilder, die deeskalierend wirken können, etwa von Demonstrationen der Organisation Omdim Beyachad, in der jüdische und arabische Israelis sich gemeinsam für einen gerechten Frieden einsetzen, finden wenig Beachtung. Sie zu zeigen, könnte ein Anfang sein. Bilder, die Vereinfachungen fördern und Diskrepanzen verstärken, gibt es schon zuhauf.
[1] Vgl. Annette Vowinckel, Agenten der Bilder – Fotografisches Handeln im 20. Jahrhundert, Göttingen 2016.
[2] Yael Hallak, Israelis Can’t Stop Watching Videos of Hamas Atrocities. The Consequences Are Ruinous, haaretz.com, 25.11.2023.
[3] Vgl. Cornell Capa (Hg.), The Concerned Photographer, New York 1968 und Bd. 2, New York 1972; Nadya Baer, The Decisive Network. Magnum Photos and the Postwar Image Market, Oakland 2020.
[4] Jay Caspian Kang, The Dead Children We Must See, newyorker.com, 28.11.2023.
[5] Jan D. Walter, Faktencheck: Diese Kinder-Bilder aus Gaza sind nicht echt, dw.com, 31.1.2024.
[6] Die Dienste des palästinensischen State Information Service sind allerdings nur in archivierter Form zu finden, siehe archive.org. Das Gleiche gilt für das palästinensische Ministry of Information.
[7] Siehe Team Picture Story of the Year, poy.org. Auch die Auszeichnung World Press Photo of the Year ging an ein von Mohammad Salem für die Agentur Reuters aufgenommenes Foto von einer Mutter in Gaza, die ihr totes Kind in den Armen wiegt, siehe reuters.com.