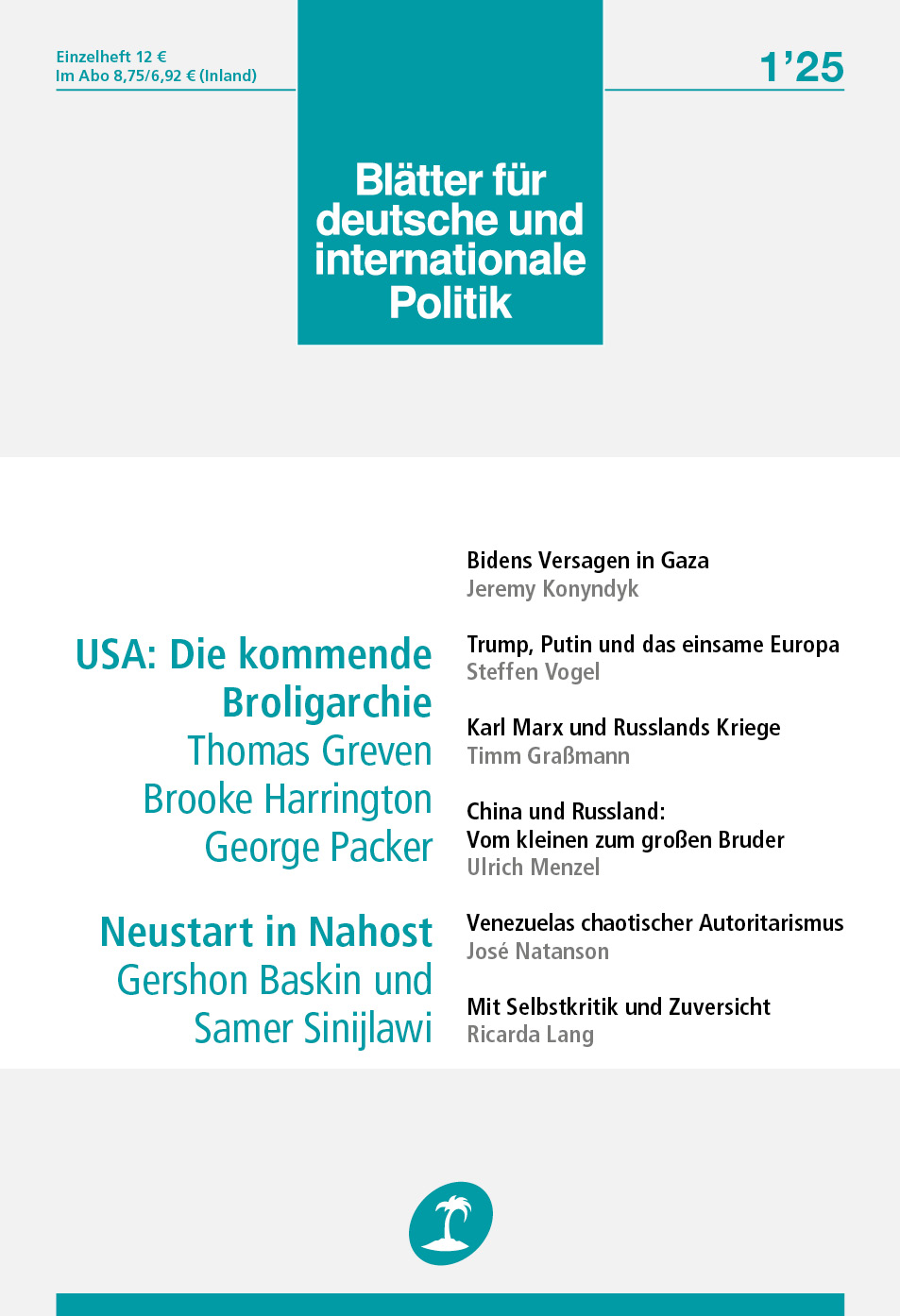Bild: Das Kapitol in Washington DC bei Nacht (IMAGO / Christian Offenberg)
Die Roosevelt-Republik – das fortschrittliche Zeitalter, das die gesellschaftliche Wohlfahrt und die Gleichberechtigung auf einen immer größeren Kreis von Amerikanern ausdehnte – währte von den 1930er bis zu den 1970er Jahren. Am Ende jenes Jahrzehnts wurde sie von der Reagan-Revolution gestürzt, die die individuellen Freiheiten auf der Grundlage einer konservativen Ideologie der freien Marktwirtschaft ausweitete, bis sie ihrerseits an der Finanzkrise von 2008 scheiterte. Der darauf folgenden Ära fehlte lange ein überzeugender Name und eine klare Identität. Man hat sie die Nach-Nach-Kalte-Kriegsära genannt, Postneoliberalismus, die Große Stagnation und in einem Wortspiel mit „Erweckung“ und „woke“ das Great Awokening. Aber die Wahl 2024 hat gezeigt, dass die dominierende politische Figur dieser Periode Donald Trump ist, der am Ende seiner zweiten Amtszeit das amerikanische Leben so lange beherrscht haben wird wie Franklin D. Roosevelt in seinen Dutzend Jahren als Präsident. Wir leben in der Trump-Reaktion. Gemessen an den Maßstäben ihrer Vorgänger, stehen wir noch ganz am Anfang dieser Periode.
Diese neue Ära ist weder progressiv noch konservativ. Das organisierende Prinzip in Trumps chaotischen Kampagnen, die animierende Leidenschaft unter seinen Anhängern, ist eine reaktionäre Wendung gegen den schwindelerregenden Wandel, insbesondere gegen die wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen des vergangenen halben Jahrhunderts: die Globalisierung des Handels und der Migration, der Übergang von einer Industrie- zu einer Informationswirtschaft, die wachsende Ungleichheit zwischen Metropole und Hinterland, das Ende der traditionellen Familie, der Aufstieg zuvor entrechteter Gruppen, der abnehmende Anteil der Weißen an der amerikanischen Bevölkerung. Trumps grundlegender Appell besteht in dem Versprechen, den „Eliten“ und „Eindringlingen“, die diese Veränderungen herbeigeführt haben, die Macht zu entreißen und das Land seinen „rechtmäßigen Eigentümern“ zurückzugeben – den echten Amerikanern. Sein Sieg hat gezeigt, dass dieser Appell in demokratischen wie republikanisch geprägten Bundesstaaten sowie bei allen Altersgruppen und ethnischen Gruppen auf Zuspruch stößt. Zweieinhalb Jahrhunderte lang wurde die amerikanische Politik vom Wechsel zwischen progressiven und konservativen Perioden geprägt und spielte sich zwischen den Torauslinien der liberalen Demokratie ab. Die Werte Freiheit, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit wurden zumindest in Lippenbekenntnissen bekräftigt; die Verfassungsdokumente der Gründerväter genossen den Status einer staatsbürgerlichen heiligen Schrift; die erforderliche Stimmung in den USA war Optimismus. Obwohl die Reaktion schon lange die lokale oder regionale Politik (hauptsächlich in den Südstaaten) dominiert, ist sie auf nationaler Ebene etwas Neues – was erklärt, warum Trump ständig missverstanden und abgeschrieben wurde. Die Reaktion ist isoliert und gekränkt und sie malt ihr Bild von der Welt in düsteren Farben. Sie will den Fortschritt rückgängig machen und die Geschichte umkehren, um das Land in ein imaginäres goldenes Zeitalter zurückzuversetzen, als das Volk regiert habe. Ihre Anhänger wollen einen Machthaber, der stolz die liberalen Frömmeleien jener Eliten, die sie verraten haben, mit den Füßen tritt.
Das ist der Grund, warum so viele Wähler bereit sind, Trumps abscheuliche Sprache und abscheuliches Verhalten zu tolerieren – zuweilen sogar zu feiern –, ebenso wie seine Techtelmechtel mit ausländischen Diktatoren und seine Bereitschaft, Normen, Gesetze, sogar die Verfassung über Bord zu werfen. Auf die Frage von Meinungsforschern, ob sie sich Sorgen um den Zustand der Demokratie machen, antworten diese Wähler mit Ja – nicht weil sie ihren Untergang fürchten, sondern weil sie in ihren Augen bereits versagt hat. Sie glauben nicht, dass Trump die Demokratie zerstören, sondern dass er sie dem Volk zurückgeben wird.
Wo ist die Mehrheit der Minderheiten?
Der Triumph der Trump-Reaktion dürfte mit zwei progressiven Illusionen Schluss machen, die erheblich zu deren Stärkung beigetragen haben. Die eine ist die Vorstellung, dass mit Identität eine politische Bestimmung einhergeht. Lange Zeit betrachtete die Demokratische Partei den demografischen Wandel in Amerika, die kommende „Mehrheit der Minderheiten“, als ein tröstliches Versprechen für Zeiten, in denen, bloß interimsweise, die Republikaner regierten: Da das Land weniger weiß wird, musste es unweigerlich blauer werden, also die Parteifarbe der Demokraten annehmen. Im vergangenen Jahrzehnt ging diese Vorstellung in einem ideologischen Rahmen auf, in einer bei Progressiven weit verbreiteten Weltsicht. Es handelt sich um eine Metaphysik der Gruppenidentität, der zufolge ein verallgemeinertes „People of Color“[1] eine gemeinsame Erfahrung der Unterdrückung teilt, die sein kollektives politisches Verhalten bestimmen und es bei Themen wie Einwanderung, Polizei und Transgenderrechte weit nach links treiben würde.
Die Wahl von 2024 hat diese Illusion zunichte gemacht. Fast die Hälfte der Latinos und ein Viertel der schwarzen Männer haben für Trump gestimmt. In New York City schnitt er in Queens und der Bronx, die mehrheitlich von Nichtweißen bewohnt werden, besser ab als in Manhattan mit seiner Mehrheit an wohlhabenden Weißen. „Keine gute Nacht für die Solidarität“, nannte das Masha Gessen in der „New York Times“. Aber entscheidend ist: Die Annahme einer Gleichgesinntheit immens unterschiedlicher Wählergruppen sollte ebenso verworfen werden wie der Begriff „People of Color“, der jeden Nutzen für die politische Analyse verloren hat.
Neben der demografischen Illusion gibt es auch eine Mehrheitsillusion. Nach dieser Theorie wird die Demokratische Partei durch eine weiße republikanische Minderheit von der Macht ferngehalten, die den Willen des Volkes durch Wählerunterdrückung, Gerrymandering, Gesetzgebung, den Filibuster, die Zusammensetzung des Senats und das Electoral College konterkariert. Das größte Hindernis für das amerikanische Versprechen ist nach dieser Auffassung die Verfassung. Die Vereinigten Staaten müssten also weniger republikanisch und stärker demokratisch werden, durch Wahlreformen und vielleicht einen zweiten Verfassungskonvent, die dem Volk mehr Macht geben. Diese Analyse enthält einige unbestreitbare Wahrheiten – die Stimme der Öffentlichkeit wird durch strukturelle Hindernisse, parteipolitische Machenschaften und enorme Mengen an Plutokratengeld konterkariert. Solange republikanische Präsidenten den popular vote verloren, also landesweit weniger Stimmen auf sich vereinen konnten als ihre unterlegenen demokratischen Rivalen, war das Mehrheitsargument bestechend, auch wenn seine Befürworter die Wahrscheinlichkeit ignorierten, dass eine neue Verfassung weniger demokratisch sein könnte als die alte.
Aber jede Wahl erinnert uns daran, dass das Land gespalten ist – und das schon seit Jahrzehnten –, was zu häufig wechselnden Mehrheitsverhältnissen im Repräsentantenhaus führt. Jetzt, da Trump den popular vote und das Electoral College gewonnen hat, sollte die Mehrheitsillusion ebenso wie die demografische Illusion als das gesehen werden, was sie sind: ein Hindernis für den Erfolg der Demokraten. Sie hat die Partei von der Notwendigkeit entbunden, zuzuhören und zu überzeugen, und stattdessen die Erwartung genährt, die dei ex machina von Bevölkerungswandel und Regeländerungen würden die politische Arbeit erledigen.
Trump sprach für die Entfremdeten, Harris für den Status quo
Wenn die Demokraten eine Präsidentschaftswahl verlieren, verfallen sie in den bekannten Streit darüber, ob die Partei zu weit nach links oder zu weit in die Mitte gerückt sei. Dieses Mal wirkt diese Frage besonders irrelevant, weil das politische Problem so viel tiefer liegt. Die Demokratische Partei befindet sich auf der falschen Seite eines historischen Schwenks hin zum Rechtspopulismus, da wird eine taktische Neupositionierung nicht helfen. Die Stimmung in Amerika, wie auch bei Wählern überall auf der Welt, richtet sich massiv gegen das Establishment. Trump hatte eine Massenbewegung hinter sich, Kamala Harris wurde von den Parteieliten installiert. Er bot Disruption, Chaos und Verachtung, sie bot eine Steuererleichterung für Kleinunternehmer. Er sprach für die Entfremdeten, sie sprach für den Status quo.
Die Demokraten sind die Partei der Institutionalisten geworden. Ein Großteil ihrer Basis ist großstädtisch, hochqualifiziert, wirtschaftlich abgesichert und regierungsfreundlich. Das ist die Folge einer Neuausrichtung, die sich seit den frühen 1970er Jahren vollzieht: Die Demokraten beanspruchen nun die ehemalige republikanische Basis von Berufstätigen mit Hochschulbildung, und die Republikaner haben die Demokraten als Partei der Arbeiterklasse abgelöst. Solange Globalisierung, Technologie und Einwanderung weithin nicht nur als unvermeidliche, sondern auch als positive Kräfte betrachtet wurden, schien die Demokratische Partei auf der Welle der Geschichte zu reiten, während die Republikaner von einem schrumpfenden Pool älterer weißer Wähler in sterbenden Städten abhängig waren. Doch um 2008 herum änderte sich etwas grundlegend.
Die Jahre nach der Finanzkrise verbrachte ich als Berichterstatter in Teilen des Landes, die von der Großen Rezession und dem langen Niedergang, der ihr vorausgegangen war, verwüstet wurden und die dem ersten schwarzen Präsidenten des Landes zunehmend feindselig gegenüberstanden. Drei Dinge begegneten mir überall, wo ich hinkam: die Überzeugung, Politik und Wirtschaft würden zugunsten weit entfernter Eliten manipuliert; ein Gefühl, dass die Mittelschicht verschwunden war; und das Fehlen jeglicher Institutionen, die hätten helfen können, einschließlich der Demokratischen Partei. Die zerrüttete Landschaft, die sich für Trump auftat, war kaum zu übersehen, aber die etablierten Parteien sahen sie trotzdem nicht, ebenso wenig wie die meisten Medien, die den Kontakt zur Arbeiterklasse verloren hatten. Am Morgen nach Trumps schockierendem Sieg 2016 kam ein Kollege wütend auf mich zu und sagte: „Das waren Ihre Leute, und Sie haben sie gestärkt, indem Sie andere Leute dazu gebracht haben, sie zu bemitleiden – und das war falsch!“
In gewisser Weise haben die Regierung Biden und die Harris-Kampagne versucht, die Demokratische Partei wieder auf die Arbeiterklasse auszurichten, die einst ihr Rückgrat gebildet hatte. Biden verabschiedete Gesetze, um in vernachlässigten Gemeinden Arbeitsplätze zu schaffen, für die kein Hochschulabschluss erforderlich ist. Harris vermied es sorgfältig, ihre Identität als schwarze und südasiatische Frau zum Wahlkampfthema zu machen und appellierte stattdessen an ein vages Gefühl von Patriotismus und Hoffnung. Doch Bidens Industriepolitik lieferte nicht schnell genug Ergebnisse, um den Schaden der Inflation auszugleichen – niemand, mit dem ich vor der Wahl in Maricopa County, Arizona oder Washington County, Pennsylvania, gesprochen hatte, schien vom Inflation Reduction Act gehört zu haben, dem Herzstück von Bidens Wirtschaftspolitik. Harris wiederum blieb gewissermaßen eine Chiffre, weil Biden seinen Rückzug so lange hartnäckig verweigerte, bis es für sie oder andere zu spät war, den demokratischen Wählern ihre Argumente zu vermitteln. Die Wirtschaftspolitik der Partei bekam eine populäre Orientierung, aber ihre Struktur erschien – anders als der Personenkult der Republikanischen Partei –, wie eine glitzernde Hülle aus Machttechnikern und Prominenten um einen hohlen Kern. Ihr Wiederaufbau wird Jahre dauern und ihre Neuausrichtung könnte Jahrzehnte in Anspruch nehmen.
Die Gratwanderung der Opposition
Vieles am Triumph der Trump-Reaktion ist ungerecht. Es ist unfair, dass ein verkommener Mann zweimal eine anständige, fähige Frau besiegt hat. Es ist unfair, dass Harris ihre Niederlage gnädig einräumte, während Trump an ihrer Stelle erneut seine Lügenmaschinerie in Gang gesetzt und damit weiter das Vertrauen in die Demokratie auf Jahre hinaus untergraben hätte. Es ist unfair, dass die meisten Medien sich sofort von Trumps hasserfüllter Rhetorik und Gewaltdrohungen gegen Migranten und politische Gegner abgewandt haben. Seine Kampagne war unverzeihlich – aber in den Worten aus W. H. Audens Gedicht „Spain“ über den Spanischen Bürgerkrieg: „History to the defeated / May say Alas but cannot help or pardon.“ Also etwa: Den Besiegten mag die Geschichte „Leider“ sagen, aber sie kann nicht helfen oder vergeben.
Die Trump-Reaktion ist brüchiger, als es jetzt scheint. Trumps Verhalten in den letzten Wochen des Wahlkampfs verhieß keine kohärente zweite Präsidentschaft. Er wird sich mit Ideologen, Opportunisten und Spinnern umgeben, und da er kein Interesse am Regieren hat, werden sie das Vakuum zu füllen versuchen und sich gegenseitig angreifen. Die Trump-Regierung wird angesichts der republikanischen Kongressmehrheit in Fragen wie Abtreibung und Einwanderung zu weit gehen und bald wichtige Teile ihrer neuen Koalition verprellen. Ihre Wirtschaftspolitik wird die alten Verbündeten der Partei unter den Reichen begünstigen und zulasten der neuen Unterstützer unter den weniger Wohlhabenden gehen. Trump könnte, wenn er auf die 80 zugeht, erneut zu den unbeliebtesten Präsidenten in der Geschichte des Landes gehören. Aber in der Zwischenzeit wird er einen enormen Spielraum haben, um seine Macht für Bereicherung und Rache zu missbrauchen und die verbleibenden Bande zu zerreißen, die die Amerikaner miteinander und das Land mit den Demokratien in aller Welt verbinden.
Die Trump-Reaktion wird ihre Gegner vor eine schwierige Gratwanderung stellen, die an F. Scott Fitzgeralds berühmte Zeile über eine hervorragende Intelligenz erinnert, die zwei gegensätzliche Ideen im Kopf behalten und dennoch funktionieren kann. Die Demokraten müssen eine notwendige Selbstprüfung vornehmen, die bei den Fehlern von Biden, Harris und ihrem inneren Kreis beginnt, aber auch das lange Abdriften der Partei weg von den dringlichsten Anliegen der gewöhnlichen Amerikaner hin zu den exzentrischen Obsessionen ihrer Spender und Aktivisten in den Blick nimmt. Doch diese Prüfung darf nicht in Lähmung enden, denn gleichzeitig wird die Opposition handeln müssen. Ein Großteil dieses Handelns muss gemeinsam mit der Zivilgesellschaft und dem Privatsektor sowie mit den überlebenden Regierungsinstitutionen erfolgen – um mit legalen Mitteln die massenhafte Internierung und Deportation von Migranten aus Gemeinden zu verhindern, in denen sie seit Jahren friedlich leben; um Frauen vor Gesetzen zu retten, die sie für den Versuch bestrafen wollen, ihr Leben zu retten; um die öffentliche Gesundheit vor Robert F. Kennedy Jr. zu schützen, die Sicherheit der Nation vor Tulsi Gabbard und die Staatskasse vor Elon Musk.
Von Angesicht zu Angesicht
Journalisten stehen in der Ära der Trump-Reaktion vor einer besonderen Herausforderung. Wir leben in einer Welt, in der Fakten sofort untergehen, sobald sie mit den Köpfen der Menschen in Berührung kommen. Lokale Nachrichten verschwinden, und eine stark dezimierte überregionale Presse kann kaum noch mit den Medienplattformen von Milliardären konkurrieren, die die Nutzer mit einem endlosen Strom von Verschwörungstheorien und Deepfakes algorithmisch steuern. Mit dem Internet – das einst versprochen hat, allen Menschen Informationen und eine Stimme zu geben –, konzentriert sich nun in wenigen Händen die Macht, um den Begriff der objektiven Wahrheit zu zerstören. „Der herkömmliche Journalismus ist tot“, krähte Musk in der Woche vor der Wahl auf seiner Plattform X. Anstatt also in den sozialen Medien Phantomen nachzujagen, sollten Journalisten ihre schwindenden Ressourcen besser für den Versuch nutzen, einen Teil des öffentlichen Vertrauens zurückzugewinnen. Dazu sollten sie das tun, was wir zu jeder Zeit getan haben: die Lügen von und die Bestechung durch Oligarchen aufdecken sowie die Geschichten von Menschen erzählen, die nicht für sich selbst sprechen können.
Wenige Wochen vor der Wahl machte der demokratische Abgeordnete Chris Deluzio, dessen erste Amtszeit sich dem Ende näherte, Haustürwahlkampf in einem hart umkämpften Wahlkreis im Westen Pennsylvanias. Er ist ein Navy-Veteran, gemäßigt in kulturellen Fragen und links bei Wirtschaftsthemen – kritisch gegenüber Unternehmen, reichen Spendern und einer Ideologie, die das Kapital über Menschen und Gemeinschaften stellt. An einem Haus sprach er mit einem weißen Polizisten mittleren Alters namens Mike, der ein Trump-Schild in seinem Vorgarten hatte. Ohne sich von seiner Entscheidung bei der Präsidentenwahl abbringen zu lassen, stimmte Mike bei der Wahl zum Repräsentantenhaus schließlich für Deluzio. In einem Bundesstaat, den Trump gewann, schnitt Deluzio in seinem Wahlbezirk besser ab als Harris, insbesondere in den republikanischen Gebieten, und gewann deutlich. Was beweist das? Nur dass Politik am besten ist, wenn sie von Angesicht zu Angesicht und auf der Grundlage von Respekt stattfindet, dass die meisten Menschen kompliziert und sogar überzeugbar sind. Und, wie es in der nächsten Zeile des Fitzgerald-Zitats heißt, man kann begreifen, „dass die Dinge hoffnungslos sind und dennoch entschlossen sein, sie anders zu machen“.
Deutsche Erstveröffentlichung eines Textes, der unter dem Titel „The End of Democratic Delusions“ am 2. Dezember 2024 auf theatlantic.com erschienen ist. Die Übersetzung aus dem Englischen stammt von Steffen Vogel.
[1] Wortspiel mit „People of Color“ als Bezeichnung für nichtweiße Menschen und „People“: das Volk, die Gemeinschaft der Staatsbürger. – D. Red.