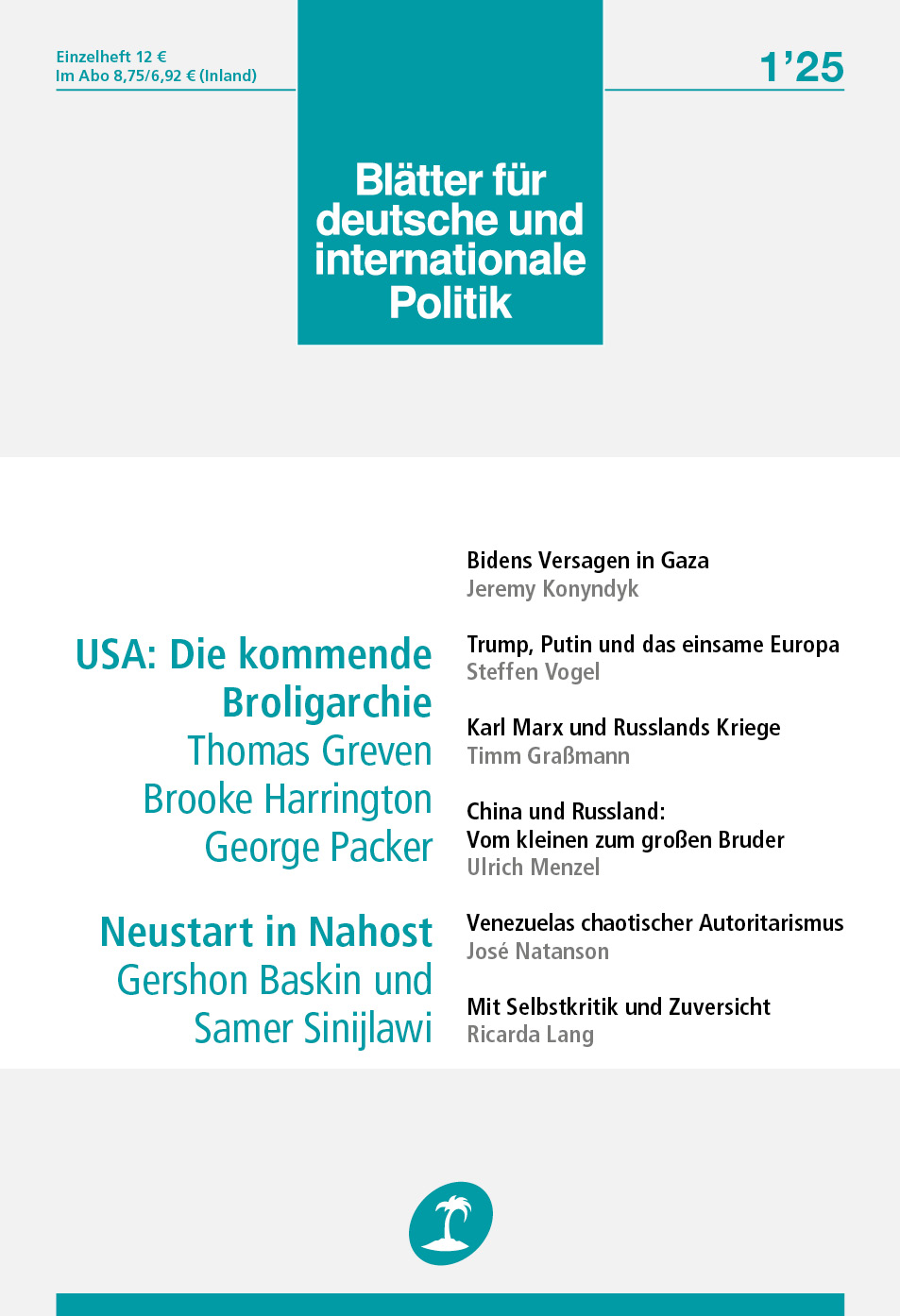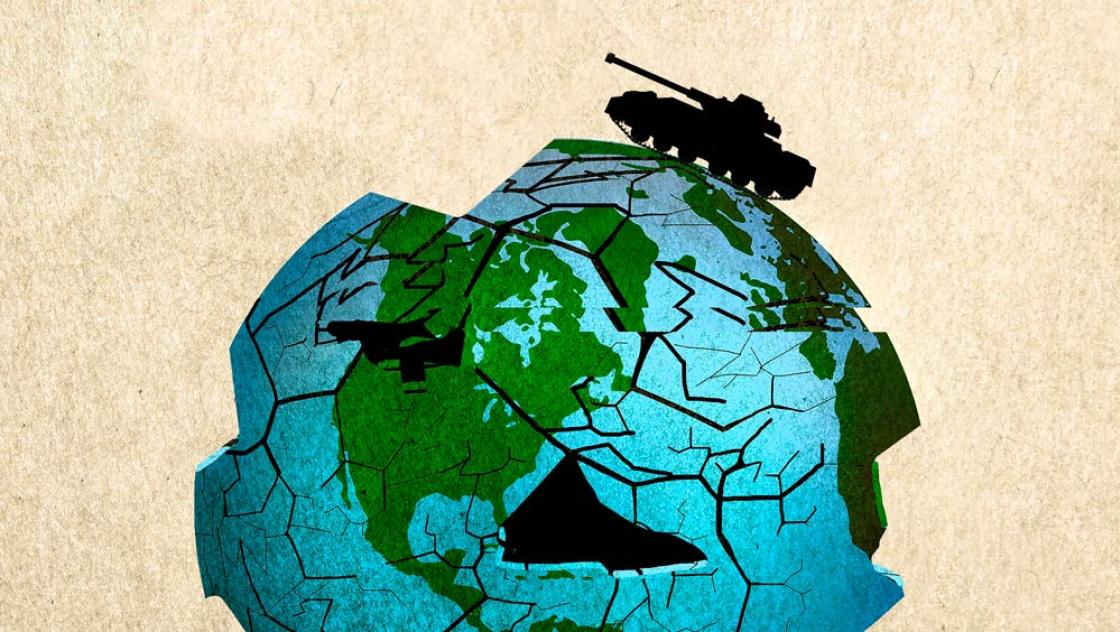
Bild: Symbolbild: Ein Panzer rollt über einen zerbrochenen Globus (IMAGO / Ikon Images)
Lässt man das 21. Jahrhundert wie landläufig üblich mit dem 1. Januar 2000 beginnen, dann treten wir mit dem 1. Januar 2025 in dessen zweites Viertel ein. Und vieles spricht dafür, dass sich die Dramaturgie des vergangenen 20. Jahrhunderts wiederholen könnte. War schon dessen erstes Quartal hoch verlustreich gewesen, sollte das zweite noch eine enorme Steigerung bedeuten. „Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren: Es ist die Zeit der Monster“, lautet das Antonio Gramsci zugeschriebene Zitat, das die Zeit des Interregnums nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Niedergang der alten Imperien auf den Punkt bringt.[1] Heute wie damals gehen vor allem drei Monster um: autoritärer Nationalismus („My Country First“), die Globalisierung des Krieges und die Zerstörung des sozialen Zusammenhalts.
Spätestens mit dem Comeback Donald Trumps endet eine Ära der großen Erwartungen mit fundamentaler Ernüchterung. Es waren die USA unter George Bush dem Älteren, die nach der Zeitenwende von 1989/90, dem Ende des Ostblocks, und während des Zweiten Golfkriegs mit Blick auf das überfallene Kuwait die „New World Order“ ausriefen: „Es geht um mehr als nur um ein kleines Land“, so der damalige US-Präsident, „es ist eine große Idee: eine neue Weltordnung, wo unterschiedliche Nationen zusammenrücken im gemeinsamen Ziel, die universalen Hoffnungen der Menschheit zu erreichen – Frieden und Sicherheit, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Dies ist eine Welt, die es wert ist, dass wir für sie kämpfen, und die es wert ist, die Zukunft unserer Kinder zu sein.“[2]
Diese lange, letzte Dekade des 20. Jahrhunderts war eine Phase der Hoffnung. Sie begann mit dem Fall der Mauer am 9.11.1989 und sie endete quasi spiegelbildlich am 11.9.2001, mit dem terroristischen Angriff auf das World Trade Center. Damit schlug die Verheißung der Globalisierung radikal ins Negative um. Verheerender aber noch als die Anschläge selbst waren die Folgen von Nine Eleven, insbesondere der völkerrechtwidrige Irakkrieg. Denn dieser beendete faktisch die Selbstbindung der USA an das internationale Recht, bedeutete die Preisgabe des Multilateralismus.
Es ist an Ironie kaum zu überbieten, dass heute jene Neocons, die vor über zwanzig Jahren die Vereinten Nationen so empfindlich schwächten, gegen Donald Trumps „My country first“-Nationalismus zu Felde ziehen. Die Falken der alten republikanischen Partei, von Dick Cheney bis Robert Kagan, warnen jetzt als Tauben vor der Zerstörung der Internationalen Ordnung durch Trump. Nichts könnte die fatale Entwicklung der Vereinigten Staaten im vergangenen Vierteljahrhundert stärker auf den Punkt bringen.
Ähnlich fatal war die Lage vor einhundert Jahren. Nachdem Präsident Woodrow Wilson die USA unter großen Schwierigkeiten in den Ersten Weltkrieg geführt hatte („The war to end all wars“), scheiterte sein großes Projekt des Völkerbunds. Dreimal lehnte der US-Senat in den Jahren 1919 und 1920 die Teilnahme der USA ab, was die Kraft der neu geschaffenen internationalen Organisation von Anfang an massiv untergrub und maßgeblich zum Scheitern der multilateralen Ordnung beitrug. Erst aus der Erfahrung der Verheerungen des Zweiten Weltkriegs ratifizierte der US-Senat dann 1945 die UN-Charta. In der Folge wurden die USA zur tragenden Kraft der Vereinten Nationen und damit der regelbasierten internationalen Ordnung der Nachkriegszeit.
Heute droht unter Trump das genaue Gegenteil – nämlich der (wiederholte) Rückzug aus den internationalen Organisationen, vom Pariser Klimaabkommen bis zu WHO und WTO. Anstelle der Win-win-Idee multilateraler Abkommen wird bei Trump jede Aktion zu einem Nullsummenspiel: Was der eine gewinnt, muss der andere verlieren.
Die Globalisierung des Krieges
In diesem Punkt korrespondiert die Trumpsche Agenda perfekt mit dem, was wir von östlicher Seite erleben: der Rückkehr des Krieges nach Europa. Und mehr als das: Wie vor hundert Jahren wird der Krieg auf europäischem Boden wieder global geführt, diesmal allerdings mit nordkoreanischen Soldaten, iranischen Drohnen und chinesischen Dual-Use-Gütern, neben den diversen Formen hybrider Kriegsführung.
Das zweite Monstrum dieser Übergangszeit ist damit die Globalisierung des Krieges. Absurderweise ist es ausgerechnet Wladimir Putin, der den „globalen Charakter“ anprangert, den der Krieg in der Ukraine inzwischen angenommen habe. Aus der Verteidigung der Ukraine durch die westlichen Staaten leitet Putin, obwohl diese völkerrechtlich absolut zulässig ist,[3] seinerseits das bloß vermeintliche Recht ab, seine „Waffen gegen Militäreinrichtungen jener Länder einzusetzen, die erlauben, dass ihre Waffen gegen unsere Einrichtungen eingesetzt werden“ – eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, die die internationale Ordnung konterkariert und mit dem Angriff auf den Westen droht.
Auch bei Putin lautet die Logik: Die Schwäche meines Feindes ist meine eigene Stärke. Ich gewinne dadurch, dass ich den anderen schwäche oder gar zerstöre. Das ist das verbindende Moment der Autokraten. Und zugleich ist es das Ende jeder rechtlichen Kodifikation, aber auch jeder Idee von gemeinsamem Wohlstand.
Heute ist es nicht zuletzt die von Trump bereits angekündigte Zollkrieg-Politik, die faktisch allen zu schaden droht und damit das dritte Monstrum heraufbeschwört: die soziale Spaltung im Inneren, einhergehend mit der Sehnsucht nach autoritär-faschistischer Führung – vergleichbar der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrshunderts. Wie von Karl Polanyi luzide beschrieben, war der Faschismus die autoritäre Antwort auf die „Great Transformation“ – die Entbettung des Kapitalismus aus der Gesellschaft samt der Entstehung ungeheurer Reichtumsunterschiede im Zuge der Industrialisierung. Für Polanyi liegen „die Ursprünge der Katastrophe in dem utopischen Bemühen des Wirtschaftsliberalismus zur Errichtung eines selbstregulierenden Marktsystems.“[4] In Folge dessen ist die Wirtschaft „nicht mehr in soziale Beziehungen eingebettet“, sondern die menschliche Gesellschaft sinkt zu einem bloßen „Beiwerk des Wirtschaftssystems“ herab.
Die Entbettung des Faschismus
Durch das Kräftegleichgewicht der Staaten, den Goldstandard und den an Recht gebundenen Nationalstaat wurde die europäische Zivilisation im 19. Jahrhundert gerade noch aufrechterhalten; doch dieses System brach im Ersten Weltkrieg und dann beschleunigt Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre zusammen. Die daraus hervorgehende Klassenspaltung der Gesellschaft trug entscheidend zur Weltwirtschaftskrise und damit in Europa zur faschistischen „Krisenlösung“ des Nationalsozialismus bei – anders als in den Vereinigten Staaten, wo Roosevelts New Deal das Aufkommen der autoritären Versuchung zwar nicht im Keim, aber im Ergebnis erstickte.
Umgekehrt sollte nach 1945 für den Westen Europas die soziale Demokratie, die staatlich gehegte Marktwirtschaft, die Antwort auf Faschismus und Kommunismus sein, auf Basis eines den Wohlstand fördernden Welthandels: Sie sollten die Ursachen der gesellschaftlichen Polarisierung abbauen und somit – quasi als ökonomischer Teil des antitotalitären Konsenses – jede neuerliche autoritäre Versuchung im Ansatz verhindern.
Mit Trump steht all das auf der Kippe – sowohl der freie Welthandel als auch die soziale Demokratie. Mit seiner vor allem gegen China, aber auch gegen Europa gerichteten Zoll-Politik baut Trump Hürden auf, die den Warenaustausch massiv verteuern werden und damit allen zu schaden drohen: ganz besonders Deutschland als ausgewiesener Exportnation, aber letztlich auch der amerikanischen Bevölkerung, da der Dollar aufgewertet wird und die Importe sich verteuern werden.
„Warfare against commerce is a warfare against mankind“: Krieg gegen den Welthandel ist Krieg gegen die Menschheit, mit dieser Verteidigung der globalen Handelsbeziehungen hatte Wilson den Kriegseintritt der USA in den Ersten Weltkrieg gerechtfertigt. Trump dagegen setzt ganz auf eine anti-Wilsonsche und anti-Rooseveltsche Doppelstrategie: auf Protektionismus gegenüber dem Ausland und – nach dem Vorbild von Javier Milei und mit dem Erfüllungsgehilfen Elon Musk als seinem „first buddy“ – auf den Abbau aller staatlichen und überstaatlichen Regularien. Was von beidem schädlicher ist, ist nicht leicht zu sagen. Beides zusammen ist in jedem Fall ein toxischer Cocktail.
Fest steht: Ohne eine funktionierende, sozial eingebettete Weltwirtschaft werden die Konflikte noch größer werden, zumal gegenüber einem in hohem Maße auf den Welthandel angewiesenen China, das seinerseits bis 2049, zum Ende des nächsten Vierteljahrhunderts und dem hundertsten Jahr der Staatsgründung, zur dominierenden Weltmacht avancieren will, um das westliche Modell durch den „chinesischen Weg“ abzulösen, inklusive einer möglichen aggressiven Einverleibung Taiwans. „Taiwan ist ein heiliges Territorium Chinas, die Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße sind durch Blut verbunden, und Blut ist dicker als Wasser“, mit diesen Argumenten erhebt Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping regelmäßig Ansprüche auf die kleine Nachbarinsel. „Die Wiedervereinigung des Mutterlandes ist eine historische Unvermeidlichkeit“, erklärte er am 1. Oktober 2024, anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik. Damit sind massive globale Konflikte bereits vorgezeichnet.
Globaler Handel und Multilateralismus im Sinne einer gemeinsamen völkerrechtlichen Ordnung zum Nutzen aller waren die Konsequenzen aus der Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Mit beiden Prinzipien der Befriedung brechen die Trumps, Putins und Xi Jinpings dieser Welt, ob auf dem Wege des Handels- oder des echten Krieges.
In diesem hoch gespannten globalen Umfeld kämpft eine massiv geschwächte Europäische Union um die eigene Selbstbehauptung.[5] Faktisch befindet sich der alte Kontinent im Auge des Orkans – von außen umgeben von Konfliktherden, von der Ukraine bis Nahost, von innen von Autoritarismus bedroht. Zugleich droht der „gespaltene Westen“ (Habermas) unter Trump seiner möglichen Auflösung entgegenzugehen. Unmittelbar nach seiner Wahl hat der neue US-Präsident nicht nur die Verteidigungshilfen für die Ukraine, sondern auch die Nato-Mitgliedschaft der USA zur Disposition gestellt. Selbst wenn letzteres bloße Drohkulisse bleiben sollte, steht fest, dass bei dem von Trump angestrebten „Deal“ mit Selenskyj und Putin Europa für die Sicherung des Waffenstillstands wird aufkommen müssen, finanziell wie vermutlich auch materiell, sprich: mit eigenen Truppen.
Zugleich spricht nichts dafür, dass Putin im Falle eines Waffenstillstandes seine Kriegswirtschaft zurückfahren wird. Vielmehr dürfte er seine Waffenlager wieder auffüllen, um so in absehbarer Zeit zu einer weiteren Expansion in der Lage zu sein. Was damit für die EU höchste Priorität hat, ist ihre Fortentwicklung zu einer eigenen Sicherheits- und Verteidigungsgemeinschaft. Das verlangt enorme finanzielle Aufwendungen, und zwar genau zu einem Zeitpunkt, da in Europa – und nicht zuletzt in Deutschland – eine Wirtschaftskrise droht, wie sie speziell die Bundesrepublik nach 1945 noch nicht erlebt hat. Für diese Wohlstandsverluste zahlt der Kontinent mit sozialer Spaltung. Damit ist Europa auch im Inneren einem autoritären Angriff ausgesetzt, der in der Nachkriegsgeschichte stets durch Wohlstandszuwächse und Umverteilung abgewehrt werden konnte. Was aber ist die Antwort, wenn derartige Lösungen nicht mehr zu erwarten sind – und möglicherweise ökologisch auch gar nicht mehr vertretbar?
Denn auf eine, wenn nicht die zentrale Frage der Zukunft gibt die Debatte um die Notwendigkeit von Welthandel und -wirtschaft als Konjunkturlokomotiven keinerlei Antwort: Wie halten wir es mit jenem Monstrum, von dem vor hundert Jahren noch nicht die Rede war – mit der zunehmenden Zerstörung der Erde im Anthropozän?
Das, was den Zug in den Faschismus aufhalten soll, nämlich die Erzeugung wachsenden Wohlstands zur Befriedigung wachsender Ansprüche einer wachsenden Bevölkerung, droht zugleich immer stärker die ökologischen Lebensgrundlagen zu zerstören. Dieser Widerspruch zwischen Nord und Süd, aber auch zwischen heutigen und künftigen Generationen, ist völlig unaufgelöst, wie das äußerst dürftige Ergebnis der jüngsten UN-Klimakonferenz, der COP29 in Baku, Aserbaidschan, verdeutlicht hat. Ja, mehr noch: Auch auf diesem Feld werden die globalen Widersprüche größer werden und damit zugleich auch die Konflikte.
Noch befinden wir uns in einer Übergangszeit. Aber die Monster nehmen immer mehr Kontur an. Fest steht: Mit Trump drohen vier weitere verlorene Jahre – für den Klimaschutz wie für die Verteidigung der Demokratie. Vier Jahre, die sich die Welt eigentlich nicht leisten kann. Vier Jahre, die die Monster wohl noch größer werden lassen. Und die vor allem die Europäische Union dazu zwingen, in einem wachsenden Meer des Autoritarismus Demokratie und Multilateralismus tapfer zu verteidigen – gegen alle Widerstände.
[1] Genau genommen heißt es in Band 3 der „Gefängnishefte“ (Hamburg 1991, S. 354): „Die Krise besteht gerade darin, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann: in diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen.“
[2] Alasdair Spark, New World Order, in: Peter Knight (Hg.), Conspiracy Theories in American History. An Encyclopedia, Band 2, Santa Barbara 2003, S. 536.
[3] Laut Artikel 51 der UN-Charta gilt „im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen [...] das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat.“ Das bedeutet, dass der überfallene Staat mit Waffen, aber auch mit Soldaten unterstützt werden darf.
[4] Karl Polanyi, The Great Transformation, Frankfurt a. M. 1978, S. 54.
[5] Siehe dazu auch den Beitrag von Steffen Vogel in diesem Heft.