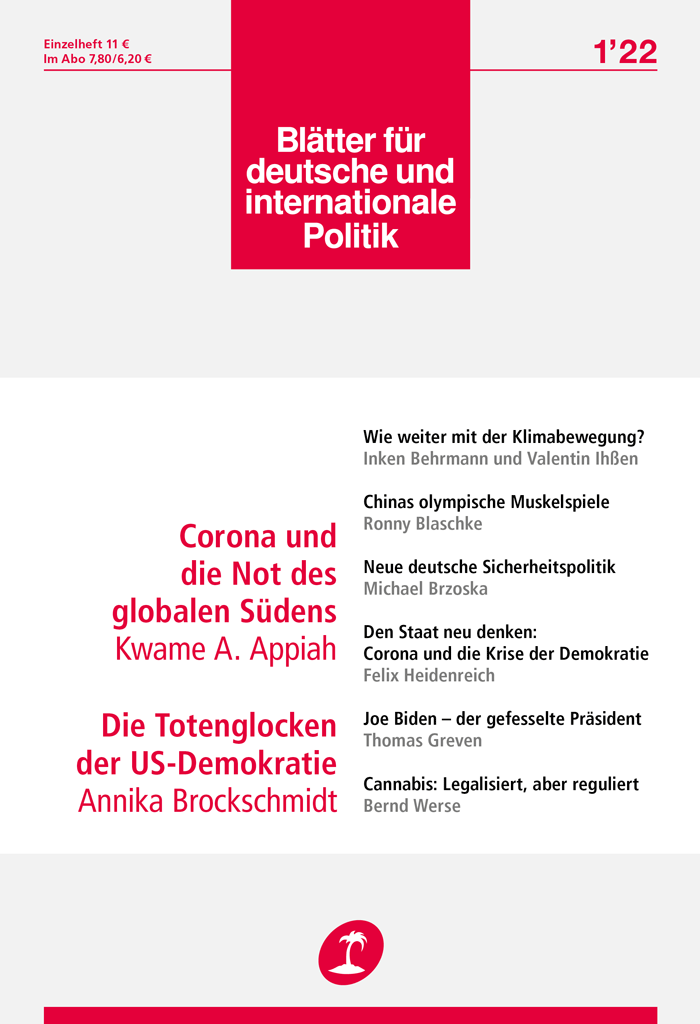Bild: Ein Teilnehmer einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen trägt eine Armbinde mit der Aufschrift »Ungeimpft«, 13.12.2021 (IMAGO / Karina Hessland)
In der wohl größten Krise in der Geschichte der Republik hat am 8. Dezember 2021 die vielleicht labilste und jedenfalls unerfahrenste Koalition die Regierungsgeschäfte übernommen. Alles andere als gute Voraussetzungen für den versprochenen historischen Aufbruch. Kaum im Amt, ist die neue Bundesregierung mit der Coronakrise jedenfalls bereits mit einer immensen Bewährungsprobe konfrontiert. Ja mehr noch: mit einer Bewährungsprobe für die Demokratie insgesamt. Derweil der neue Bundeskanzler Olaf Scholz schon von einem „sozialdemokratischen Jahrzehnt“ schwärmt, geht es im Kern um etwas weit Fundamentaleres: nämlich um die Frage, ob die demokratische Politik als solche sich in dieser nicht nur klimapolitisch so entscheidenden Dekade als handlungs-, führungs- und damit letztlich als überlebensfähig erweisen wird.
Das kardinale Demokratieproblem der vergangenen 16 Jahre bestand darin, dass es keine überzeugende politische Alternative zur Dominanz des entpolitisierenden Merkelschen „Sie kennen mich“ gab. Das sorgte für gewaltige Frustration und die Gründung einer inzwischen in weiten Teilen rechtsradikalen „Alternative“ für Deutschland. Jetzt aber könnte die Desillusionierung eine noch größere sein, und zwar vor allem unter den dezidiert demokratischen Kräften, wenn sich nämlich herausstellen sollte, dass nun eine Alternative zur Vorherrschaft der Union zwar gewählt wurde, diese aber gar nicht über die erforderliche Handlungsmacht verfügt, um tatsächlich etwas Grundlegendes zu ändern – angesichts der Größe der Probleme und der Schwäche der politischen Akteure. Das gilt für die sich immer größer auftürmende Klimakrise und, höchst akut, für die aktuelle Corona-Lage. Angesichts steigender Infektionszahlen bei fast stagnierenden Neu-Impfungen kommt es daher für die neue Regierung vor allem darauf an, sofort politische Handlungsfähigkeit zu beweisen. Worum es aber letztlich geht, ist die Rückeroberung des Primats des Politischen. Andernfalls droht aus einem anfänglichen Politikerversagen, das inzwischen längst zu einem Politikversagen in Gänze geworden ist, am Ende ein Systemversagen der Demokratie zu werden.
Während der Coronakrise hat die Politik eine Menge Vertrauen in ihre Kompetenz verspielt. Es begann, nach einem gerade in Deutschland eigentlich verheißungsvollen Start, im Winter des ersten Corona-Jahres mit dem Versagen führender Politiker bei der Bestellung der erforderlichen Impfdosen für die Bundesrepublik und die EU; und es setzte sich fort mit den skandalösen Maskendeals der Union.
Doch im vergangenen Sommer des zweiten Corona-Jahres wurde aus dem Politikerversagen ein Politikversagen. Über Monate wurde die realexistierende Chance verspielt, das zu erreichen, was den Nachbarländern gelungen ist, nämlich deutlich höhere Impfquoten. So wurde aus einem Scheitern einzelner Politiker, insbesondere des Gesundheitsministers Jens Spahn, das Scheitern der Politik als solcher. Dadurch hat diese erheblich an Gestaltungsmacht eingebüßt. Beispielhaft dafür stehen zwei zentrale Aussagen der damaligen Kanzlerin. Am Anfang der Krise, in Angela Merkels historischer Fernsehansprache vom 18. März 2020, stand die eindringliche Bitte: „Die Lage ist ernst. Nehmen Sie sie auch ernst.“ Dies führte zu erheblicher Folgebereitschaft, nämlich zu leeren Straßen und einer vorsichtigen Bevölkerung. Ein knappes Jahr später, Anfang Februar 2021, legte die Kanzlerin nach, mit dem von ihr immer wiederholten Satz, die Regierung wolle bis zum 21. September 2021 – also bis unmittelbar vor der Wahl – „jedem Bürger ein Impfangebot machen können“.
Mit diesem Satz aber setzte sie den völlig falschen Ton. Stets war nur von Angeboten und nicht von irgendwie gearteten verstärkten Anstrengungen die Rede, geschweige denn von Druck auf die Corona-Leugner. Im Gegenteil: Die Politik duckte sich weg unter dem permanenten Protest der Maßnahmengegner wie ihrer medialen Verstärker, insbesondere der „Bild“-Zeitung.
Auf diese Weise gab die Politik das Heft des Handelns bereitwillig aus der Hand – auch deshalb, weil insbesondere die beiden Parteien der großen Koalition während des Wahlkampf keinerlei Interesse daran hatten, ihre Fehler in der Coronakrise zu thematisieren. Die Konsequenz: Über die gesamten Sommer- und Herbstmonate erhöhte sich die Impfquote nur marginal. Faktisch wurde damit die Chance vertan, durch forcierte Aufklärung und echte materielle Anreize weit mehr Menschen zu einer Impfung zu motivieren,[1] zumal inzwischen viel weniger Krankenhausbetten zur Verfügung stehen.
Diese enorme Hypothek eines fundamentalen Scheiterns der großen Koalition erbt nun das neu konstituierte Ampelbündnis. Wobei nicht nur die SPD als Partei des bisherigen Vizekanzlers Olaf Scholz, sondern auch die anderen Parteien als Angehörige diverser Landesregierungen an diesem Politikversagen erheblichen Anteil hatten.
Das fatale Erbe der großen Koalition
Damit befindet sich die neue Koalition in der fatalen Lage, dass sie mit den bisherigen Maßnahmen nicht vorwärtskommt, die Pandemie aber weiter eskaliert, und sie deshalb einer fünften Welle des Virus mit dem Griff zur maximalen Maßnahme Einhalt zu gebieten versucht, nämlich durch die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Nachdem die Politik also mit dem harmlosen Zuckerbrot des bloßen Impfangebots radikal versagt hat – und dieses dann noch viel zu sehr abbaute –, versucht sie es nun mit der Peitsche.
Das allerdings beinhaltet die Gefahr maximaler Polarisierung in einer ohnehin massiv gespaltenen Gesellschaft. Und zugleich ändert es nichts an der Tatsache, dass der Erfolg des staatlichen Handelns weiterhin vom Goodwill der Bevölkerung abhängt, also von ihrer Bereitschaft zur Mitarbeit, sprich zur Impfung. Denn während eines in jedem Fall ausgeschlossen sein soll, nämlich der mit physischer Gewalt durchgesetzte Impfzwang, ist noch gar nicht ausgemacht, wie eine solche Impfpflicht faktisch umgesetzt werden kann – zumal schon jetzt diejenigen, die geimpft und geboostert werden möchten, nicht hinreichend bedient werden können
Hier zeigt sich: Der Aggregatzustand des Politischen, das Machtverhältnis zwischen Staat und Gesellschaft, hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten radikal verändert. Während in den 1970er Jahren der konservative Staatsrechtler Ernst Forsthoff von der „Staatsbedürftigkeit der Gesellschaft“ sprach, weil die Gesellschaft, um zu funktionieren, längst auf ihre vor allem wohlfahrtsstaatlichen Institutionen strukturell angewiesen sei, hat die Coronakrise gezeigt, dass auch das Gegenteil der Fall ist: Es gibt nämlich eine existenzielle Gesellschaftsbedürftigkeit des Staates. Ohne das Mittun der Bevölkerung bei der Bekämpfung der Pandemie ist die Politik völlig aufgeschmissen.
Während ironischerweise gerade die neuesten Staatsfeinde, nämlich Corona-Leugner, Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker, die Allmacht des Staates behaupten – „hinter Corona steckt eine Macht, die alles steuert“ –, ist der Staat in der Coronakrise von echtem Durchregieren maximal entfernt. Faktisch haben sich die Machtverhältnisse also radikal verkehrt. Um, notgedrungen, das Unwort von Carl Schmitt zu bemühen: Souverän sind heute die Ungeimpften, denn sie entscheiden über den Ausnahmezustand in den Krankenhäusern. Und der Staat hechelt ihrem Unwillen zur Impfung hilflos hinterher, indem er nur noch die Verlegung der Kranken mit Bundeswehr-Hubschraubern und -Flugzeugen in die letzten freien Betten zu organisieren versucht.
Auf dem Höhepunkt der alten Bonner Republik, zu Beginn der 1980er Jahre, stellte sich die Lage noch gänzlich anders dar. Nicht zuletzt unter dem Eindruck des Aufkommens der neuen sozialen Bewegungen gegen den „Atomstaat“ (Robert Jungk), der mit massiver polizeilicher Gewalt AKWs bauen und Atomwaffen stationieren wollte, zeichnete Jürgen Habermas in seiner heute schon klassischen „Theorie des kommunikativen Handelns“ das Bild der Kolonialisierung der Lebenswelt durch Ökonomie und Staat. In der Lebenswelt als dem Bereich der freien Kommunikation, den wir als Zivilgesellschaft bezeichnen, findet die demokratische Verständigung statt, in Form des argumentativen Austauschs, der Deliberation. Allerdings werde diese Lebenswelt, so Habermas, durch das „System“ in Form marktregulierter Ökonomie und bürokratischer Verwaltung permanent durchdrungen und damit kolonialisiert, mit Hilfe der Steuerungsmedien Geld und Macht. Heute dagegen ist nicht primär die Zivilgesellschaft einer Kolonialisierung durch die Politik ausgesetzt; vielmehr befindet sich die Politik selbst in einem permanenten Belagerungszustand durch einen sich immer radikaler gebärdenden, höchst unzivilen Teil jener „Zivilgesellschaft“. Der Staat wird von diesem regelrecht unter Beschuss genommen oder in Form seiner Volksvertreter, etwa der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping, mit Fackelmärschen im SA-Stil belagert.
Wieviel Macht hat der Staat?
Worum es daher heute im Kern geht, ist die Frage, über wieviel Macht der demokratisch legitimierte Staat überhaupt noch verfügt, um die von ihm angestrebten Ziele zu erreichen – ob im Kampf gegen Corona oder die Klimakrise. In der klassischen Definition von Max Weber bedeutet Macht bekanntlich „jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“. Macht – als die Notwendigkeit und das Essenzielle jeder Politik – ist somit die Fähigkeit, Menschen zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen, notfalls auch gegen deren Willen. Was die Bürgerinnen und Bürger dagegen in der Coronakrise erleben und erleiden, ist eine Politik, die sich ihrer eigenen Machtmöglichen entledigt hat und auch deshalb heute fast nackt dasteht.
Diese fatale Lage im zweiten Corona-Winter erzeugt eine hochgefährliche zweifache Frustration in der Bevölkerung: Erstens bei unzähligen Ungeimpften, die die Impfung unvermindert ablehnen und zugleich der Politik den Bruch ihres voreiligen Versprechens vorwerfen, wonach es definitiv keine allgemeine Impfpflicht geben werde. Und zweitens bei den Geimpften, die darauf gehofft haben, dass sie, weil sie geimpft sind, jetzt wieder ihre Freiheiten zurückerhalten würden, und die zumeist dennoch durchaus bereit sind, weitere Einschränkungen zu akzeptieren – allerdings nicht die Sorglosigkeit der Politik im laxen Umgang mit der Pandemie. Diese Frustration der durchaus Gutmeinenden wiegt weit schwerer. Denn bisher hat die Politik vor allem viele demokratisch Unwillige verloren. Richtig problematisch wird es aber, wenn auch die von der Demokratie Überzeugten verloren gehen, weil sie nicht mehr an die Gestaltungsmacht der gewählten Politikerinnen und Politiker glauben.
In noch größerem Maße stellt sich dieses Problem mit Blick auf die Klimakrise. Folgebereitschaft wird demokratische Politik nur dann erzielen, wenn sie überzeugende Ergebnisse liefert, was im Fall der Ampel noch gar nicht absehbar ist.[2] Die Gefahr der Frustration betrifft hier vor allem die junge Generation, die von der Klimakrise am stärksten betroffen ist – und damit all jene, die in den nächsten Jahrzehnten die Demokratie tragen müssen.
Das alles spielt sich zudem ab vor dem Hintergrund einer radikalen Infragestellung der Demokratie im globalen Maßstab. Denken wir etwa an die chinesische Herausforderung, dann verbirgt sich dahinter auch die Frage, ob Demokratien überhaupt in der Lage sind, auf rechtsstaatlichem Wege und in hinreichend schneller Zeit die auch von der Ampel angestrebte „Transformation“ zu einer klimaneutralen Gesellschaft zu leisten – oder ob die Welt sich auch hier in Richtung autoritärer Lösungen bewegt. Offensichtlich führt die zunehmende Machtlosigkeit demokratischer Politik zu einem enormen Schwund an Autorität. Bereits 1970, angesichts einer ersten, ungleich schwächeren Krise der westlichen Nachkriegsdemokratien, unterschied der Politökonom Albert O. Hirschman drei mögliche Handlungsstrategien in gesellschaftlichen Krisen, nämlich Loyalty, Voice und Exit. Die wohl größte Gefahr besteht heute darin, dass die Loyalität zum demokratischen System weiter erodiert und sich immer mehr Menschen nicht länger für Voice entscheiden, also dafür, ihre Stimme in der Demokratie zu erheben, sondern für Exit, also für die resignative Abwendung von der Politik und den Rückzug in die privatistische Nische – eine Entwicklung, die in den USA ob der Enttäuschung über die Regierung Biden schon mit Händen zu greifen ist.[3]
Das Gleiche droht der Ampel, wenn sich tatsächlich einstellt, was sich jetzt bereits abzeichnet – eine enorme Diskrepanz zwischen dem lauthals verkündeten großen Anspruch auf „Fortschritt, Erneuerung, Modernisierung“ und einer Realität sehr viel kleinerer, vielleicht sogar untauglicher Schritte im alltäglichen Politgeschäft. Gelingt es jedoch nicht, einen erheblichen Teil der hohen Ansprüche in die Tat umzusetzen, dürfte maximale Enttäuschung die Folge sein. Das ist die enorme Hypothek, die auf den Schultern der Ampel-Koalitionäre lastet.
Ja, dieses Jahrzehnt ist das wohl entscheidende Jahrzehnt für die Bewältigung der Klimakrise. Es ist damit aber auch das entscheidende Jahrzehnt für die Bewältigung der Demokratiekrise. Denn ohne die Bewältigung der Klimakrise wird es keine überzeugten Verteidiger der Demokratie geben – und umgekehrt ohne engagierte Demokraten keine Bewältigung der Klimakrise. Klima und Demokratie haben daher eines gemeinsam: Beide befinden sich an einem möglichen Kipppunkt. Und die entscheidende Frage dieser Dekade lautet: Gelingt uns die Rettung des ökologischen und zugleich des demokratischen Systems – oder ist das Umkippen beider nicht mehr aufzuhalten?
[1] Vgl. dazu den Beitrag von Julia Macher in dieser Ausgabe.
[2] Vgl. dazu den Beitrag von Inken Behrmann und Valentin Ihßen in dieser Ausgabe.
[3] Vgl. dazu die Beiträge von Thomas Greven und Annika Brockschmidt in dieser Ausgabe.