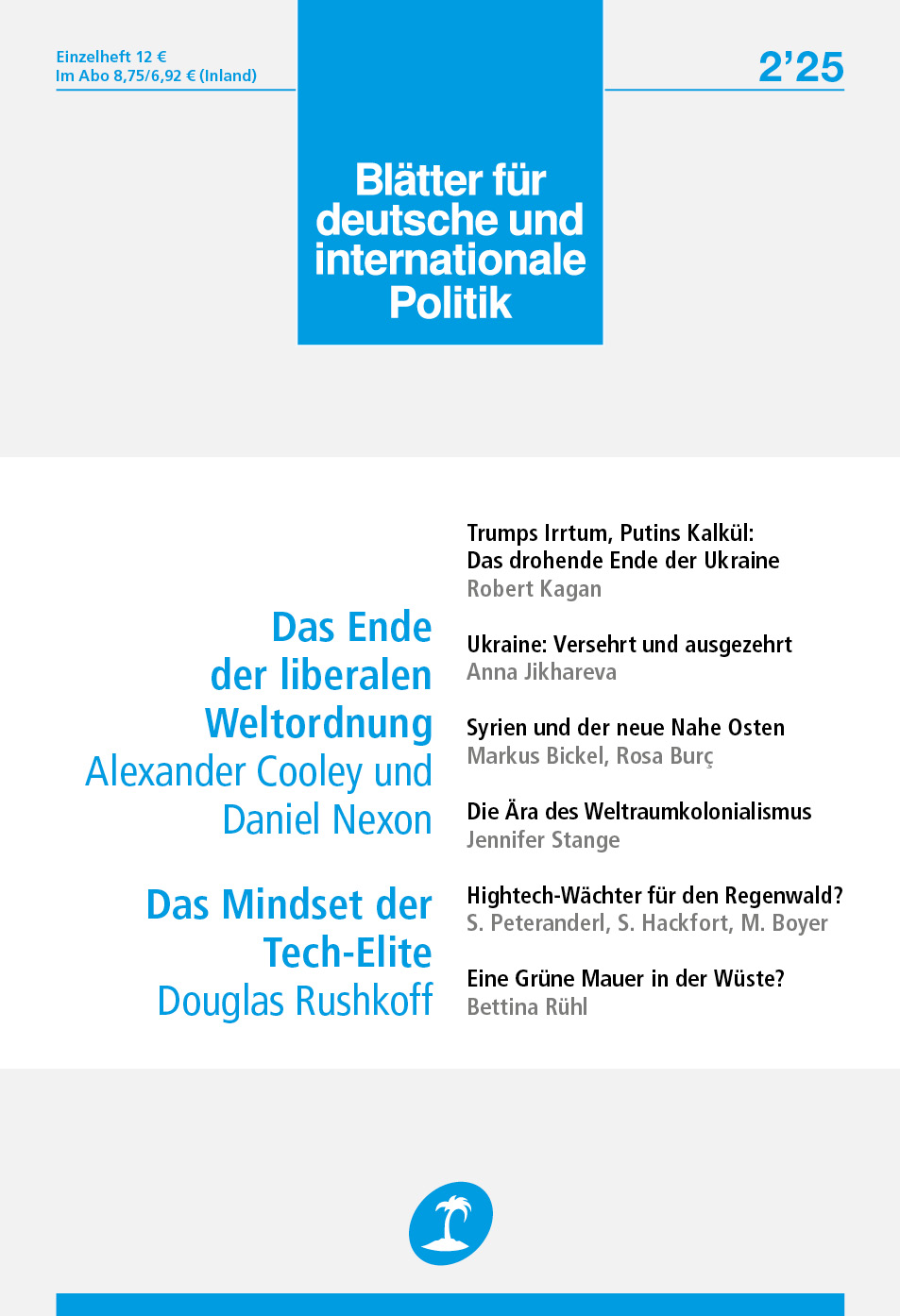Die Ukraine nach drei Jahren russischer Großinvasion

Bild: Eine Frau steht an einem Fenster und blickt auf ein durch einen russischen Raketenangriff beschädigtes Gebäude, Kiew, Ukraine, 18.1.2025 (Kirill Chubotin / IMAGO / NurPhoto)
Das neue Jahr begann in der Ukraine genauso wie das alte geendet hatte: mit Luftalarm. Nur wenige Stunden war der Jahreswechsel her, da stand die Hauptstadt Kyjiw bereits wieder unter Beschuss. Wohnhäuser und das Gebäude der Zentralbank wurden von russischen Drohnen getroffen; ein prominentes Wissenschaftler:innenpaar kam ums Leben, mehrere Personen, darunter zwei schwangere Frauen, wurden verletzt. Allein in den ersten drei Januartagen, so teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf X mit, habe die russische Armee über 300 Drohnen und mehr als 20 Raketen auf ukrainische Städte abgefeuert.[1] Bald drei Jahre dauert Russlands Vollinvasion in die Ukraine nun schon an, mehr als zehn der Krieg im Donbas – und ein Ende der täglichen Zerstörung und des tausendfachen Sterbens sind noch immer nicht in Sicht. Nicht nur reißen die Angriffe auf Städte und Ortschaften im ganzen Land nicht ab, auch an der Front ist die Lage für die Ukraine derzeit ausgesprochen düster. Trotz mutmaßlich hoher Verluste rücken die russischen Streitkräfte seit Monaten langsam, aber stetig Meter um Meter vor.[2] Und wo sie nicht weiterkommen, werfen sie tonnenschwere Gleitbomben auf frontnahe Dörfer und Siedlungen. Rund 18 Prozent des ukrainischen Territoriums – beinahe ein Fünftel des Staatsgebiets – befinden sich derzeit unter russischer Kontrolle. Über tausend Kilometer zieht sich die Frontlinie durchs Land: von der Großstadt Charkiw im Nordosten bis nach Cherson im Süden, das nach Monaten unter russischer Besatzung im November 2022 von der ukrainischen Armee befreit wurde.[3]
In der westlichen Öffentlichkeit werden indes seit Monaten Rufe nach Verhandlungen mit Russlands Machthaber Wladimir Putin laut – erst recht, seit der ehemalige und neue US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf damit geprahlt hatte, den Krieg „in 24 Stunden“ zu beenden. Eine Aussage, von der er im Übrigen inzwischen abgerückt ist: Mittlerweile ist nur noch von der Hoffnung auf ein Kriegsende in den kommenden sechs Monaten die Rede.
Auch Trump und seinen Berater:innen dürfte unterdessen klar geworden sein, dass ein Waffenstillstand nicht so einfach erzwungen werden kann, wie sie sich das in ihrer Megalomanie vorgestellt hatten. Trumps Ukraine-Sondergesandter Keith Kellogg nannte für ein Kriegsende denn auch ein Zeitfenster von „hundert Tagen“. Der pensionierte General gehört zu den Autoren eines Plans für ein rasches Einfrieren der Kämpfe.[4] Um die Kriegsparteien an einen Tisch zu bringen, soll Kyjiw demnach mit einem Ende der militärischen Unterstützung gedroht werden – und dem Kreml umgekehrt mit weiterer Aufrüstung der Ukraine. Inwiefern Trump diesem Plan folgt, ist derzeit nur schwer abzuschätzen.
Gebiete gegen Garantien?
Angesichts der desolaten Lage an der Front und einer zunehmend erschöpften Bevölkerung bleibt Präsident Selenskyj indes wenig anderes übrig, als sich mit der Unberechenbarkeit einer Trump-Präsidentschaft zu arrangieren und gute Miene zum unvorhersehbaren Spiel zu machen, gehörten die USA bisher doch zu den Hauptunterstützern der Ukraine. Entsprechend kommt keine Äußerung Selenskyjs über den neuen starken Mann in Washington ohne schmeichelnde Worte aus. Besonders bemerkenswert war in diesem Kontext ein Interview, das der ukrainische Präsident Anfang Januar dem einflussreichen US-Podcaster Lex Fridman gab.[5] Fridman, dessen Sendung mit ihren vier Millionen Abonnent:innen zu den meistgehörten des Landes zählt, befragt am liebsten Personen aus dem rechtskonservativen und -libertären Milieu – auch sein Publikum ist politisch überwiegend dort zu verorten. Entsprechend kann Selenskyjs Besuch als Versuch einer Kommunikation mit dem Lager von Trump und dessen wichtigstem Berater, Tech-Milliardär Elon Musk, gewertet werden.
Die Botschaft, die Selenskyj in dem mehr als dreistündigen Gespräch an dieses Lager aussandte: Für Friedensverhandlungen mit dem Kreml benötigt Kyjiw von den westlichen Mächten verbindliche Sicherheitsgarantien, dann sei das Land womöglich bereit, auf die besetzten Gebiete zu verzichten. Die stärkste Versicherung dafür, dass Russland sein Nachbarland nicht in ein paar Monaten oder Jahren erneut angreift, wäre – da sind sich die meisten Expert:innen einig – eine Nato-Mitgliedschaft für jene Gebiete, die sich derzeit unter ukrainischer Kontrolle befinden.
Um zu verhindern, dass Russland aufrüsten und seine Kriegskasse erneut auffüllen kann, wären weiterhin westliche Waffenlieferungen notwendig, auch die Sanktionen müssten bestehen bleiben, so Selenskyj im Gespräch mit Podcaster Fridman. Der Verzicht auf die Krim und die besetzten Teile des Donbas seien allerdings bloß vorübergehend, betonte er, langfristig sollten die Gebiete auf diplomatischem Weg zurückerobert werden. Putin wiederum hat wiederholt klargemacht, dass er sich mit der Ukraine überhaupt erst an einen Tisch setzen wird, wenn die Nato-Mitgliedschaft vom Tisch ist. So schnell wie Trump sich Friedensgespräche wünschen mag, dürften diese also nicht beginnen. Um seine Position am Verhandlungstisch zu stärken, versuchte Selenskyj unterdessen, auf dem Schlachtfeld Tatsachen zu schaffen, etwa mit einer neuerlichen Offensive in der russischen Region Kursk.[6]
Die vorläufige Aufgabe der besetzten Gebiete gegen wirksame Sicherheitsgarantien: Diese Position der Regierung teilen inzwischen auch immer mehr Ukrainer:innen. So haben Umfragen in allen von Kyjiw kontrollierten Gebieten aus dem Dezember gezeigt, dass immer mehr Menschen unter bestimmten Bedingungen zu territorialen Konzessionen bereit sind.[7] „Einerseits will die Mehrheit der Bevölkerung – 58 Prozent im Oktober, 51 im Dezember – noch immer keine Konzessionen“, so Anton Hruschetskyj, der Direktor des Kyiv International Institute of Sociology (KIIS), das die Befragungen durchführte. Werde diese Frage aber mit einer Nato- und EU-Mitgliedschaft verbunden, könnten 64 Prozent sich vorstellen, die Befreiung von Krim und Donbas aufzuschieben. Was die Millionen Menschen in den besetzten Gebieten darüber denken, dass ihre Zukunft quasi als Faustpfand für einen Waffenstillstand herhalten muss, lässt sich allerdings nicht eruieren.
Auch sonst sind die neuesten Zahlen des KIIS aufschlussreich: Hatten Ende 2022 noch 88 Prozent der Befragten geglaubt, die Ukraine werde in zehn Jahren prosperierendes EU-Mitglied sein, gingen Ende 2024 nur noch 57 Prozent von diesem Szenario aus. Und gaben letzten Februar noch 73 Prozent zu Protokoll, sie seien bereit, den Krieg „so lange wie nötig“ zu ertragen, betrug auch ihre Zahl zuletzt nur noch 57 Prozent. Klar ist: Je näher jemand an der Front lebt, je öfter er oder sie regelmäßigen Angriffen ausgesetzt ist, desto eher ist diese Person bereit, ein Abkommen zu akzeptieren.
Mobilisierung zum Kriegsdienst: Intransparent und sozial ungerecht
Viele Debatten in der Ukraine werden derzeit vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen hinsichtlich der Frage der Mobilisierung geführt. Denn dem ukrainischen Militär fällt es zunehmend schwer, kampfwillige Soldat:innen zu rekrutieren. Die meisten, die bereit waren, selbst in den Krieg zu ziehen, haben sich in den ersten Monaten der Vollinvasion zum Dienst gemeldet. Offizielle Zahlen dazu existieren aber nicht. Stattdessen sollen, dem ukrainischen Generalstaatsanwalt zufolge, seit Februar 2022 über 100 000 Verfahren wegen „Desertion“ eröffnet worden sein. Immer zahlreicher werden Berichte über Soldaten, die sich krankmelden und nie mehr zu ihren Einheiten zurückkehren oder sich gleich ganz absetzen.[8]
Ein besonderer Streitpunkt ist die im Kriegsrecht nicht vorgesehene Demobilisierung: Viele, die teils seit Beginn der Invasion 2022 kämpfen, wissen noch immer nicht, wann sie die Front wieder verlassen können. Dass derart unabsehbar ist, wie lange die Einsätze dauern, dürfte nicht gerade dazu beitragen, mehr kampfwillige Personen zu finden. Zwar ist im vergangenen Frühling ein neues Mobilisierungsgesetz in Kraft getreten, das unter anderem das dienstfähige Alter von 27 auf 25 Jahre herabsetzte und die Strafen für die Kriegsdienstverweigerung verschärfte, aber die Frage der Demobilisierung wurde dabei ausgeklammert. Und auch sonst hat die Maßnahme kaum zu einer Lösung der Probleme beigetragen.
„Selenskyj tut so, als gäbe es das Problem nicht“, kritisiert Inna Sowsun, Parlamentsabgeordnete der liberalen Oppositionspartei Holos, in der Schweizer „Wochenzeitung“.[9] Aus Angst davor, weiter an Beliebtheit zu verlieren, lasse er die Soldaten im Stich, dabei könne nur die Aussicht auf eine Demobilisierung die Suche nach neuen Freiwilligen beschleunigen. Was Sowsun ebenfalls stört, ist die intransparente und sozial ungerechte Rekrutierung: „Menschen aus dem ländlichen Raum sind überproportional betroffen, vor allem ärmere Menschen.“ Auch jene mit einem niedrigeren Bildungsniveau würden häufiger eingezogen.
Für Kritik sorgt aber auch die behördliche Mobilisierungspraxis: Leistet jemand einer Vorladung nicht Folge, kann er unter Zwang zum Militärkommissariat gebracht werden. In den Medien häufen sich Berichte über junge Männer, die aus Angst vor einer Rekrutierung das Haus kaum noch verlassen; auch in persönlichen Gesprächen erzählen Bekannte immer wieder von Beamt:innen, die Rekrutierungsunwilligen an U-Bahn-Stationen auflauern. So gelangen nicht selten auch kriegsuntüchtige Männer an die Front. „Kürzlich haben wir 90 Personen aufgenommen, aber nur 24 von ihnen waren bereit, eine Stelle anzutreten. Der Rest war alt, krank oder alkoholabhängig. Vor einem Monat liefen sie noch in Kiew oder Dnipro herum, jetzt liegen sie in einem Graben und können kaum eine Waffe halten. Schlecht ausgebildet und schlecht ausgerüstet“, beschrieb der Soldat einer Territorialverteidigungsbrigade die Situation kürzlich dem „Guardian“.[10]
Die ukrainische Autorin Yevgenia Belorusets hat diese Widersprüche zuletzt treffend in einem Essay beschrieben: „Es ist schwer, es zu akzeptieren, aber von denen, die jetzt in den Krieg ziehen, werden nur wenige nach Hause zurückkehren. So sehe ich das. Diejenigen, die von Anfang an dabei waren, wissen, wie man kämpft, und wollen kämpfen. Diejenigen, die jetzt dazukommen, sind die, die sich nicht verstecken konnten.“[11] Die Debatten über die Mobilisierung machen deutlich: Der Krieg, er ist am Ende immer auch eine Klassenfrage.
Aber auch jenseits der Front haben die vergangenen drei Jahre deutliche Spuren in der ukrainischen Gesellschaft hinterlassen. Beispielhaft dafür steht die mentale Gesundheit. Expert:innen sprechen mittlerweile von einer Krise, weil immer mehr Menschen auf therapeutische Unterstützung oder Antidepressiva angewiesen sind.[12] Je länger der Krieg dauert, desto mehr schlagen die täglichen Luftangriffe, die Trauer über den Verlust von Angehörigen und Freund:innen, der Mangel an Perspektiven, aber auch die Erlebnisse im Einsatz an der Front den Ukrainer:innen aufs Gemüt, führen zu Burn-out, Panikattacken und anderen psychischen Leiden. Der adäquate Umgang mit den Traumata von Millionen Menschen wird auch nach einem etwaigen Ende des Krieges eine der großen Herausforderungen bleiben – und eine für die kommenden Generationen.
Traumatisierte Menschen, ein auf Effizienz getrimmtes Gesundheitssystem
Ohnehin ist die Situation im Gesundheitsbereich verheerend: Seit Februar 2022 sind laut Zählungen der Weltgesundheitsorganisation über 1900 Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen im Land beschossen und teilweise zerstört worden.[13] Hinzu kommt der anhaltende Druck auf die Beschäftigten: Nicht nur steigt die Arbeitsbelastung für das Gesundheitspersonal immer weiter, sowohl an der Front als auch im Hinterland, sondern auch die neoliberalen Reformen der vergangenen Jahre verschärfen das Problem.
Der Spardruck führt dazu, dass kompetente Pflegekräfte entlassen, Gehälter gekürzt oder nicht gezahlt und Krankenhäuser geschlossen werden. Die linke Basisorganisation Sozialnyi Ruch warnt gemeinsam mit der Pflegegewerkschaft #БудьякНіна (zu Deutsch: Sei wie Nina) seit langem vor den Folgen eines auf Effizienz getrimmten Gesundheitswesens. In einem Post auf Facebook machte die Organisation kürzlich auf die Schließung des Bezirkskrankenhauses in der zentralukrainischen Stadt Poltawa mit etwa 300 000 Einwohnern aufmerksam: „In einer Stadt, die heute Tausende von Binnenvertriebenen beherbergt, kommt diese Entscheidung einer kriminellen Nachlässigkeit gleich. Die bereits überlastete medizinische Infrastruktur wird noch weiter reduziert werden“, schreiben die Aktivist:innen. In der aktuellen Situation Krankenhäuser aus Kostengründen zu schließen, setze die Gesundheit der Bevölkerung aufs Spiel.[14]
Sozialnyi Ruch übt aber auch sonst harsche Kritik an der Regierung Selenskyj. Mit ihrer antisozialen wie arbeiter:innenfeindlichen Politik schwäche diese die Verteidigungsbereitschaft der Bevölkerung. „Der vorherrschende Einfluss der Vorstellungen eines freien Marktes hat die ukrainische Kriegswirtschaft zur Karikatur verzerrt. Die Unwilligkeit der Regierung, Produktionskapazitäten zu verstaatlichen, große Unternehmen mit hohen Steuern zu belegen und den Haushalt in Richtung Aufrüstung umzuschichten, führt zur Verlängerung des Krieges – um den Preis erheblicher menschlicher Verluste und eines ständigen Mobilisierungszustands“, schreibt die Gruppe in einer Resolution.[15] Zu den Forderungen von Sozialnyi Ruch gehören ein „transparenter Dialog“ mit der Bevölkerung über „die erreichbaren Kriegsziele“ sowie eine klare Regelung zur Dauer des Militärdienstes.
»Ein Gulag aus über hundert Gefängnissen, Lagern und Kellern«
Während die ökonomischen und sozialen Folgen des russischen Angriffskriegs in der Gesellschaft breit diskutiert werden, läuft ein anderes Thema oft unter dem Radar der Öffentlichkeit: die desolate Situation in den von Russland besetzten Gebieten. Über das Leben der Menschen dort dringt nur wenig nach draußen, da weder unabhängige Journalist:innen noch Menschenrechtler:innen Zugang zur Region haben. Kürzlich sprach ein Team der „New York Times“ mit ehemaligen Gefangenen, Menschenrechtsorganisationen und ukrainischen Behörden. Die Reporter:innen beschrieben ein brutales, bürokratisch institutionalisiertes System – einen „Gulag aus über hundert Gefängnissen, Haftanstalten, informellen Lagern und Kellern, die an die schlimmsten sowjetischen Exzesse erinnern“.[16]
Das Ziel von Moskaus Politik ist demnach die Auslöschung der ukrainischen Identität; zu den Mitteln, um dieses Ziel zu erreichen, gehören Umerziehung, Folter und Propaganda, die Verteilung russischer Pässe und die Deportation von Kindern nach Russland. Auch ein aktueller UN-Bericht stützt diesen Eindruck.[17] „Die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung steigt weiter an, Hinrichtungen und Folterungen von Kriegsgefangenen werden fortgesetzt, und Russland versucht, seine Kontrolle über die besetzten ukrainischen Gebiete zu festigen“, heißt es darin.
Die Vergabe der russischen Staatsbürgerschaft – eine imperiale Praxis, die auf Russisch „Pasportizatsija“ (Passportisierung) genannt wird und auch schon in anderen „postsowjetischen“ Staaten, etwa in Georgien, zur Anwendung kam –, dient unter anderem dazu, die Bevölkerung zum Gehorsam zu zwingen: Wer sich weigert, verliert den Zugang zu medizinischer Versorgung, zur Rente oder im Falle von Beamt:innen zum Lohn, auch andere soziale Leistungen werden gestrichen.[18] Gemäß eines präsidialen Dekrets werden Menschen ohne russischen Pass seit Januar als „Ausländer:innen“ angesehen und als „Gefahr für die verfassungsmäßige Ordnung und die nationale Sicherheit“ verfolgt. Das Überleben unter der Besatzung ohne russischen Pass wird dadurch praktisch unmöglich. Klar ist: In den annektierten Gebieten hat Russland längst brutale Tatsachen geschaffen. Das tägliche Leid der Millionen dort lebenden Ukrainer:innen nicht aus den Augen zu verlieren, wird eine der großen Herausforderungen in den Debatten über einen Waffenstillstand sein.
* Der Text ist vor Drucklegung am 22.1.2025 entstanden.
[1] Vgl. x.com/ZelenskyyUa/status/1875241675359957389.
[2] Vgl. liveuamap.com/#google_vignette.
[3] Steven Bernard und Christopher Miller, Ukraine’s battle against Russia in maps and charts: latest updates, ft.com, 6.1.2025.
[4] Keith Kellogg, Fred Fleitz, America First, Russia & Ukraine, americafirstpolicy.com, 11.4.2024.
[5] Volodymyr Zelenskyy: Ukraine, War, Peace, Putin, Trump, NATO, and Freedom, Lex Fridman Podcast #456, lexfridman.com, 4.1.2025.
[6] Will Vernon, Amy Walker und Patrick Jackson, Ukraine renews attack on Russia’s Kursk region, bbc.com, 6.1.2025.
[7] Dynamics of readiness for territorial concessions and the factor of security guarantees for reaching peace agreements, kiis.com.ua, 3.1.2025.
[8] Daniel Bellamy, Tens of thousands of soldiers have deserted from Ukraine’s army, euronews.com, 30.11.2024.
[9] Daniela Prugger, Die schwierige Frage, wer kämpfen muss, woz.ch, 16.5.2024.
[10] Shaun Walker, Ukraine faces difficult decisions over acute shortage of frontline troops, guardian.co.uk, 21.12.2024.
[11] Yevgenia Belorusets, Die Einberufung, blnreview.de, 7.6.2024.
[12] Daniela Prugger, Die Ängste vergessen, woz.ch, 9.1.2025.
[13] Grim milestone on World Humanitarian Day: WHO records 1940 attacks on health care in Ukraine since start of full-scale war, who.int, 19.8.2024.
[14] Poltava hospital closure: the government’s indifference to the people and the needs of the military, facebook.com, 10.1.2025.
[15] Resolution „The path to victory and the tasks of the Ukrainian left“, rev.org.ua, 21.10.2024.
[16] Carlotta Gall und Oleksandr Chubko, Ukrainians Tell of Brutal Repression in Occupied Territories, nytimes.com, 30.10.2024.
[17] United Nations Human Rights Office, Report on the Human Rights Situation in Ukraine, ukraine.ohchr.org, 31.12.2024.
[18] Nikolay Petrov, Russia in the Occupied Territories of Ukraine, swp-berlin.org, 5.9.2024.