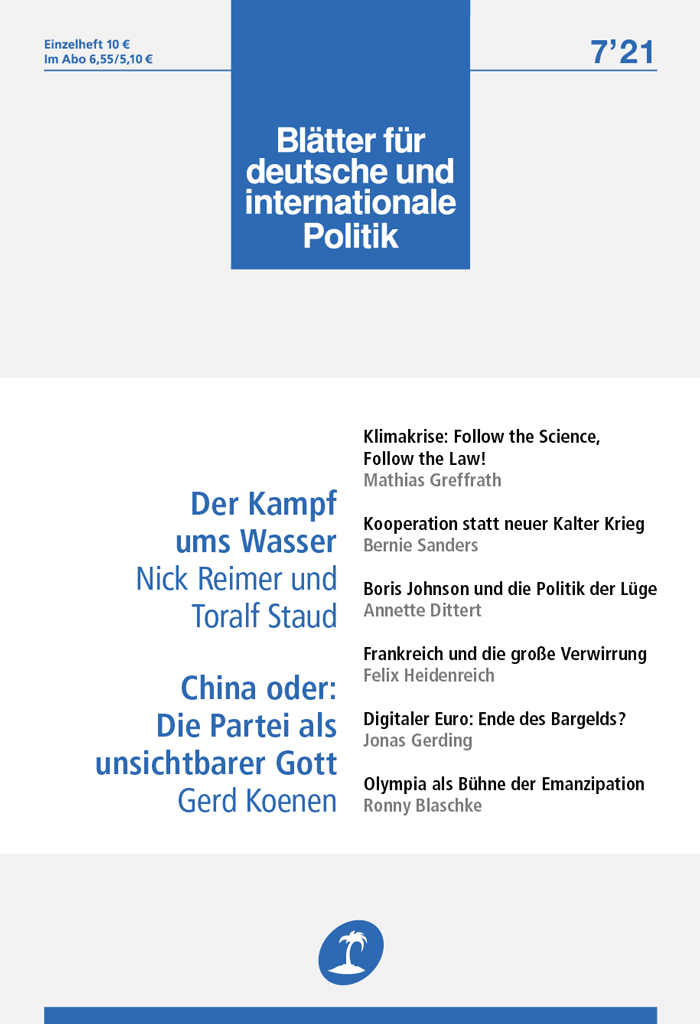Macrons Kampf um den inneren Frieden

Bild: Ein französischer Soldat patrouilliert den verlassenen Trocadero-Platz in der Nähe des Eiffelturms in Paris, 30.10.2020 (IMAGO / IP3press)
Knapp ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen im April 2022 herrscht in Frankreich eine Stimmung der Anspannung, der Verwirrung, der intellektuellen und politischen Verunsicherung. Alles scheint plötzlich möglich, selbst ein Sieg der rechtsradikalen Marine Le Pen. Daran ändert auch das starke Abschneiden der Volksparteien bei den Regionalwahlen Ende Juni nicht viel, zumal die Kandidaten der Regierungspartei La République En Marche nur schwache Ergebnisse erzielten.
Ein Grund für diese Stimmung ist die Kette nicht abreißender schlechter Nachrichten gerade aus den kleineren, unscheinbaren Orten, die sich im Internet rasant verbreiten. Unzählige Videos dokumentieren gewaltsame Zusammenstöße zwischen der Polizei und Jugendlichen in den Vorstädten, zuletzt etwa im kleinen Städtchen Tourcoing an der niederländischen Grenze. Immer wieder kommt es dabei zu Situationen, in denen die Polizei in die Defensive gerät, ja sich schließlich zurückziehen muss und damit das Gewaltmonopol des Staates aufgibt. Die Ermordung des Polizisten Eric Masson, ein 36jähriger Vater zweier Mädchen, der Anfang Mai in Avignon bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurde, schockierte die Nation.
Zum Bild einer um sich greifenden Anomie tragen auch Szenen bei, die längere Schusswechsel zwischen konkurrierenden Drogengangs in den Vororten von Marseille, aber auch kleinen Städten wie Montpellier zeigen. Dort filmen Anwohner immer wieder, wie Bandenmitglieder ganz entspannt die Kalaschnikow nachladen, bevor sie weiterschießen. Im Februar 2021 starben in Saint-Chéron zwei Minderjährige bei einem Kampf zwischen 60 Jugendlichen, die ihre Drogenmärkte mit aller Härte verteidigten. Für das Jahr 2020 zählt das Innenministerium 357 derartige Zusammenstöße. Bisweilen hält der Ordnungsschwund auch länger an. So lieferten sich Mitte Juni 2020 arabische Gruppen und aus ganz Europa angereiste Tschetschenen in Dijon über Tage hinweg Straßenschlachten und Schießereien. Ein Tschetschene war zuvor offenbar von einer arabischen Straßengang angegriffen worden. Nun nahm man mit Eisenstangen und Handfeuerwaffen kollektiv Rache. Für Marine Le Pen sind Zustände wie diese ein Fest; sie adressiert Emmanuel Macron regelmäßig als den „Präsidenten des Chaos“.
Doch die Klage um solche Zustände ist nicht neu: „Les territoires perdus de la République“, „die verlorenen Gebiete der Republik“, lautete schon 2002 der Titel eines von dem Historiker Georges Bensoussan (unter dem Pseudonym Emmanuel Brenner) herausgegebenen Buches. Auch heute ist die Grenze zwischen hysterischer Übertreibung und fragwürdigen Untergangsszenarien einerseits und nüchterner Krisendiagnose andererseits nicht leicht zu ziehen. Stehen die Dinge wirklich so schlimm? Jedenfalls hat das zumindest teilweise gut begründete Gefühl zunehmender Anomie eine immer größere Verunsicherung zur Folge.
Wie sich diese Unsicherheit auf der ideenpolitischen Ebene spiegelt, beschreibt der Politikwissenschaftler Phillipe Corcuff in seinem Buch „La grande confusion“. Als eine „große Verwirrung“, als confusionisme, ein geradezu zur Ideologie gewordenes Durcheinander erweist sich in seiner Rekonstruktion das politische Feld und die öffentliche Debatte im Journalismus und unter Intellektuellen. Corcuff lehrt Politikwissenschaft in Lyon und blickt mit einer gewissen analytischen Kälte auf eine Rechtsverschiebung des Diskurses in Frankreich. In seiner fast 700 Seiten umfassenden Studie versucht er zu erklären, wie sich die französische Öffentlichkeit in eine heillose „Trumpisierung“ bewegen konnte, in der die ideologischen Grenzen zwischen einer sich ökologisch gebenden Rechten sowie einer in Teilen protektionistischen und auf die EU schimpfenden Linken verwischen. Schon lange ist bekannt, dass sich nicht nur die – in Frankreich inzwischen verbotene – „Identitäre Bewegung“, sondern auch Le Pens Rassemblement National der inszenatorischen Techniken der postmodernen Linken und der auf Antonio Gramsci zurückgehenden Praktiken eines ideologischen Hegemoniestrebens bedient. Corcuff zeigt nun, dass zugleich bei vermeintlich linken Intellektuellen plötzlich nationale, ja nationalistische Tonlagen angespielt werden. Diese Verwirrung trage wesentlich dazu bei, dass die extreme Rechte immer weitere ideologische Geländegewinne verbuchen kann. Frankreich, so seine These, sei nur ein Beispiel dafür, wie es der extremen Rechten gelinge, „die Schlacht der Ideen“ zu gewinnen. Früher Unsagbares wird heute zur besten Sendezeit unwidersprochen vom Stapel gelassen.
Frankreichs politische Kultur wurde oft anhand des Konflikts von „Straße“ und „Hof“ erklärt: In einem Land ohne starke liberale Tradition geistert die Vorstellung eines republikanischen Volkswillens herum, der sich spontan und unvermittelt äußert. Eine sich darauf beziehende diffuse Kritik am „System“ ist in Frankreich weit verbreitet. Auch die französische Linke macht „die Medien“ und „den Neoliberalismus“ zur Adresse oft geradezu verschwörungstheoretisch anmutender Anschuldigungen. Kein Wunder also, dass genuine Verschwörungstheorien in Frankreich seit Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Dies gilt ganz besonders für das auf den rechten Theoretiker Renaud Camus zurückgehende Narrativ, demzufolge die europäischen Eliten die Bevölkerung des Kontinents durch gefügigere Immigranten austauschen würden. Ob es diesen „großen Austausch“ gibt und woran er zu erkennen wäre, ist in Frankreich inzwischen zum Dauerthema geworden. In diesem Zusammenhang wird sogar immer wieder über eine „Remigration“ bestimmter Bevölkerungsteile gesprochen – eine rechtsextreme Chiffre, hinter der sich oft die Phantasie der ethnischen Säuberung verbirgt.
Neben dem imaginierten Gegensatz von „Straße“ und „Hof“ ist es vor allem der „verticalisme“, der die politische Imagination in Frankreich prägt. Bei aller Kritik an Napoleon, dessen 200. Todestag gerade Anlass zur kritischen Aufarbeitung seiner kolonialen Taten gab, besteht manchmal eine Sehnsucht nach der schnellen Top-down-Lösung im Namen des „Volkes“, ausgeführt von einem Ersatzmonarchen. Der ehemalige konservative Präsident Nicolas Sarkozy hatte einen „Bruch“ versprochen, Macron gar eine „Revolution“. Da stört es erheblich, dass sich die komplexen Probleme in einer pluralistischen, multikulturellen und ökonomisch global vernetzten Gesellschaft mit solchen Methoden kaum beheben lassen.
Doch aus dem Gegensatz von volltönenden Ankündigungen und einer von notwendigen Kompromissen geprägten Regierungswirklichkeit erwächst das Gefühl einer strukturellen Überforderung des Staates. Vielleicht erklärt das den überraschenden Pessimismus der Französinnen und Franzosen. So bekundeten 2017 laut einer Allensbach-Studie 86 Prozent der Deutschen, ihr Land stehe derzeit wirtschaftlich gut da, während in Frankreich schon damals geradezu spiegelbildlich verkehrt 75 Prozent der Befragten die wirtschaftliche Situation ihres Landes für schlecht hielten.[1] Die Coronapandemie hat diesen Pessimismus nur noch verstärkt. Seit Jahren schleicht sich eine negative Grundstimmung in alle Poren der Gesellschaft – obwohl es sich an objektiven Zahlen gemessen nach wie vor kaum irgendwo so gut leben lässt wie in Frankreich: Die dortige Lebenserwartung ist höher als in Deutschland und es gibt auch deutlich mehr Kinder. Selbst beim Privatvermögen pro Kopf liegt Frankreich deutlich vor seinem rechtsrheinischen Nachbarn.
Der diffuse Pessimismus sucht sich indes seine Schuldigen, und das nicht immer mit viel Sorgfalt. Der Soziologe Jérôme Fourquet spricht in einer – 2019 mit dem Preis für das beste politische Buch ausgezeichneten – Studie von einer Gesellschaft, die wie ein Archipel in einzelne Atolle um ein leeres Zentrum zerfällt. In der Tat unterscheidet sich das Leben in den feinen Pariser Arrondissements mit den elitären Gymnasien fundamental von den Umständen, mit denen man in der Banlieue oder der France profonde, dem „abgehängten“ ländlichen Frankreich konfrontiert ist. Die Kommunikation zwischen diesen verstreuten Inseln läuft oft darauf hinaus, dass man sich gegenseitig vorwirft, nicht zu wissen, wovon die Rede ist.
Samuel Paty – ein einsamer Held
Drastisch verstärkt wird dieses Unsicherheitsgefühl seit Jahren durch die zahlreichen islamistischen Terroranschläge. In der Folge hat sich in der Auseinandersetzung mit Islam und Islamismus die Stimmung in Frankreich stark verändert. So hat insbesondere die brutale Ermordung von Samuel Paty im vergangenen Oktober in Frankreich eine Schockwelle ausgelöst, deren Fernwellen in Deutschland nicht angemessen wahrgenommen wurden. Der Gemeinschaftskundelehrer war von einem jungen Tschetschenen enthauptet worden, nachdem in sozialen Medien das Gerücht gestreut worden war, er habe Muslime beleidigt oder diskriminiert, als er über die Mohamed-Karikaturen aus „Charlie Hebdo“ diskutieren ließ – und diese zeigte. Dabei ist gerade die École républicaine nach französischem Selbstverständnis eine Art heiliger Ort, ein Tempel jener Zivilreligion, die die Republik zusammenhalten und die Bürgerinnen und Bürger zu mündigen und aufrechten Menschen erziehen soll.
Der Mord schob nur das Brennglas über jene Zustände, die seit Jahren von Lehrerinnen und Lehrern beklagt und von der Soziologie thematisiert werden: Viele Lehrkräfte sehen sich nicht mehr in der Lage, ungezwungen, ohne Angst vor Anfeindungen oder Gewalt, jene Themen zu unterrichten, die vor allem bei muslimischen Schülerinnen und Schülern auf Ablehnung stoßen oder in Kollision mit religiösen Überzeugungen geraten: Sexualkunde und Homosexualität, der Holocaust, Israel und der Nahostkonflikt, Kolonialismus und arabischer Sklavenhandel, Meinungsfreiheit, Atheismus und Blasphemie – das Spektrum an heiklen Themen ist groß.
Eine besondere Bitterkeit riefen die Umstände des Mordes an Samuel Paty hervor: Er hatte um Hilfe gebeten, doch erfuhr offenbar weder die Solidarität des Kollegiums noch Unterstützung durch die Schulbehörde.[2] Selbst schuld, wenn man mit muslimischen Schülern über Voltaire und das Recht auf Blasphemie spricht und ihnen dabei auch noch die Karikaturen aus „Charlie Hebdo“ zeigt, so schien man zu denken. Dass ihn offenbar einige Schüler für ein Taschengeld an seinen Mörder verrieten, warf ein Schlaglicht auf die sozialen Spannungen. Eine Kultur der Einschüchterung trat ans Licht.
Die Staatsspitze reagiert seither auf ein breit geteiltes Bedürfnis nach Taten, nicht nach Worten. Selbst linke Intellektuelle fordern eine Umkehr der Einschüchterung: Warum müssen wir Angst haben, während sich die Islamisten sicher fühlen? Dieser Tenor prägte kürzlich auch eine Demonstration von Polizisten, die des ermordeten Kollegen Eric Masson gedachten. Dort war erneut jener Satz zu hören, den Macron nach der Tötung Patys formulierte: „La peur doit changer de camp.“[3] Angst sollen endlich die anderen haben – die Islamisten, aber auch die Mitglieder von Drogenbanden, die viele Vororte aber auch so „normale“ Viertel wie das Pariser 19. Arrondissement im Griff haben.[4]
Tatsächlich verfügt Frankreich inzwischen über eine traumatische Erfahrung mit islamistischem Terror. Das Bataclan-Massaker, der Anschlag auf der Strandpromenade von Nizza, Morde an Priestern, die Enthauptung von betenden Christen, der Mord an einem jüdischen Lehrer und seinen Söhnen – in Deutschland steht vielen nicht vor Augen, wie tief die Wunden sind, die diese Ereignisse geschlagen haben. In Frankreich ist das Militär im Inland im Einsatz, nicht nur zum Schutz von Bahnhöfen. Selbst in kleineren Städten wie Grenoble oder Nancy patrouillieren Infanteristen in Sechser- oder Zwölfergruppen mit schweren Maschinengewehren und Munitionskisten. Nie wieder soll, wie am 13. November 2015[5] in Paris geschehen, im Falle eines Angriffs die Munition ausgehen. Frankreich befindet sich nicht nur formell in einem Ausnahme-, ja einer Art Kriegszustand.
In Deutschland ist auch wenig bekannt, dass bereits seit 2015 davon ausgegangen wird, dass der französische Auslandsgeheimdienst DGSE eine „Kill List“ führt und allein der sozialistische Präsident François Hollande in seiner Amtszeit rund 40 gezielte Tötungen von Islamisten in Auftrag gab. Frankreich bedient sich also – wie der Journalist Vincent Nouzille glaubwürdig zeigt – systematisch jener Methoden, die man klassischerweise mit der amerikanischen und israelischen Terrorbekämpfung assoziiert. Das trifft in der Bevölkerung aber durchaus auf Unterstützung.[6]
Was tun gegen das Vordringen des Islamismus?
Härte ist also in Frankreich nichts Neues. Und doch führte die Ermordung Patys zu einer Art Paradigmenwechsel. Macron reagierte zunächst mit einer ganzen Reihe von Razzien, Festnahmen und Vereinsverboten. Die „Gefährder“ heißen in Frankreich „fiché S“ (wörtlich in etwa: „eingruppiert als Sicherheitsrisiko“); ihre Zahl ist enorm hoch. Bereits 2015 hatte der damalige Innenminister Manuel Valls deren Anzahl mit 20 000 beziffert, neuere amtliche Angaben gibt es nicht. In ganz Frankreich kam es in den Tagen nach dem Mord zu zahlreichen Festnahmen. Eingewanderte Gefährder sollen wenn möglich ausgewiesen werden.
Jedoch erschöpft sich Macrons Ansatz nicht in Repression. Bereits vor dem Mord an Paty hatte er in seiner vielzitierten Rede vom 2. Oktober 2020 auch Kritik an der mangelnden Integrationsarbeit des Staates geübt, der den Bewohnern der Vorstädte zu wenig materielle Perspektiven biete. Gemeint sind in diesem Kontext Muslime; in Frankreich darf ein Migrationshintergrund in offiziellen Statistiken nicht erfasst werden, da dies dem republikanischen Gleichheitsideal widerspricht. Macron hielt diese Rede nicht zufällig in Les Mureaux im Département Yvelines. Aus diesem Provinznest mit rund 30 000 Einwohnern waren mehr als 70 Personen nach Syrien in den Krieg gezogen. Das Städtchen gilt als eines der vielen Kampfplätze der Republik. Macrons offene Worte über die Exklusionsmechanismen der französischen Gesellschaft, in der die Exklusion durch die „Mitte der Gesellschaft“ und die Selbstexklusion oft Hand in Hand gehen, waren aber nur der Anfang. Noch immer steht die Frage im Raum: Was tun gegen das Vordringen des politischen Islam?
Macrons Antwort besteht in einem beispiellosen Vorhaben: das sogenannte Gesetz über den Separatismus, dessen offizieller Name „Gesetz zur Wiederherstellung des Respekts vor den Prinzipien der Republik“ lautet. Wer sich den Text ansieht, stellt fest, dass es sich um ein Gesetzespaket handelt, das ganz verschiedene, nur lose verbundene Bereiche abdeckt. So sollen die Verharmlosung oder Verteidigung von terroristischen Taten viel härter als bisher bestraft werden; ebenso die Gefährdung von Personen durch die Verbreitung privater Informationen im Internet; die Neutralität in öffentlichen Einrichtungen soll energischer verteidigt werden, öffentliche Unterstützung an schärfere Bedingungen geknüpft werden. Außerdem soll verschärft gegen Polygamie oder frauendiskriminierende Praktiken im Familienrecht vorgegangen werden.[7]
Das blieb natürlich nicht ohne Widerspruch. Dieser erfolgte nicht nur auf Demonstrationen in Paris, sondern auch aus dem Ausland. Adam Nossiter beschrieb beispielsweise im Dezember 2020 in der „New York Times“ die französischen Maßnahmen gegen den Islamismus als Schritt in einen autoritären Staat, in dem Lehrerinnen und Lehrer dazu angehalten werden, ihre Schüler zu denunzieren. Dabei konnte er sich auf kritische Stimmen aus Frankreich berufen, nicht zuletzt auf den Politikwissenschaftler Olivier Roy, der die Maßnahmen der Regierung für kontraproduktiv erklärte. Rund zehn Prozent der französischen Bevölkerung würden unter Generalverdacht gestellt und in die Isolation getrieben, lautete der Tenor. Die französische Debatte kreist dabei immer wieder um die Frage, ob sich tatsächlich die Muslime radikalisieren oder ob vormals kaum religiöse, oft kriminelle Außenseiter zum Islamismus finden: Radikalisierung des Islam oder Islamisierung der Kriminalität?
Die Virulenz des Antisemitismus
Wie immer man diese Frage auch beantworten wird: Besonders dramatisch ist die emotionale (und in vielen Fällen auch tatsächliche Situation) der französischen Jüdinnen und Juden. Eine besondere Bedeutung kommt daher der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus zu. Nicht erst seit dem vierfachen Mord vor einer jüdischen Schule in Toulouse im März 2012 und dem islamistischen Angriff mit anschließender Geiselnahme auf einen koscheren Supermarkt im Januar 2015 setzte in der großen jüdischen Community in Frankreich – die nach wie vor die größte in Europa ist – eine Debatte darüber ein, ob man sich im Land noch sicher fühlen könne. Als jüdische Familie in muslimisch geprägten Vororten zu leben, ist beinahe unmöglich geworden. Genaue Zahlen liegen nicht vor, denn Phänomene der Belästigung und subtilen Bedrohung sind nur schwer fassbar. Daher sind es immer wieder Einzeltaten, die herausragen und ein Bedrohungsgefühl erzeugen. Zuletzt sorgt etwa der Fall Sarah Halimi für Empörung. Die 65jährige pensionierte jüdische Ärztin war im April 2017 von einem aus Mali stammenden Mann schwer misshandelt und schließlich ermordet worden. Doch die Justiz erklärte den polizeibekannten notorischen Straftäter ob seines massiven Alkohol- und Cannabiskonsums im April diesen Jahres letztinstanzlich für nicht zurechnungsfähig. Das führte nicht nur zu wütenden Protesten, sondern sogar zu diplomatischen Verstimmungen mit Israel.
Dennoch fällt der seit Jahren befürchtete Exodus französischer Juden nach Israel bislang viel geringer aus als befürchtet, selbst wenn die französischen Immigranten in Israel als immer bedeutsamere Gruppe wahrgenommen werden. Dass angesichts der explosiven Lage im Nahen Osten überhaupt der Gedanke aufkommen kann, Juden könnten von Frankreich nach Israel ziehen, um ihre Sicherheitslage zu verbessern, bleibt indes ein Fanal.
Jüdische Intellektuelle wie der neokonservative Philosoph Alain Finkielkraut gehören denn auch zu den heftigsten Kritikern des Begriffs der „Islamophobie“. Sie verteidigen sich gegen den Vorwurf, von einer neurotischen Angst getrieben zu sein und reklamieren eine ganz und gar realistische Furcht. Das gilt sogar für eine der lautesten Stimmen am rechtsextremen Rand, den Medienstar Eric Zémmour, der mit „Le suicide français“ (Der französische Selbstmord) eine Art Äquivalent zu Thilo Sarrazins Bestseller geschrieben hat und dabei auf seine jüdische Herkunft verweist. Manche halten es gar für möglich, dass er als eine Art Überraschungskandidat der Rechtsextremen an die Stelle von Marine Le Pen treten könnte. Auch das scheint in Zeiten der „großen Verwirrung“ denkbar.
Das Gefühl des Ordnungsschwunds – eine echte Krise der Staatlichkeit?
Insgesamt spiegeln die ideenpolitische Desorientierung und Radikalisierung vor allem eines wider – ein tiefsitzendes Gefühl des Ordnungsschwundes. Und dieses Gefühl ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Denn tatsächlich werden vielerorts alle Repräsentationssymbole des Staates als feindlich betrachtet und selbst Feuerwehr und Krankenwagen mit Flaschen und Steinen beworfen. Schon 2005 hatte man bei den Revolten in der Banlieue mit Entsetzen festgestellt, dass zu den privilegierten Zielen der Randalierer die öffentlichen Bibliotheken gehörten, die in Frankreich auch in der Provinz sehr weit verbreitet sind. Selbst eine Stadtbibliothek, so musste man folgern, kann zum Symbol für den verhassten Staat werden. Andere Beispiele ließen sich anführen, die den Eindruck erwecken, dass der französische Staat an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu scheitern droht: die furchtbaren Bedingungen im Strafvollzug, die mangelhafte Ausbildung französischer Polizistinnen und Polizisten, die teilweise chaotische Antwort auf die Coronapandemie – all diese Phänomene erwecken auch in Frankreich den Eindruck, dass der Staat kaum noch Herr der Lage sei.
Einiges daran mag in der exaltierten französischen Medienlandschaft überzeichnet und dramatisierend dargestellt werden. Erzählungen vom Niedergang, der seit 25 Jahren auftretende „déclinisme“, stellen ein eigenes Textgenre dar, das verlässlich hohe Verkaufszahlen auf einem großen Buchmarkt sichert. Doch lassen sich die Krisendiagnosen keineswegs als bloßer Schaum des Medienbetriebs abtun. Bereits vor Jahren sprach der Historiker Pierre Rosanvallon von einem „Schlecht-Regiert-Werden (mal-gouvernement), das unsere Gesellschaft bis in die Grundfesten erschüttert“[8]. Das Misstrauen gegenüber den politischen Eliten ist enorm und das Verhältnis zwischen Bürgern und Staat nachhaltig gestört.
Dieses Misstrauen hat zwei Seiten. Wie stark einerseits nicht nur Frustration und Groll, sondern auch direkter Rassismus bei den Polizeikräften verbreitet sind, konnte man vergangenen Sommer mitansehen: Ein Überwachungsvideo zeigte, wie mehrere Polizisten den schwarzen Musikproduzenten Michel Zecler ohne jeden Anlass in seiner eigenen Wohnung verprügelten. Vergessen scheinen die Zeiten, in denen Demonstranten noch mit dem Slogan „Je suis flic“ die Solidarität mit jenen ausdrückten, die in Uniform gegen den islamistischen Terror kämpfen.
Andererseits sieht die Polizeigewerkschaft das Problem vor allem bei der Justiz. Die sei zu nachsichtig mit Straftätern, war bei der Demonstration zum Gedenken an Eric Masson zu hören. Den Beamten drohe eine Art kollektiver Burn-out. Zweifellos gibt es Täter in der Polizei; zugleich sind viele in einer oft martialisch auftretenden, aber strukturell überforderten Polizei auch Opfer. So veröffentlichte die Krankenversicherung der französischen Polizisten am 7. Juni eine Statistik, wonach sich rund ein Viertel der Beamten mit Selbstmordgedanken trägt.
Das im April beschlossene „Gesetz für eine umfassende Sicherheit“ (loi sécurité globale) dient offiziell dazu, Beamte davor zu schützen, im Internet identifiziert und dann bedroht zu werden. Kritiker sehen darin den Versuch, Bilder von prügelnden Polizisten aus dem Verkehr zu ziehen. Das Gesetz zeigt, dass mangelndes Vertrauen nur schwer durch rechtliche Regelungen wiederhergestellt werden kann. Als im Januar 2020 ein Lieferant namens Cédric Chouviat während einer Festnahme starb, fühlte man sich an die USA erinnert. Chouviat hatte sieben Mal gesagt: „Ich ersticke.“
Die aufgeheizte Debatte in Frankreich macht deutlich, dass Repression einerseits nötig ist und andererseits mit Repression allein kein Vertrauensverhältnis zwischen Bürgern und der Staatsmacht etabliert werden kann. Einst war es die „police de proximité“, die auf Fahrrädern patrouillierende Nachbarschaftspolizei, die der Republik ein anderes, ziviles Gesicht gab. Der ideenpolitische Kampf gegen den antidemokratischen Fundamentalismus lässt sich mit ihr allerdings heute nicht gewinnen. Um die tiefe Krise der französischen Gesellschaft zu überwinden, werden andere, weit tiefer gehende Ansätze gefunden werden müssen.
[1] Vgl. Die Stimmungslage in Deutschland und Frankreich vor den nationalen Wahlen 2017, www.ifd-allensbach.de.
[2] Vgl. „Est-ce que Samuel Paty a été protégé? Non“, in: „Le Monde“, 11.12.2020. Im Interview erläutert die Anwältin der Familie Paty hier die genauen Hintergründe und erläutert Patys vergebliche Versuche, Rückendeckung durch die Schulbehörden oder das Kollegium zu erhalten.
[3] Vgl. „Le Monde“, 21.5.2021.
[4] Das 19. Arrondissement hat in Frankreich in dieser Beziehung einen gewissen Ruhm erlangt, weil hier die Bürgerinnen unter dem Namen collectif19 begonnen haben, die Zustände in ihrem Viertel auf Twitter zu dokumentieren.
[5] An jenem Tag attackierten islamistische Terroristen in der Hauptstadt zeitgleich ein Konzert im vollbesetzten Musik-Club Bataclan, Caféterrassen und das Stade de France während des Fußball-Länderspiels zwischen Frankreich und Deutschland.
[6] Vgl. Vincent Nouzille, Les tueurs de la République: assassinats et opérations, Paris 2015. Eine aktualisierte Ausgabe folgte 2020.
[7] Das Gesetzgebungsverfahren kann auf der Seite der Assemblée nationale genau nachverfolgt werden: www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/respects_principes_republique.
[8] Pierre Rosanvallon, Die gute Regierung, Hamburger Edition 2016, S. 9.