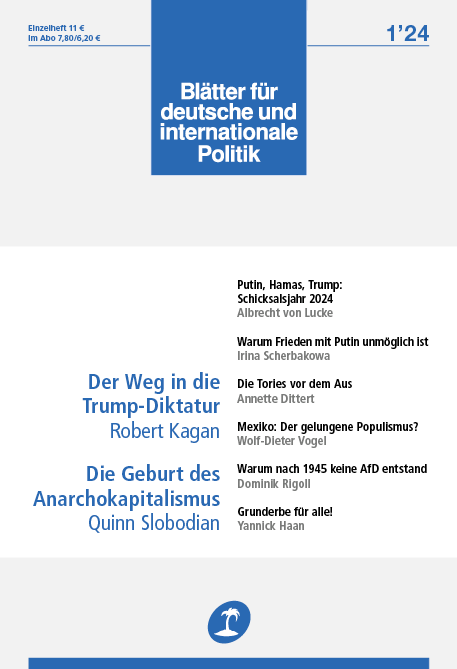Bild: Giorgia Meloni am Palazzo Chigi, 14.11.2023 (IMAGO / ABACAPRESS)
Fast hätte es scheinen können, als habe das Amt Giorgia Meloni gemäßigt. Immer wieder stößt man auf die erstaunte Frage, ob aus der oppositionellen Postfaschistin vielleicht eine regierende Rechtskonservative geworden ist.[1] Jedenfalls setzte nach dem außerhalb Italiens oft mit Sorge aufgenommenen Wahlsieg ihrer Fratelli d‘Italia im September 2022 bald ein erleichtertes Aufatmen in Europas Hauptstädten ein. Sicher, Meloni hat kaltherzig das erst kurz zuvor eingeführte Bürgergeld für Arbeitslose gestrichen. Sie beschneidet die Rechte queerer Menschen und feindet Seenotretter an. Und sie hat ein viel kritisiertes Abkommen mit Albanien geschlossen, wo künftig die Asylverfahren für in Italien angelandete Bootsflüchtlinge stattfinden sollen. Aber all das hört und sieht man im heutigen Europa auch von Politikern, die – anders als Italiens Ministerpräsidentin – keine Vergangenheit als neofaschistische Nachwuchskader haben.[2]
Meloni ist zudem sorgsam darauf bedacht, sich auf internationaler Bühne Rückhalt zu verschaffen. Früh zerstreute sie Bedenken, ihre Rechtskoalition mit der Forza Italia von Putin-Freund Silvio Berlusconi und der Lega von Putin-Anhänger Matteo Salvini könnte den europäischen Konsens sprengen und im Ukrainekrieg ins Kremllager wechseln. Unter Meloni liefert Italien weiterhin Waffen an das angegriffene Land, zu Besuch in Kiew gab sich die Regierungschefin herzlich und solidarisch. Auch nach dem Tod Berlusconis[3] – Koalitionspartner und Rivale zugleich – ist Melonis Koalition stabil geblieben. Ihre Regierung mag vielen im Westen vielleicht als etwas dubios erscheinen – der postfaschistische Senatspräsident Ignazio La Russa ist ein stolz bekennender Mussolini-Verehrer –, gilt aber insgesamt als transatlantisch orientiert und im Großen und Ganzen berechenbar. So hat sich eine beruhigende Gewissheit verbreitet: Italien wird kein zweites Ungarn werden.
Doch diese Gefahr ist keineswegs gebannt. Giorgia Meloni, das wird zusehends klar, hat wohl einfach den für sie günstigen Zeitpunkt abgewartet, um eines ihrer zentralen Vorhaben in Angriff zu nehmen. Nicht weniger als „die Mutter aller Reformen“[4] will die Ministerpräsidentin jetzt durchsetzen: den premierato, eine Verfassungsänderung, die das politische System Italiens erheblich verändern würde. Ihr Ziel ist es, das Amt der Regierungschefin massiv zu stärken, zulasten des Staatspräsidenten, vor allem aber zulasten des Parlaments – und damit letztlich auf Kosten der Gewaltenteilung. Meloni argumentiert mit Effizienz und Stabilität, zielt aber erkennbar darauf, eine starke Figur an der Spitze der italienischen Politik zu installieren. Genau dies hatten die Gründerinnen und Gründer der Zweiten Republik nach den Erfahrungen des Faschismus vermeiden wollen. Das Kabinett hat Melonis Plänen bereits zugestimmt, noch vor den Europawahlen im Juni 2024 soll das Parlament entscheiden. Dort stößt das Vorhaben jedoch auf Widerspruch. Oppositionsführerin Elly Schlein vom Partito Democratico warnt zu Recht, diese Reform sei „gefährlich“ und werde „den Parlamentarismus aushöhlen“.[5]
Ein Bild der Instabilität
Meloni verweist in ihrer Begründung für die geplante Reform auf zwei Eigentümlichkeiten der italienischen Nachkriegsdemokratie: die häufigen Regierungswechsel und in jüngster Zeit die Einsetzung von nicht gewählten Technokraten-Kabinetten. In Rom folgten in den vergangenen 77 Jahren stolze 68 Regierungen aufeinander. Zwar relativiert sich diese Zahl, wenn man weiß, dass die Christdemokraten von der Republikgründung 1948 bis 1981 ununterbrochen den Ministerpräsidenten stellten und bis Anfang der 1990er Jahre an allen Regierungen beteiligt waren. Politisch und personell herrschte also lange Zeit Kontinuität. Aber die vielen Neuwahlen vermitteln, gerade auch im Ausland, ein Bild der Instabilität.
Dieser Eindruck eines dysfunktionalen politischen Systems wurde in den vergangenen Jahren noch dadurch verstärkt, dass während großer Wirtschaftskrisen die Regierungen zerbrachen und Experten die Macht übernahmen. So geriet Berlusconi 2011 während der Eurokrise, als eine Staatspleite Italiens im Raum stand, derart stark unter den Druck der Finanzmärkte und seiner Amtskollegen in Berlin und Paris, damals Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, dass er schließlich zurücktrat. Daraufhin setzte der Präsident den parteilosen ehemaligen EU-Kommissar Mario Monti ein, der die Legislaturperiode dann vollendete. Man musste Berlusconi nicht mögen, um darin einen „Putsch der Märkte“ zu sehen.[6]
Während der Coronakrise, als Italiens Wirtschaft stark einbrach, wiederholte sich der Vorgang: Ministerpräsident Giuseppe Conte von der Fünf-Sterne-Bewegung wurde 2021 durch einen ehemaligen Koalitionspartner aus dem Amt gedrängt, gerade als es darum ging, die Milliardenhilfen aus dem Corona-Fonds der EU zu verwenden. Wieder setzte der Präsident einen Experten ein: den parteilosen Ex-Zentralbanker Mario Draghi, der zwar populär war, aber weitreichende Entscheidungen treffen durfte, ohne sich jemals einer Wahl gestellt zu haben. Geht es nach Meloni, soll damit bald Schluss sein. Machtspiele und Technokraten-Regierungen, erklärte sie, werde es dank ihrer Reform künftig nicht mehr geben.
Die Postfaschistin greift damit eine berechtigte Kritik an Fehlentwicklungen der italienischen Demokratie auf, wendet sie aber in ihrem Sinne – gegen die Demokratie. Ihr geht es primär um den Abbau jener Checks and Balances, die eine Lehre aus der faschistischen Epoche waren: Parlament und Präsident sollen die Macht des Ministerpräsidenten – oder wie derzeit erstmalig: der Ministerpräsidentin – begrenzen. Genau das will Meloni nun ändern.
Ihre Reform sieht vor, künftig die Ministerpräsidentin direkt vom Volk wählen zu lassen – das wäre einmalig in Europa. Bisher wird sie vom Parlament vorgeschlagen und vom Präsidenten ernannt. Das Staatsoberhaupt, dessen Rolle ansonsten weitgehend repräsentativ ist, hat damit ein Vetorecht, von dem die Amtsinhaber zuletzt mehrfach Gebrauch machten, um einzelne Rechtsaußen-Minister zu verhindern. Diese Kontrollfunktion soll der Präsident nun weitgehend verlieren, zugleich würde die des Parlaments massiv eingeschränkt: Sollte die Ministerpräsidentin zurücktreten, dürfte ihr künftig nur eine Person aus der Regierungsmehrheit – nicht aber aus der Opposition – nachfolgen. Erst wenn es dieser Person nicht gelänge, die Mehrheit der Abgeordneten hinter sich zu versammeln, käme es zu Neuwahlen. Ohnehin soll es im Parlament nach dem Willen der Rechtskoalition keine Mehrheit gegen die Regierung mehr geben dürfen: Nach der geplanten Reform erhielte die stärkste Partei automatisch 55 Prozent der Sitze. Damit könnte eine Kandidatin wie Meloni, deren Partei bei der jüngsten Wahl mit gerade einmal 26 Prozent zur Wahlsiegerin wurde, eine bloß relative Mehrheit der Stimmen nutzen, um mit absoluter Mehrheit im Parlament durchzuregieren. Kritiker fürchten schon „die Diktatur einer Minderheit“.[7]
Bonapartismus auf Italienisch
Meloni präsentiert das natürlich ganz anders und umwirbt das Wahlvolk: „Wollen Sie selbst entscheiden oder es den Parteien überlassen?“ Diese Frage, so der Politikwissenschaftler und ehemalige linke Abgeordnete Carlo Galli, „ist programmatisch: Sie enthält Antiparlamentarismus, Populismus und Autoritarismus.“ Die italienische Rechte verachte Vermittlung und Dialog und setze stattdessen auf „den unmittelbaren Ausdruck des Willens des souveränen Volkes“, der sich in „das einsame Wort“ der Regierungschefin übersetze.[8] Eine charismatische Anführerin soll sich, mit neuer Macht und Legitimation ausgestattet, über den Parteienstreit erheben.
Diese Strategie könnte man mit Marx fast schon als „bonapartistisch“ bezeichnen: Gegen die politischen Blockaden einer auch in Italien fragmentierten Parteienlandschaft setzt Meloni mit der Direktwahl der Regierungschefin auf ein im Grunde plebiszitäres Element – und das in gleich doppelter Hinsicht: Ihre Reform spielt den vermeintlich eindeutigen und unmittelbaren Volkswillen gegen Vermittlung und Beratung im Parlament aus. Außerdem muss die Reform vermutlich noch in einem Referendum bestätigt werden, das für den Herbst 2025 erwartet wird; denn die nötige Zweidrittelmehrheit im Parlament gilt derzeit als ausgeschlossen. Das Volk wird also angerufen, die verhasste casta, die politische Elite, zu entmachten, soll dabei aber unter der Hand faktisch der eigenen Entmachtung zustimmen.
Der ehemalige Richter Michele Marchesiello warnt, Meloni wolle den Aufbau „eines autoritären Regimes, das sich auf die implizite Zustimmung des Volkes stützt“, als Ausdruck des „Volkswillens“ verschleiern: „Ein Mechanismus, der aus der Geschichte des letzten Jahrhunderts nur allzu gut bekannt ist. Die schlimmsten Totalitarismen haben sich dank dieses Kunstgriffs rechtmäßig etabliert.“[9]
Offenkundig handelt es sich bei dieser Reform auch um eine „Lex Meloni“. Die Postfaschistin, die wegen ihrer Sozialpolitik zunehmend Gegenwind von den Gewerkschaften bekommt, will sich an der Macht festsetzen. Dann könnten der „Mutter aller Reformen“ bald weitere Schritte folgen, die das Gesicht der italienischen Demokratie grundlegend verändern werden.
Wohin die Reise gehen könnte, zeigen die jüngsten Äußerungen von Verteidigungsminister Guido Crosetto. Der Mitgründer der Fratelli d’Italia raunte in einem Interview, die „einzige große Gefahr“ für seine Regierung sei jene „antagonistische Strömung“, die stets „Mitte-rechts-Regierungen versenkt“ habe: „die juristische Opposition“. Vor der Europawahl rechne er mit einem Angriff aus dieser Richtung.[10]
Das folgt mustergültig jenem autoritären Drehbuch, wie es etwa die PiS in Polen etabliert hat: Erst wird die Justiz als parteiisch delegitimiert, dann folgt ihre Entmachtung im Namen des angeblichen Volkswillens – und damit eine entscheidende Schwächung der Gewaltenteilung. Vizepremier Antonio Tajani von der Forza Italia sprang Crosetto bei: „Die Reform der Justiz“ müsse neben der Verfassungsreform und Autonomierechten für die Regionen „die dritte Säule der institutionellen Erneuerung sein“.[11] Aus seinem Mund klingt das wie eine Drohung. Hier deutet sich schon an, was Melonis Regierung versuchen könnte, wenn sie mit ihrer Verfassungsreform Erfolg haben sollte.
Die heikle Gratwanderung der Opposition
Die Opposition steht angesichts dessen vor einer heiklen Gratwanderung. Sie lehnt Melonis Reform zwar mehrheitlich als demokratiegefährdend ab, hat in der Vergangenheit aber auch selbst immer wieder die Unzulänglichkeiten des politischen Systems kritisiert.
Die Fünf-Sterne-Bewegung entstand sogar gerade aus der Kritik an echten oder vermeintlichen Fehlentwicklungen der italienischen Demokratie. Auch deswegen wäre es wenig überzeugend, wenn die Opposition nun kritiklos den Status quo verteidigen würde. Die linken und liberalen Parteien stehen damit vor einem klassischen Dilemma: Erscheinen sie bloß als Beharrungskräfte, kann Meloni sich als mutige Reformerin inszenieren. Aber mit zu lauter Kritik am politischen System liefern sie der Regierungschefin schlimmstenfalls noch Argumente.
Helfen könnte der Opposition die Beliebtheit des Staatspräsidenten. Amtsinhaber Sergio Mattarella haftet ebenso wie seinem Vorgänger, dem vor einigen Monaten verstorbenen Giorgio Napolitano, die Aura des überparteilichen, besonnenen Landesvaters an. Seine bisherige Rolle dürften viele Italienerinnen und Italiener deutlich lieber gegen Meloni verteidigen wollen als die Rechte der oft unbeliebten Parteien.
So wenig der Ausgang des Referendums heute bereits absehbar ist, lässt sich eines doch mit Sicherheit sagen: Meloni darf keinesfalls unterschätzt werden. Sie hat in den vergangenen Monaten und Jahren wiederholt enormes taktisches Gespür bewiesen: erst in der Coronakrise, als sie mit ihren Fratelli d’Italia nicht in die Allparteien-Regierung unter Draghi eintrat und sich so als einzige Oppositionskraft inszenieren konnte, dann erneut nach ihrem Regierungsantritt, als sie sich bemerkenswert schnell einen respektablen Anstrich verschaffte.
Damit steht Giorgia Meloni allerdings gerade nicht für eine zur demokratischen Rechten geläuterte ehemalige Neofaschistin. Vielmehr könnte sie einen neuen gefährlichen Prototyp einer ultrarechten Politikerin etablieren: seriös im Auftreten, diplomatisch versierter als ihre oft polternden Vorgänger, aber im Kern nicht weniger nationalistisch und autoritär. Marine Le Pen versucht sich in Frankreich schon länger an einer ähnlichen Strategie, noch aber aus der Opposition.
Gelingt es Meloni also, eine Mehrheit der Italienerinnen und Italiener hinter ihrer „Mutter aller Reformen“ zu versammeln, wird ihre Strahlkraft in Europa weiter zunehmen – als leuchtendes Vorbild aller Demokratieverächter.
[1] Vgl. exemplarisch: Giorgia Meloni. The chameleon, politico.eu.
[2] Steffen Vogel, Italien: Der vermeidbare Triumph der Giorgia Meloni, in: „Blätter“, 11/2022, S. 17-20.
[3] Ida Dominijanni, Maskierte Ohnmacht: Berlusconi als Ikone des Populismus, in: „Blätter“, 8/2023, S. 55-61.
[4] Vgl. Premiership „mother of all reforms“ says Meloni, ansa.it, 3.11.2023.
[5] Vgl. Premiership dangerous, dismantles parliamentarism – Schlein, ansa.it, 3.11.2023.
[6] Albrecht von Lucke, Souverän ohne Volk: Der Putsch der Märkte, in: „Blätter“, 12/2011, S. 5-8.
[7] Michele Prospero, Il premierato è un killer: così abbatterà la nostra democrazia, unita.it, 8.11.2023.
[8] Carlo Galli, Premierato, la libertà negata del Parlamento, repubblica.it, 20.11.2023.
[9] Michele Marchesiello, Presidenzialismo Meloniano e „volontà popolare”: populismo o democrazia?, micromega.net, 21.11.2023.
[10]Paola Di Caro, Crosetto: „Gruppi di magistrati contro il governo”, corriere.it, 26.11.2023.
[11] Zit. nach: Paola Di Caro, Scontro sulle accuse di Crosetto. L’Anm: Fake news. Lui: fonti credibili, corriere.it, 26.11.2023.