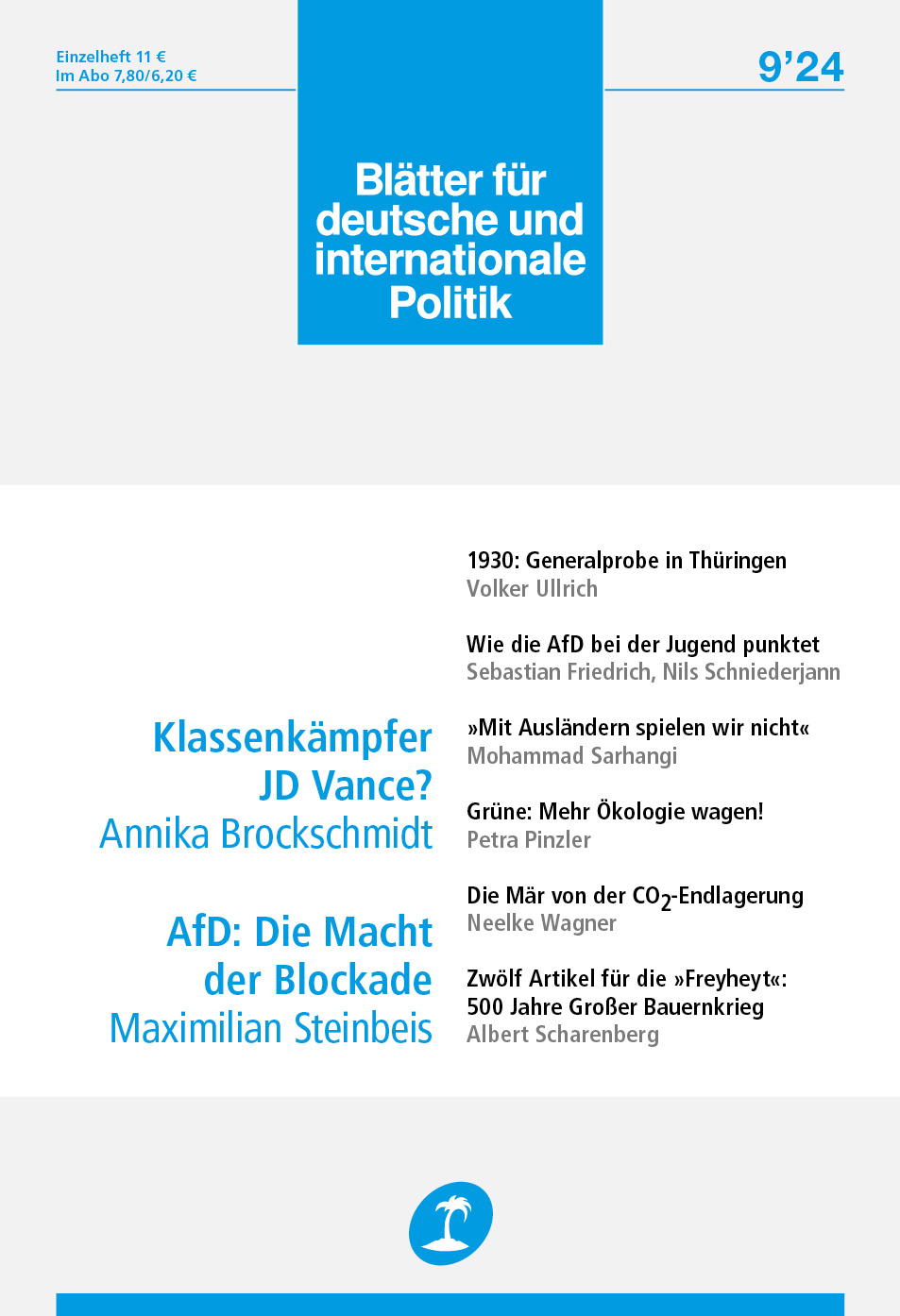Die drohende Blockademacht der AfD in Thüringen

Bild: Landtagswahlkampf in Erfurt: Eine Fliegenklatsche mit dem Logo der AfD-Kampagne »Der Osten machts!«, 20.8.2024 (IMAGO / Jacob Schröter)
Wir alle haben eine Vorstellung davon, wie autoritäre Herrschaft aussieht: überall Spitzel, überall Polizei, überall Angst. Die Regierung steht auf wackeligem Grund und muss sich deshalb ständig mit Gewalt stabilisieren. Sie kann keine überzeugenden Gründe für ihre Herrschaft nennen, höchstens irgendwelchen lügenhaften Kitsch, der allenfalls zur Überwältigung taugt, aber nicht zur Überzeugung, und deshalb stets mit der Drohung mit Gewalt hinterlegt bleiben muss, um seine Wirkung zu tun. Auf die Frage, mit welchem Recht sie von mir verlangt, mich ihren Entscheidungen zu fügen, hat sie am Ende nichts zu sagen als: weil sie es kann.
Es ist noch gar nicht lange her, da erschien solche autoritäre Herrschaft eine nach und nach aussterbende Spezies. Die „dritte Welle“ der Demokratisierung hatte ab 1975 die faschistischen Regime in West- und Südeuropa, die Militärdiktaturen in Lateinamerika, die Apartheid in Südafrika und die meisten kommunistischen Diktaturen in Asien und Osteuropa fortgespült. Mit dem „Arabischen Frühling“ 2011 schien auch das Ende der autokratischen Regime im Nahen Osten und in Nordafrika nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Doch es kam bekanntlich anders: Es baute sich eine Gegenwelle auf, der Autoritarismus gewann Terrain zurück. Aber nicht mit den alten Methoden, nicht durch Militärputsch, Staatsstreich und gefälschte Wahlen. Er bemächtigte sich der Institutionen der Demokratie von innen heraus, machte sie sich zu eigen, durchdrang und besetzte sie, und zwar nicht nur in Regionen, die man sich angewöhnt hatte als „instabil“ und in puncto demokratischer Kultur sozusagen zurückgeblieben zu betrachten, sondern auch und gerade in den Mutterländern der Demokratie schlechthin.
Das Mittel dazu war und ist der Populismus: der strategische Einsatz einer bestimmten, mehr oder weniger beim Wort zu nehmenden „Politikvorstellung“, so die klassisch gewordene Definition von Jan-Werner Müller, „laut derer einem moralisch reinen, homogenen Volk stets unmoralische, korrupte und parasitäre Eliten gegenüberstehen – wobei diese Art von Eliten eigentlich gar nicht wirklich zum Volk gehört“. In einer liberalen rechtsstaatlichen Demokratie ist es zwar das „Volk“, das die Machtfrage zu beantworten hat: Von ihm geht nach Artikel 20 Abs. 2 Grundgesetz „alle Staatsgewalt aus“. Aber wie das geschieht und was unter diesem „Volk“ zu verstehen ist, ist notwendig eine Rechtsfrage. Für den autoritären Populismus ist es hingegen nicht das in demokratischen Verfahren in Kraft gesetzte und durch unabhängige Gerichte gesprochene Recht, das die Frage, wer das Volk ist und in welchen Verfahren es seinen Willen bildet und äußert, beantwortet und gleichzeitig offenhält, sondern die Antwort ist bereits gegeben. Die Volksidentität ist allem Recht und allen demokratischen und justiziellen Verfahren vorgängig. Sie ist einfach da.
Was dieses „Volk“ will, ist ebenfalls bereits da. Rechtlich normierte Verfahren wie Wahlen und Abstimmungen sind nicht erforderlich, diesen kollektiven Willen hervorzubringen, sondern nur dazu da, ihn zu affirmieren. Das mit sich selbst identische „Volk“ weiß auch ohne sie, was es will. Man muss es nur fragen. Plebiszite und Volksbefragungen sind die Mittel der autoritär-populistischen Wahl dazu, zumal dann, wenn der autoritär-populistische Machthaber selbst die Frage formuliert und so bereits weitgehend steuern kann, wie die Antwort ausfällt. Wenn die rechtsstaatlichen und demokratischen Verfahren diesen als vorgegeben gesetzten Volkswillen bestätigen, dann umso besser. Wenn nicht, dann stimmt mit ihnen etwas nicht.
Die Verfassung nutzen, um sie auszuhöhlen
Die Verfassung kann dieses behauptete „Volk“ und seinen behaupteten „Willen“ affirmieren – dann affirmiert auch der autoritäre Populismus die Verfassung. Sie ist insoweit für ihn nützlich, als sie ihm eine Deckung bietet, hinter der er den Mangel an Begründung für seine Setzungen verstecken kann. Solange ihn die Verfassung deckt, lässt sich sein Autoritarismus viel schwerer nachweisen. Er braucht sich nicht mehr zu exponieren, braucht keinen Militärputsch und keine Gewalt mehr, weil und soweit die Verfassung ihm liefert, was er selbst nur behaupten, aber nicht begründen kann: die Rechtfertigung für seinen Herrschaftsanspruch. Sie liefert ihm obendrein Grund- und Minderheitsrechte, die er strategisch einsetzen kann, solange er selbst noch nicht herrscht – zum Protest, zur Obstruktion, zur Delegitimierung derer, die an seiner Stelle herrschen. Sie liefert ihm Möglichkeiten, Debatten zum Entgleisen zu bringen und Entscheidungen zu blockieren. Er kann die demokratischen Prozesse zum Stillstand bringen und damit seine Erzählung unterfüttern, dass die „Eliten“, die an seiner Stelle herrschen, illegitime und korrupte Versager sind und das System, das ihn nicht herrschen lässt, kaputt und reparaturbedürftig ist.
Und damit sind wir bei den Landtagswahlen in Thüringen. Sollte dort die AfD mehr als ein Drittel der Sitze erringen, hätte sie ganz neue Möglichkeiten zur Obstruktion und Delegitimierung – das gilt, etwas anders gelagert, auch in Sachsen und Brandenburg. Ohne Zweifel wird sie versuchen, diese Möglichkeiten zu nutzen. Eine Regierungsbeteiligung der autoritären Populisten ist nach den Landtagswahlen am 1. September nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Also wird die autoritär-populistische Strategie einstweilen ihre destruktive Wirkung weiter aus der Opposition heraus entfalten: Mit wachsenden Stimmenanteilen bekommt sie immer mehr Beteiligungs- und Verfahrensrechte an die Hand und damit immer mächtigere Möglichkeiten, ihrer Erzählung von der Korruptheit des „Systems“ und der „Eliten“, die es beherrschen, Plausibilität zu verleihen und so ihren eigenen Herrschaftsanspruch zu untermauern. Wo sie Einfluss auf Gesetzgebung und Gesetzesvollzug erlangt, multiplizieren sich diese Möglichkeiten: Jetzt hat sie die Verfassung im Rücken beim Sprechen für das „Volk“. Je größer der Wahlerfolg der autoritären Populisten, desto stärker wächst auch bei ihrer demokratischen Konkurrenz die Versuchung, sich ihnen mehr und mehr anzuverwandeln. So wird die autoritär-populistische Ermächtigung zur self-fulfilling prophecy.
Dieser Strategie kann man nicht entkommen. Aber man kann ihr entgegentreten. Man kann sie erkennen und benennen und sich auf ihre nächsten Schritte vorbereiten. Man muss nicht in jede ihrer Fallen hineintappen und nicht jedes ihrer Spiele mitspielen. Man kann ihre Schritte und Taktiken antizipieren. Man kann in Szenarien durchspielen, wie genau eine solche Strategie im deutschen Verfassungskontext umgesetzt werden könnte. Bereits das hat einen Resilienzeffekt: Wer die Strategie der autoritären Populisten erkennt, wird weniger leicht auf ihre Taktiken hereinfallen und weniger wahrscheinlich die graduelle, für sich genommen erst einmal oft wenig aufsehenerregende Übernahme der Institutionen als bloße Technizität missverstehen, um die sich die Juristerei kümmern soll, die aber mit dem eigenen Leben nicht viel zu tun hat. Wer den Möglichkeitsraum, als den die autoritären Populisten die demokratische Verfassung betrachten, überblickt, wird sich rechtzeitig zu Protest und Widerstand wappnen können, bevor aus Möglichkeiten Wirklichkeiten geworden sind und es für Gegenwehr zu spät ist.
Die autoritär-populistische Strategie fängt nicht erst im Moment der Regierungsbeteiligung oder gar Regierungsübernahme an zu wirken. Sie kann bereits sehr viel früher Schaden anrichten, insbesondere wenn die AfD ein Drittel oder mehr der Landtagsmandate erringt. Die Frage, was dann unter diesen verschiedenen Rahmenbedingungen alles passieren könnte, ist nicht nur Spekulation. Sie zu stellen und zu beantworten ist die Voraussetzung dafür, überhaupt erkennen zu können, was gespielt wird. Das gilt nicht nur für die Entscheidungs- und Funktionsträger:innen vor Ort in Thüringen, nicht nur für die Rechtswissenschaft, nicht nur für die Politik, sondern für die deutsche Gesellschaft insgesamt.
„Selbst gut designte Verfassungen und Gesetze beinhalten unausweichlich Mehrdeutigkeiten und mögliche Schlupflöcher“, schreiben die Politikwissenschaftler Steven Levitsky und Daniel Ziblatt.[1] „Politiker können diese Mehrdeutigkeiten ausnützen, um gerade das Ziel, für das das Gesetz geschrieben worden ist, zu verzerren und zu unterlaufen.“ Man kann diese Praxis auch schlicht als Verfassungsmissbrauch bezeichnen: Es geht nicht darum, dass jemand etwas tut, wozu er kein Recht hat. Es geht darum, dass jemand Rechte, die er hat, missbraucht. Wie könnte nun in Thüringen ein solcher Verfassungsmissbrauch nach der Wahl aussehen, mit welcher Obstruktionspolitik müssen wir rechnen?
Die unscheinbare Macht der Landtagspräsident:in
Angenommen, am Abend des 1. September 2024 um kurz nach 18 Uhr steht fest, dass bei den Landtagswahlen im Freistaat Thüringen eine autoritär-populistische Partei die meisten Stimmen und über ein Drittel der Sitze im Landtag geholt hat – was nach den letzten Umfragen durchaus wahrscheinlich ist. Sie gewinnt damit erhebliche Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und sei es nur, indem sie Entscheidungen blockiert.
Schon die Wahl der Landtagspräsident:in könnte eine wichtige Weiche stellen. Das ist ein Amt, von dem man im Normalfall selten Notiz nimmt, das aber erhebliche Obstruktionsmöglichkeiten bietet. Für den Landtag ist dieses Amt existenziell: Er ist erst arbeitsfähig, kann erst Beschlüsse fassen und die neue Ministerpräsident:in wählen, wenn dieses Amt besetzt ist. Erst dann kann in Thüringen regiert und Politik gemacht werden. Für die Wahl gibt es eine Konvention: Den Parlamentspräsidenten nominiert nach, wie es so schön heißt, „altem Parlamentsbrauch“ stets die stärkste Fraktion. Das ist in unserem Szenario die der AfD. Sie darf nach der geltenden Geschäftsordnung den ersten Vorschlag machen, was aber noch nicht heißt, dass ihr Vorschlag von den anderen Fraktionen auch gewählt werden muss. Sie müssen nicht nehmen, wer ihnen von der AfD vorgesetzt wird. Der Vorgeschlagene braucht eine Mehrheit und wenn er die nicht bekommt, ist er nicht gewählt. Was passiert dann? Das liegt zunächst in der Hand der Person, die diese erste Sitzung leitet, also bei der Alterspräsident:in. Schon 2019 war das ein AfD-Abgeordneter. Und 2024 könnte die AfD diese Person wieder stellen. Sie kann bestimmen, dass die AfD dann eben jemand anderen nominieren soll, und theoretisch kann sie damit so lange weitermachen, bis jeder einzelne AfD-Abgeordnete durchgefallen ist.
Um hier eine Mehrheit gegen die AfD zu erreichen, müssten sich vermutlich Union, BSW und Linke (die anderen Parteien dürften für die Mehrheitsfindung keine Rolle mehr spielen) einigen, wer dieses Amt bekleiden soll. Ein solcher Kompromiss will organisiert sein. Angenommen, die anderen Parteien halten dieses Spiel aber nicht durch oder sehen vielleicht auch gar keinen Anlass zu einem Kompromiss. Landtagspräsident:in ist ja eh ein eher repräsentatives Amt, könnten sie denken, und deswegen die Konstituierung des neu gewählten Parlaments hinauszuzögern, ließe doch die Demokratie auch nur wieder blöd aussehen. Ist die Wahl einer AfD-Kandidat:in nicht das kleinere Übel? Was soll schon passieren?
Einiges kann passieren: Die Präsident:in des Landtags ist eine der Institutionen, die Politik möglich halten, gerade dadurch, dass sie selbst nicht politisch sind. Das macht sie für den autoritären Populismus zu einem außerordentlich attraktiven Ziel. In manchen Dingen ist die Machtfülle der Präsident:in erheblich. Sie kann beispielsweise den Landtagsdirektor ohne Angabe von Gründen in den einstweiligen Ruhestand schicken und durch eine andere Person ihrer Wahl ersetzen. Der Landtagsdirektor leitet die Verwaltung des Landtags: Er kümmert sich um all die für sich genommen völlig unauffälligen Schräubchen und Rädchen, von deren Wohlgeöltheit abhängt, ob die Abgeordneten des Landtags ihre Arbeit tun können und der parlamentarische Betrieb läuft und seine Aufgaben erfüllt. Wie jede Verwaltung ist auch die des Landtags sehr hierarchisch strukturiert. Ein Landtagsdirektor muss gar nicht unbedingt Weisungen erteilen, um seinen Willen zu verdeutlichen. Und sich dem Willen der Hausleitung in den Weg zu stellen – sei es mit noch so guten juristischen Gründen – ist im öffentlichen Dienst selten der Karriere förderlich. Die Personalhoheit liegt ganz und gar in den Händen der Landtagspräsident:in. Wer in der Landtagsverwaltung etwas wird und wer nicht, das entscheidet sie allein.
Die Präsident:in vertritt das Parlament auch nach außen. Wie das Parlament in Erfurt sich öffentlich präsentiert und in Erscheinung tritt – das bestimmt die Präsident:in. Plötzlich gibt es im Foyer und in den Fluren des Landtags nur noch völkische Heimatkunst zu sehen, rauschende Wälder, blonde Bauernkinder und dergleichen. Plötzlich öffnen sich die Tore des Erfurter Parlaments für Konferenzen und Symposien, zu denen die halbe europäische Neue Rechte anreist, um der Erzählung von der großen Verschwörung der wurzellosen kosmopolitischen Eliten gegen die weiße Bevölkerung machtvoll Resonanz zu verschaffen. Plötzlich geben sich Gäste aus aller Welt im Landtag die Klinke in die Hand, ein rechtsextremes Regime nach dem anderen schickt seine Delegationen. Und umgekehrt geht auch die Landtagspräsident:in auf Reisen: Sie fährt nach Budapest, nach Moskau und nach Mar-a-Lago und wird überall mit großen Ehren empfangen. Wenn sich dann das Auswärtige Amt in Berlin über diese Thüringer Nebendiplomatie und der Ministerpräsident über den Übergriff in seine Außenvertretungskompetenz beschweren, umso besser: Wieder einmal wollen die „verkommenen links-grünen Eliten“ das widerständige Thüringer „Volk“ klein und isoliert halten – damit lässt sich die autoritär-populistische Erzählung prächtig füttern. Das Beste daran für Populisten: Das Ganze ist mit keinerlei politischem Preis verbunden, ist reine Symbolpolitik. Als Parlamentspräsident:in, obendrein eines Bundeslandes, hat sie ja gar keine außenpolitischen Kompetenzen, für deren Umsetzung sie geradezustehen hätte. Während die Regierung regieren muss – und möglicherweise als Minderheitsregierung notgedrungen sowieso mehr schlecht als recht –, braucht sie bloß zu repräsentieren und nach innen und außen das „wahre Volk“ zu verkörpern, an allen demokratischen Institutionen und Verfahren vorbei.
Die Präsident:in des Thüringer Landtags hat noch weitere Funktionen, die zum Missbrauch einladen. Beispielsweise könnte sie mit vorgeschobenen verfassungsrechtlichen Argumenten das Inkrafttreten umstrittener Gesetze mindestens so lange blockieren, bis der Verfassungsgerichtshof in Weimar über ihre Kompetenzen Klarheit schafft. Apropos Verfassungsgericht, auch hier hätte die AfD mit einem Drittel der Abgeordneten einen erheblichen Einfluss, dazu später mehr.
Zurück zur Parlamentspräsident:in. Eine Person, die dieses Amt versieht, ohne es zu instrumentalisieren und zu politisieren, ist für das Funktionieren der parlamentarischen Demokratie unverzichtbar. Wenn diese Institution nicht mehr funktioniert, dann kann die Parlamentsmehrheit das nicht mehr so leicht stoppen, solange die autoritären Populisten im Landtag über eine Sperrminorität verfügen: Zur Abwahl ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Hat die Mehrheit einmal die autoritären Populisten in dieses Amt hineingelassen, wird sie sie bis zum Ende der Legislaturperiode nicht mehr los.
Der dritte Wahlgang
Bekannt ist das Spektakel, das die AfD 2020 im Thüringer Landtag inszeniert hatte. An diesem Tag sollte nach der Wahl 2019 der Ministerpräsident gewählt werden. Da das Wahlergebnis keine klare Mehrheit zuließ, traten im dritten Wahlgang Ramelow, ein parteiloser Kandidat der AfD namens Christoph Kindervater sowie Thomas Kemmerich von der FDP gegeneinander an. Die Auszählung ergab, dass Kemmerich 45 Stimmen erhalten hatte, Ramelow nur 44 und der AfD-Kandidat nicht eine einzige. Die AfD hatte, statt für ihren eigenen Kandidaten, geschlossen für Kemmerich gestimmt. Die AfD konnte ihr Glück gar nicht fassen. Sie hatte Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt, und er nahm die Wahl an. Damit stellte er die Gemeinsamkeit zwischen AfD, CDU und FDP her, die die AfD bis dahin bloß behauptet hatte. Auf dieses Podium hatte die AfD Kemmerich gelockt, und er war der Lockung gefolgt. „Das war der Sinn der ganzen Strategie“, freute sich der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Stefan Möller.
Ausgedacht und planmäßig eingefädelt hatte das ganze Spektakel ein junger Mann namens Torben Braga, der in Marburg und Jena Politikwissenschaft und Öffentliches Recht studiert hat und seit Februar 2020 Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Erfurter Landtag ist. Überall ist in Erfurt zu hören, dass dieser Herr Braga, was immer man sonst noch über ihn sagen kann, über beträchtliche juristische Kompetenz verfügt. Sein Geschick, in der Verfassung und der Geschäftsordnung des Landtags und überhaupt im Recht Möglichkeiten ausfindig zu machen, wie man die Demokratie und ihre Institutionen blamieren und so der großen Erzählung der AfD vom Versagen des Systems und der etablierten Parteien nach Kräften Evidenz zuführen kann, ist seit 2020 bestimmt nicht kleiner geworden.
Ein solches Szenario könnte sich theoretisch auch dieses Mal wiederholen. Wahrscheinlicher ist aber etwas anderes: Wenn im dritten Wahlgang nur ein Kandidat ohne Gegenkandidaten antritt, dann ist in der Verfassung nicht ganz klar formuliert, unter welchen Bedingungen dieser Kandidat dann zum Ministerpräsidenten gewählt ist. Diese Situation könnte die AfD gezielt herbeiführen und ausnutzen. Wenn sie stärkste Fraktion wird, müssen sich die anderen Fraktionen auf eine gemeinsame Kandidat:in einigen, um einen Ministerpräsidenten Björn Höcke zu verhindern. In diesem Fall könnte Höcke aber seine Kandidatur zurückziehen – dann wäre die gemeinsame Kandidat:in der anderen Fraktionen gewählt. Aber wegen der Unklarheit in der Verfassung könnte die AfD dagegen klagen und so dafür sorgen, dass die neue Regierung unter dem Schatten ihrer eigenen möglichen Verfassungswidrigkeit ihr Amt antreten müsste – ein gefundenes Fressen für die autoritäre Strategie.
Ein anderes Szenario ist eine Minderheitsregierung, die von der AfD mitgewählt wird, der sie aber nicht angehört. Die AfD könnte so regieren, ohne zu regieren. Sie könnte gegenüber der von ihr abhängigen Minderheitsregierung auf De- und Obstruktion spielen, soweit es ihr nützt, und ihre Forderungen durchsetzen, soweit es ihr ebenfalls nützt. Fünf Jahre lang könnte Höcke dieses Spiel spielen, könnte sich gleichzeitig als eigentlicher Machthaber, der alle Fäden in der Hand hält, und als Alternative zu der schwachen und abhängigen demokratisch gewählten Regierung inszenieren, die nächsten Landtagswahlen 2029 fest im Blick.
Obstruktion: Der hässliche Zwilling der Opposition
Opposition kann, ja: muss lästig sein. Von der Opposition zu erwarten, stets brav und fleißig am reibungslosen Funktionieren des Parlaments- und Regierungsgeschäfts mitzuwirken, hieße, sie ihrer Funktion zu berauben. Wo die Mehrheit Einigkeit herstellt, stellt die Opposition Vielfalt her. Wo die Mehrheit Verfahren abschließt, öffnet sie sie. Es kann für sie kein Kriterium sein, ob die Mehrheit ihre Mitwirkung als „konstruktiv“ empfindet oder nicht.
Der hässliche Zwilling von Opposition ist Obstruktion. Er kommt immer dann zum Vorschein, wenn manche – begründet oder nicht – der Meinung sind, dass mit dem Verhältnis zwischen Mehr- und Minderheit etwas nicht stimmt. Ende des 19. Jahrhunderts war parlamentarische Obstruktion eher die Regel als die Ausnahme. Zu obstruktiven Methoden zu greifen ist auch heute vielerorts die einzige Möglichkeit, die der Opposition bleibt, um überhaupt noch sichtbar zu bleiben. In Ungarn zum Beispiel. 2016 urteilte die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg, dass die Meinungsfreiheit mehrerer Oppositionsabgeordneter verletzt worden war, als der Parlamentspräsident sie für Protestaktionen im Plenarsaal mit Strafgeldern disziplinierte.
In der Bundesrepublik sah es lange Zeit so aus, als habe sich das Thema Obstruktion von selbst erledigt. „Bei relativ ausgewogener Sozialstruktur und verfassungstreuen Parteien“, stellte 1979 der Staatsrechtler Hans-Peter Schneider fest, habe es doch mittlerweile „erheblich an Aktualität verloren“. Rechtswissenschaftlich geriet das Problem weitgehend in Vergessenheit, und auch in der politischen Praxis gab es, von einigen harmlosen Protestspektakeln der Grünen und der Linken abgesehen, kaum noch Anlässe, sich mit ihm zu beschäftigen. Das hat sich gründlich geändert. Das liegt an der AfD. Extensiven Gebrauch macht sie im Bundestag wie in den Landtagen von einem besonders einfach zu handhabenden Kontrollinstrument des Parlaments, nämlich der sogenannten Kleinen Anfrage. In Thüringen hat die AfD in dieser Legislaturperiode bereits mehr als 2800 Kleine Anfragen gestellt, fast die Hälfte aller Kleinen Anfragen insgesamt und mehr als doppelt so viele wie die größere Oppositionsfraktion der CDU. Diese Fragenflut abzuarbeiten, bindet in den Ministerien beträchtliche Ressourcen. Man muss die Behörden dafür nicht bemitleiden, das ist ihr Job. Aber man kann sich des Eindrucks kaum erwehren, dass das Gros dieser Anfragen nicht in erster Linie zum Zweck hat, am Wissen der Regierung teilzuhaben. Auch von den Beteiligungsrechten in den Ausschüssen und im Plenum macht die AfD regelmäßig auf eine Weise Gebrauch, die kaum zu etwas anderem taugt, als möglichst massenhaft billiges Material für die eigenen Blogs und Social Media-Kanäle zu generieren und damit ihre Erzählung von der Korruption des Parteienestablishments und des ganzen Systems mit oft eigens zu diesem Zweck provozierter Evidenz zu füttern.
Von der Obstruktion zur Blockade
In Thüringen – und Sachsen – werden sich die Möglichkeiten der autoritären Populisten, das Parlament zu behindern und zu blockieren, nach dem 1. September womöglich potenzieren. Dass der Landesvorsitzende Björn Höcke die Marke von 33 Prozent zum Wahlziel ausgerufen hat, ist sicherlich kein Zufall. Er und seine Leute haben die Thüringer Verfassung und die Geschäftsordnung des Landtags offenbar gründlich studiert. Und auch wenn 33 Prozent der Stimmen zur Zeit als unwahrscheinlich gelten, könnte die Partei – wenn Grüne und FDP an der Fünfprozenthürde scheitern –, ein Drittel der Sitze im Landtag erreichen. Damit könnte sie alle Entscheidungen blockieren, die mit einer Zweidrittelmehrheit gefällt werden müssen. Dazu gehören Verfassungsänderungen, aber auch beispielsweise die Wahl der Richter:innen am Thüringer Verfassungsgerichtshof in Weimar.
Die Landesverfassungsgerichte bekommen in dem gewaltigen Schatten, den das Bundesverfassungsgericht wirft, nur selten einen Sonnenstrahl öffentlicher Aufmerksamkeit ab. Die Landesverfassungsgerichte sind aber wichtig für die technischeren und weniger spektakulären Fragen des Staatsorganisationsrechts, für den Maschinenraum der Demokratie: Sie wachen über das Wahl- und Parlamentsrecht, über Kommunal-, Medien- und Kulturpolitik, über direkte Demokratie, Volksentscheide und Volksbegehren, über Mehrheitsmacht und Minderheitenrechte.
Deswegen sind die Wahlen der Landesverfassungsrichter:innen für die autoritär-populistische Strategie hochinteressant. Die Amtszeit der Richter:innen am Weimarer Verfassungsgerichtshof beträgt nur sieben Jahre. Die Amtszeit aller Richter:innen läuft innerhalb der nächsten Legislaturperiode aus. Das gäbe der AfD, sofern sie über 33 Prozent der Sitze im Landtag bekommt, ein sehr mächtiges Erpressungsinstrument in die Hand. Sie könnte die Neubesetzung aller Posten blockieren. Dazu kommt, dass die Richter:innen des Thüringer Verfassungsgerichtshofs endgültig ausscheiden, wenn sie die Altersgrenze von 68 Jahren erreichen. Es kann also passieren, dass ein Gericht durch Blockade mit zunehmendem Zeitablauf so ausgedünnt wird, dass irgendwann seine Beschlussfähigkeit infrage steht.
Auch wenn es dazu nicht kommt, wirkt eine autoritär-populistische Sperrminorität wie eine Ratsche, also ein Zahnrad mit Sperrklinke: Sie sorgt dafür, dass sich der Auswahlmechanismus für Verfassungsrichter:innen nur noch in eine Richtung dreht. Wenn ein Kandidat ihr passt, dreht sich das Rad einen Zahn weiter. Wenn nicht, greift der Sperrmechanismus. So füllt sich das Gericht allmählich mit immer mehr Leuten, die den autoritären Populisten im Zweifel jedenfalls weniger Ärger zu machen versprechen als die abgelehnten Kandidat:innen. Jede einzelne Drehung des Klinkenrads erscheint unspektakulär. Aber am Ende sitzt der Spanngurt fest.
Das Landesverfassungsgericht ist nicht die einzige juristische Institution, die sich eine autoritär-populistische Blockademinderheit zunutze machen kann. Die ganze Justiz kann zu ihrer Geisel werden. Auf den öffentlichen Dienst in Thüringen, wie auf den aller ostdeutschen Bundesländer, rollt gerade eine gigantische Pensionierungswelle zu, weil die vielen Anfang der 90er Jahre installierten Westimporte allmählich das Rentenalter erreichen. Diese freien Stellen müssen nachbesetzt werden, sonst wird die Justiz in Thüringen arbeitsunfähig. Die Verfassung sieht vor, dass die Berufung zur Richter:in auf Lebenszeit von einem Richterwahlausschuss des Landtags genehmigt werden muss. Dessen Mitglieder werden, soweit sie vom Landtag bestellt werden, mit Zweidrittelmehrheit gewählt, und jede Fraktion im Landtag muss mit mindestens einer Person in ihm vertreten sein. Auch das steht direkt in der Verfassung.
Nicht minder dramatisch wäre die Situation für ein weiteres Gremium von großer Wichtigkeit: die Parlamentarische Kontrollkommission. Dieses fünfköpfige Gremium hat laut Verfassung für den Landtag die Tätigkeit des Landesamts für Verfassungsschutz zu überwachen. Der Inlandsgeheimdienst muss alle Informationen geben, die sie von ihm anfordert. Die Mitglieder der Kommission sind zwar zur Geheimhaltung verpflichtet, dürfen aber ihren Fraktionsvorsitzenden – das wäre im Fall der AfD dann wohl Björn Höcke – über die „wesentlichen Inhalte der Beratungen unterrichten“. Mit anderen Worten: Wenn die AfD in diesem Gremium säße, dann wüsste eine vom Verfassungsschutz beobachtete und als gesichert rechtsextrem eingestufte Organisation, was der Verfassungsschutz in Thüringen über sie und überhaupt über die rechte Szene in Thüringen weiß. Dann könnte der Verfassungsschutz in Thüringen, was die Rechten betrifft, seine Arbeit wohl auch gleich ganz einstellen.
Nun müssen aber die Mitglieder dieses von der Verfassung zwingend vorgeschriebenen Gremiums mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden. Das ist auch in der jetzt zu Ende gehenden 7. Legislaturperiode nicht gelungen, weil die CDU auch den Linken und den Grünen ihre Plätze in dieser Kommission bisher hartnäckig verweigert. Anders als der Richterwahlausschuss ist die Kommission kein Parlamentsausschuss im strengen Sinne und muss sich nicht nach jeder Wahl neu konstituieren. Sie bleibt im Amt, bis die neue Kommission zusammentritt. Aber das geht nur für maximal eine Legislaturperiode. Schon jetzt sind von den ursprünglichen fünf Mitgliedern der 6. Wahlperiode nur noch drei übrig, weil zwei gar nicht mehr im Landtag sind. Das kann nicht mehr lange gutgehen.
Die Verfassung kann sich nicht selbst schützen
Im Thüringen-Projekt[2] haben wir uns intensiv damit beschäftigt, was die Verfassung und ihre Interpreten leisten können, um Verfassungsmissbrauch zu verhindern und autoritäre Populisten zu stoppen. Dazu konnten wir insbesondere die verfassungspolitischen Erfahrungen zweier europäischer Nachbarländer auswerten: In Ungarn und in Polen wurde die autoritär-populistische Strategie mit besonders zerstörerischer Konsequenz vorangetrieben. Vor allem Ungarn dient seit langer Zeit der ganzen autoritär-populistischen Bewegung in Europa als Inspiration und Vorbild – auch und nicht zuletzt der Thüringer AfD und ihrem Vorsitzenden Höcke. Beide Fälle unterscheiden sich in vielfacher Hinsicht, nicht zuletzt im Ergebnis: In Ungarn erscheint es auf absehbare Zeit nicht mehr vorstellbar, dass das autoritär-populistische Regime mit demokratischen Mitteln wieder abgewählt werden kann. In Polen ist genau das gelungen –, aber ob und inwieweit sich die in der autoritär-populistischen Regierungszeit zertrümmerten Institutionen wieder reparieren lassen, ist noch offen. Gemeinsam ist aber beiden Fällen, dass man an ihnen studieren kann, wie die autoritär-populistische Strategie aussieht und welcher Taktiken sie sich bedient.
Vor diesem Hintergrund haben wir im Rahmen des Thüringen-Projekts Möglichkeiten identifiziert, die Resilienz des Rechtsstaats und der Demokratie in Deutschland zu stärken. Wenn eine Sperrminorität der AfD bei diesen Wahlen noch verhindert wird, dann könnten einige davon immer noch in die Thüringer Verfassung eingebaut werden – vorausgesetzt, die übrigen im neu gewählten Landtag vertretenen Parteien einigen sich darauf. Aber am Ende sind alle verfassungsrechtlichen Mechanismen, Werkzeuge und Institutionen nur so gut wie das, was die Gesellschaft aus und mit ihnen macht. Die Institutionen der Verfassung können sich nicht selbst schützen – dafür ist die Gesellschaft verantwortlich. Sie muss eine robuste politische Kultur entwickeln, die das autoritär-populistische Spiel rechtzeitig als das erkennt, was es ist: eine Strategie zur Errichtung eines autoritären Regimes. Die Verfassung ist ein Text. Ein wichtiger und inspirierender Text. Gewählte Politiker können ihren Teil zu ihrem Schutz beitragen. Aber Demokratie und Freiheit zu retten, zu verbessern und zu beschützen, ist auch die Aufgabe aller, als Zivilgesellschaft: beim Frühstück, im Büro, im Supermarkt, auf der Demo, beim Familienessen. Das Recht und seine Institutionen können uns nicht retten. Wir sie umgekehrt dagegen schon.
Dieser Beitrag basiert auf „Die verwundbare Demokratie“, dem jüngsten Buch des Autors, das soeben im Hanser Verlag erschienen ist.
[1] Vgl. Steven Levitsky und Daniel Ziblatt, Die Banalität des Autoritarismus, in: „Blätter“, 7/2024, S. 57-63.
[2] Vgl. verfassungsblog.de/thuringen-projekt.