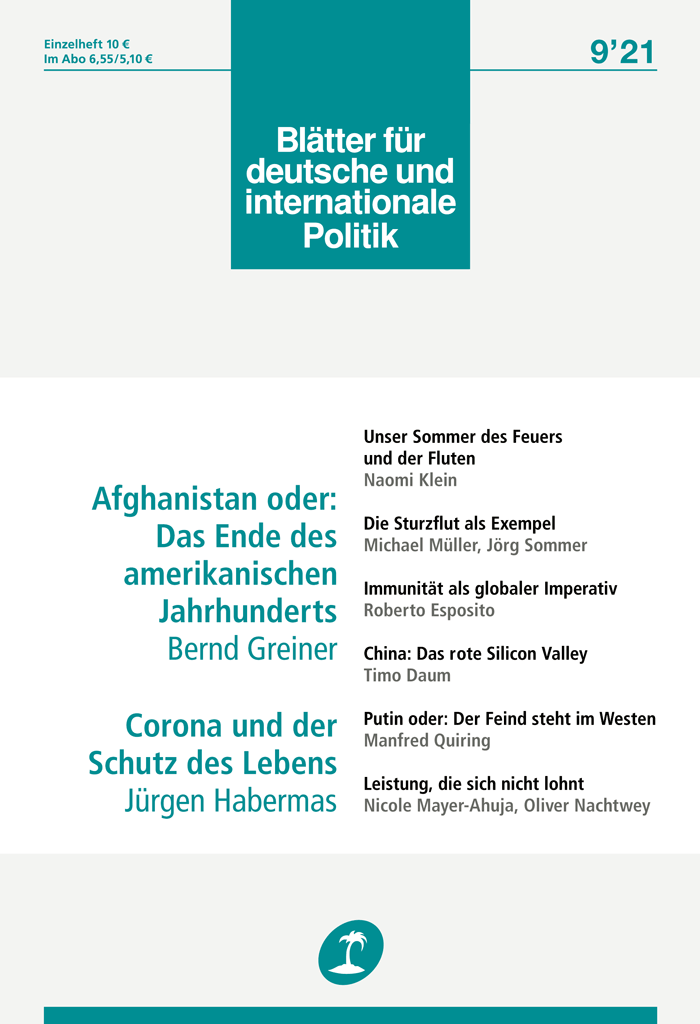Bild: Gedenkmarsch anlässlich des Nationalfeiertags des 1956er Volksaufstandes in Budapest/Ungarn, 23.10.2020 (IMAGO / EST&OST)
Es scheint, als sei in Brüssel endlich ein sehr langer Geduldsfaden gerissen. Jahrelang haben europäische Institutionen und Politiker die autoritären Entwicklungen in Ungarn und Polen zwar mehr oder weniger scharf kritisiert, ernsthafte Konsequenzen mussten die Regierungen in Budapest und Warschau aber nur selten fürchten. Meist genügten kleinere Zugeständnisse ihrerseits, um den Konflikt zu entschärfen. Das könnte sich nun ändern. Bei der Vorstellung des jüngsten Rechtsstaatsberichts der EU im Juli wurde Justizkommissar Didier Reynders ungewohnt deutlich. Mit Blick auf Ungarn sagte der belgische Liberale: „Es geht nicht länger um Prävention, sondern um Sanktionen.“[1] Die EU werde alles tun, um die Demokratie zu schützen.
Dazu hat die EU-Kommission seit kurzem ein besonders starkes Druckmittel in der Hand: Derzeit werden die enormen Summen aus dem Recovery Fund ausgezahlt, mit dem die EU den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Coronakrise stemmen will. Sie können jedoch bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit zurückgehalten werden. Genau dieses scharfe Schwert hat Brüssel nun gezückt – und zumindest in Warschau schon für erhebliche Unruhe gesorgt: Angesichts von blockierten Geldern in Milliardenhöhe kündigte die PiS-geführte Regierung an, die neu geschaffene Disziplinarkammer für Richter wieder aufzulösen und damit das Kernstück ihrer umstrittenen Justizreform zurückzunehmen. Diese Kammer nutzte die Regierung bislang, um unbotmäßige Juristen einzuschüchtern und kaltzustellen; der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hatte sie Mitte Juli für illegal und ihre Urteile für nichtig erklärt. Im gleichen Atemzug verkündete Warschau allerdings, es akzeptiere keineswegs den Vorrang des europäischen vor dem nationalen Recht und werde nach anderen Wegen zur Disziplinierung von Richtern suchen.[2]
Daran zeigt sich: Für die Europäische Union geht es bei dieser Kraftprobe um sehr viel mehr als um Geld. Auf dem Spiel steht längst etwas viel bedeutsameres: ihre innere Einheit – und damit die Handlungsfähigkeit Europas in einer immer stärker krisengeplagten Welt.
Rückkehr zur Wertegemeinschaft?
Gerade die Corona-Pandemie hat auf dem Kontinent das Bewusstsein dafür gestärkt, dass Europa gemeinsam agieren muss. Dies ist in den vergangenen Monaten zwar nicht immer – oder nicht immer rechtzeitig – geglückt, aber es zeigt sich zunehmend, dass sich die EU auf eine stärkere Rolle vorbereitet. Jüngstes Beispiel dafür ist ihr Klimaschutzprogramm „Fit for 55“, das zwar gemessen am 1,5-Grad-Ziel unzureichend ist, dessen gesamteuropäische Ziele in vielen Fällen aber weit über die Pläne der einzelnen Mitgliedstaaten hinausgehen und entsprechenden Handlungsdruck entfalten können. Europa beansprucht damit die Rolle eines internationalen Antreibers in Sachen Klimaschutz.
Zudem könnte der im vergangenen Jahr aufgelegte Recovery Fund, für den die Mitgliedstaaten erstmals gemeinsam Schulden aufgenommen haben, mittelfristig zu einer gemeinsamen Finanzpolitik der EU führen und Brüssel so einen größeren Gestaltungsspielraum verschaffen.[3]
Es ist daher wohl mehr als nur Zufall, dass Brüssel ausgerechnet jetzt die Gangart gegenüber Budapest und Warschau verschärft – und sich dabei auf die Tradition von Europa als einer Wertegemeinschaft zurückbesinnt. Lange galt in der EU das Credo, so viele Staaten wie möglich einzubinden, um die Ost-West-Spaltung des Kalten Krieges nicht wieder aufbrechen zu lassen, selbst wenn dazu ein Formelkompromiss mit anti-demokratischen Politikern wie Ungarns Premierminister Viktor Orbán nötig sein sollte. Das aber sorgt zunehmend für Unmut. Aus gutem Grund: Nur ein länder- wie lagerübergreifender Konsens über die europäischen Grundwerte kann langfristig die Legitimation bieten, um beispielsweise die enorme finanzielle Kraftanstrengung einer gemeinsamen Finanzpolitik aufzubringen, deren Ziel nicht zuletzt in der Angleichung der Lebensverhältnisse in der EU besteht. Sollten hingegen die Bürger in reichen Staaten wie Deutschland und den Niederlanden den Eindruck gewinnen müssen, dass sie mit ihren Steuergeldern ein gefestigtes autoritäres und obendrein hochgradig korruptes Regime in Budapest finanzieren, so wäre die gemeinsame Finanzpolitik schon im Ansatz zum Scheitern verurteilt.
Kurs auf die autoritäre Ordnung
Die Sanktionen gegen Ungarn und Polen sind dabei keineswegs Versuche, in beiden Ländern einen „Regimewechsel“ zu erzwingen, wie jüngst der Soziologe Wolfgang Streeck behauptet hat.[4] Vielmehr betreiben die dortigen Regierungen den Regimewechsel schon seit Jahren selbst und entfernen sich dabei mit großen Schritten von der Demokratie: Bereits jetzt manifestiert sich etwa in Polen ein „wettbewerbseinschränkender Autoritarismus“, so der polnische Verfassungsrechtler und ehemalige Ombudsmann Adam Bodnar:[5] Die PiS setzt alles daran, dass bei den nächsten Parlamentswahlen, die regulär 2023 anstehen, kein fairer Wettbewerb zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien möglich sein wird. Dazu versucht sie, ihre Getreuen an der Spitze von Justiz und Medien zu installieren, um so die demokratische Kontrolle der Regierung und selbst schon die neutrale Berichterstattung über deren Politik zu erschweren.
Erneut deutlich wurde dies zuletzt beim neuen, bislang noch nicht rechtskräftigen Mediengesetz der Regierung. Es sieht vor, dass Unternehmen von außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, zu dem neben der EU auch Norwegen, Liechtenstein und Island zählen, keine Mehrheitseigner polnischer Medien sein dürfen. Dies zielt offensichtlich auf den populären Fernsehsender TVN, der als eine der letzten Stationen noch kritisch über die Regierung berichtet und der Discovery-Gruppe gehört. Sollte das US-Unternehmen nun gezwungen sein, Anteile an TVN abzustoßen, könnten diese „vielleicht von polnischen Geschäftsleuten gekauft werden, und wir werden einen gewissen Einfluss darauf haben, was in diesem Sender geschieht“, benennt der PiS-Abgeordnete Marek Suski ganz unverblümt das Ziel der Operation.[6]
Ungarn ist auf diesem abschüssigen Pfad in die autoritäre Ordnung schon weiter vorangekommen. Die Orbán-Regierung hat neben den Medien längst auch Nichtregierungsorganisationen und Universitäten ins Visier genommen und in einem besonders schlagzeilenträchtigen Fall bereits 2019 die private Central European University außer Landes gezwungen. Die geschwächten rechtsstaatlichen Kontrollmöglichkeiten haben dort zudem eine zuweilen dubiose Verflechtung zwischen der regierenden Fidesz und ihr nahestehenden Unternehmern entstehen lassen. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung OLAF hat mehrere Fälle aufgedeckt, in denen EU-Gelder zweckentfremdet wurden. Bevor die ungarischen Behörden diese nicht aufgeklärt haben, will die EU-Kommission nun die Mittel aus dem Recovery Fund einbehalten.
Wie sehr diese Ankündigung einen Nerv getroffen hat, demonstriert die aggressive Antwort der ungarischen Justizministerin Judit Varga: Indem Brüssel auf Rechtsstaatlichkeit poche, betreibe es eine „erzwungene Integration“ hin zu „einem Imperium, geführt von Brüsseler Bürokraten.“[7] Ihr polnischer Amtskollege Zbigniew Ziobro beklagte im Streit um die Justizreform gar „illegale Erpressung“ durch die EU und erklärte, Polen solle nicht um jeden Preis Mitglied in der Union bleiben.[8]
Dennoch spricht wenig dafür, dass Warschau oder Budapest angesichts verschärfter Sanktionen einen EU-Austritt anstreben. Denn ihre machtvolle Rhetorik und die viel beschworene nationale Souveränität können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Ungarn und Polen außerhalb der EU weder mächtig noch wirklich souverän wären.
Souveränität als Fiktion
Ungarn ist wirtschaftlich hochgradig abhängig von der EU: Finanztransfers aus Brüssel machen rund vier Prozent seines Bruttoinlandsproduktes aus und finanzieren Schätzungen zufolge gut 90 Prozent aller bedeutenden Infrastrukturprojekte im Land.[9] Eines der wichtigsten ungarischen Exportgüter sind Autos, die deutsche Hersteller im Land produzieren lassen. Ohne Zugang zum Binnenmarkt und Überweisungen aus Brüssel würde das ohnehin nicht sehr wohlhabende Land ökonomisch schnell absinken. Auch das erklärt das ostentative Interesse Orbáns an Chinas Neuer Seidenstraße – Beijing knüpft Investitionen bekanntlich nicht an den Erhalt des Rechtsstaates.[10]
Polen ist zwar wirtschaftlich stärker, die PiS-Regierung kann jedoch den Bruch mit dem Westen nicht riskieren, da sie, anders als die ungarische Fidesz, in Russland keinen Partner, sondern eine Bedrohung sieht. In Sicherheitsfragen setzt Warschau parteiübergreifend auf Nato und USA.[11] Die aber sind unter Joe Biden wieder näher an die EU gerückt und haben Polen für das neue Mediengesetz scharf kritisiert. Inoffiziell drohte Washington gar mit der Verlagerung von US-Truppen von Polen nach Rumänien; laut dem ehemaligen britischen Europaminister Denis McShane stellen einige US-Abgeordnete inzwischen selbst die Nato-Mitgliedschaft Polens in Frage.[12]
Ein EU-Austritt entspräche zudem nicht dem Willen der mehrheitlich europafreundlichen Bevölkerungen. Viele Polen beispielsweise sind in den vergangenen Jahren liberaler geworden, die jüngeren zudem linker, und widersetzen sich zunehmend dem nationalistischen und homophoben Kulturkampf der PiS.[13] Mit einem schärferen Vorgehen stärkt die EU-Kommission daher auch der Zivilgesellschaft in Mittel-Osteuropa den Rücken, die in den vergangenen Jahren verstärkt gegen autoritäre Tendenzen und Korruption mobil gemacht hat. In Polen und Ungarn, aber auch in Bulgarien, Rumänien und der Slowakei, gingen wiederholt Tausende von Menschen auf die Straße, in der Tschechischen Republik kam es gar zu den größten Demonstrationen seit der Samtenen Revolution von 1989.
Kein Platz für Wahlautokratien
Aus der Zivilgesellschaft muss denn auch der eigentliche Veränderungsimpuls kommen. Nur mit ihrer Hilfe kann ein Wahlsieg der Opposition glücken, die in Polen und mehr noch in Ungarn zwar unter unfairen Bedingungen agiert, aber immer noch keineswegs aussichtslos ist.
Die EU hingegen kann einen substanziellen Politikwechsel in Budapest und Warschau hin zur Achtung von Demokratie, Gewaltenteilung und Minderheitenrechten nur sehr begrenzt forcieren. Denn so sehr gerade dem taktisch gewieften Orbán bewusst sein wird, dass er einen vollständigen Bruch mit der EU nicht riskieren kann, so sehr konnte er sich bislang auf sein Gespür dafür verlassen, wie weit er gehen kann, ohne eine maximale Eskalation zu riskieren.
Zudem kommt die Brüsseler Intervention im Falle Ungarns ausgesprochen spät. Dort ist der autoritäre Umbau schon weit fortgeschritten und teilweise verfassungsrechtlich abgesichert, nicht zuletzt aufgrund der langjährigen Protektion der Fidesz durch die Europäische Volkspartei, und dabei insbesondere durch die CDU/CSU. Die jetzigen Sanktionen werden Orbán daher nicht von seinem Kurs abbringen. Sie können gerade im ungarischen Fall bestenfalls eine weitere Aushöhlung der Demokratie verhindern.
Sie senden aber ein wichtiges Signal an die ungarische und polnische sowie an die europäische Öffentlichkeit im Allgemeinen: Die EU will eine Gemeinschaft der Demokratie und des Rechts bleiben. Sie hat keinen Platz für Wahlautokratien nach dem Muster des Putin-Regimes in Russland, wo Wahlen nur noch der regelmäßigen Bestätigung der herrschenden Partei dienen, ein Machtwechsel aber schon im Ansatz unterbunden werden soll.
Für diese Botschaft ist es auch höchste Zeit, denn andere autoritäre Kräfte stehen schon in den Startlöchern. So will im kommenden Jahr nicht nur Viktor Orbán wiedergewählt, sondern auch Marine Le Pen französische Präsidentin werden. Und 2023 kämpft voraussichtlich nicht nur die PiS um die Macht, sondern auch die italienische Rechte aus Lega und Fratelli d‘Italia. Längst sind diese Kräfte europaweit vernetzt und arbeiten derzeit am Aufbau einer gemeinsamen Rechtsfraktion im Europaparlament.
Der Kampf um die Zukunft der europäischen Demokratie hat gerade erst begonnen.
[1] Edit Inotai, Nicholas Watson, Marcel Gascón Barberá, Anja Vladisavljevic und Sinisa Jakov Marusic, Hungary, Poland Face EU Fund Freezes after Rule of Law Report Criticism, www.balkaninsight.com, 20.7.2021.
[2] Fast zeitgleich bekannte sich die Bundesregierung genau zu diesem Vorrang, nachdem die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland angestrengt und damit auf das letztjährige Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen der EZB reagiert hatte.
[3] Steffen Vogel, Merkels Wende: Europas letzte Chance?, in: „Blätter“, 7/2020, S. 5-8.
[4] Vgl. „Die EU ist zum Scheitern verurteilt“, in: „Der Spiegel“, 29/2021.
[5] Vgl. Verfassungsrechtler Adam Bodnar: „Kümmert euch um Polen“, www.profil.at, 27.7.2021.
[6] Agata Kondzinska und Paweł Wronski, Poland’s Ruling Camp Passes Anti-U.S. Media Bill, Violating Parliamentary Procedure, www.wyborcza.pl, 12.8.2021.
[7] Judit Varga, Blurred lines – the case of the ‘political EU Commission’, www.euobserver.com, 6.8.2021.
[8] Vgl. Poland should not stay in EU at all costs, says minister, www.euractiv.com, 6.8.2021.
[9] Daniel Imwinkelried, Ivo Mijnssen und Daniel Steinvorth, Ungarns Vetternwirtschaft: „Gott, Glück und Viktor Orban“, www.nzz.ch, 28.11.2020.
[10] Szabolcs Panyi, Hungary Could Turn Into China’s Trojan horse in Europe, www.balkaninsight.com, 9.4.2021.
[11] Jakub Bornio, Poland’s changing role on the eastern flank of NATO, www.neweasterneurope.eu, 29.6.2021.
[12] Denis MacShane, Is Poland ending 200 years of freedom of expression?, www.euobserver.com, 11.8.2021.
[13] Daniel Tilles, Poles becoming more socially liberal, with growing support for LGBT rights and abortion: poll, www.notesfrompoland.com, 6.8.2021.