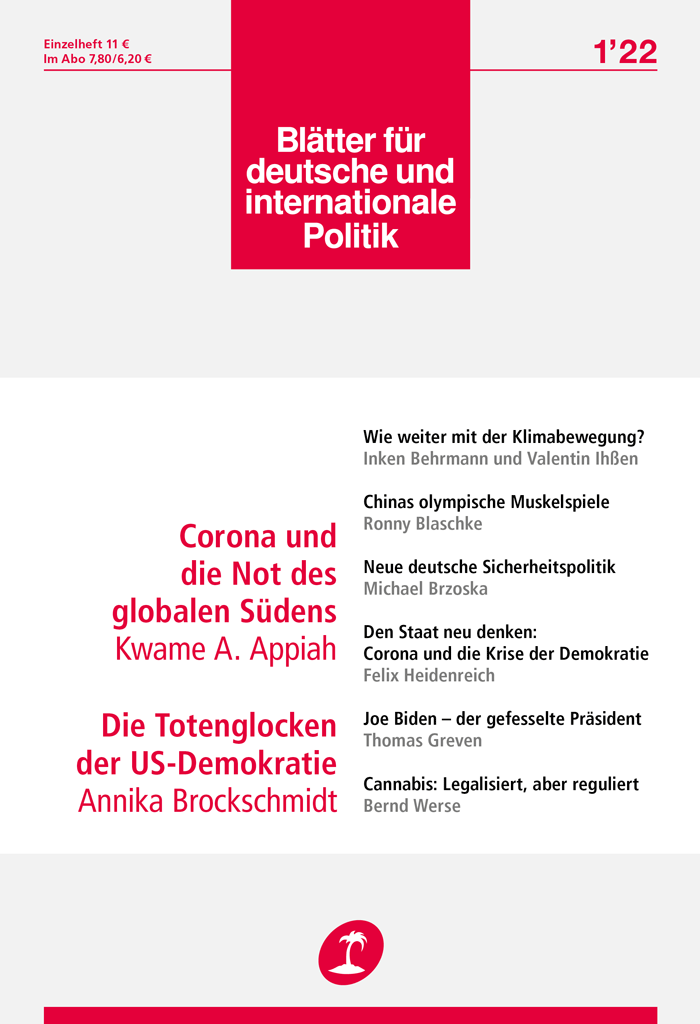Für eine neue deutsch-europäische Sicherheitspolitik

Bild: Bundesaussenministerin Annalena Baerbock trifft die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in Brüssel, 12.12.2021 (IMAGO / photothek)
Die Sicherheitspolitik des Westens steckt in einer tiefen Krise: Das zeigte sich zuletzt eindrücklich in Afghanistan, wo es einem lokalen bewaffneten Akteur gelang, die westlichen Truppen in einem jahrzehntelangen Krieg zu zermürben. Während die globale Dominanz der USA zunehmend in Frage gestellt wird, gewinnt China regional wie global an Macht und Einfluss. Zugleich rüsten viele Staaten auf, eine Rüstungskontrolle findet jedoch kaum noch statt. Mit der Folge, dass die Friedlosigkeit in der Welt insgesamt zunimmt. Daneben gewinnen globale Probleme, wie der Klimawandel, der Verlust an Biodiversität und Pandemien immer mehr an Bedeutung.
Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen für eine deutsche Sicherheitspolitik, die dem im Grundgesetz verankerten Ziel, „dem Frieden in der Welt zu dienen“, verpflichtet ist? Und wie kann diese zukunftsorientiert ausgerichtet werden? Das Spektrum der möglichen Antworten auf diese Fragen ist vielfältig. Eine Möglichkeit besteht darin, sich sowohl vor den aktuellen Gefahren für den Frieden als auch vor den langfristigen existenziellen Problemen wegzuducken. Eine andere Möglichkeit ist, stark genug zu werden, um die eigenen Vorstellungen davon, wie internationale Ordnung hergestellt werden kann, durchzusetzen – auch gegen den Willen anderer Akteure. Konkret hieße das für den Westen, einschließlich Deutschlands, unter Führung der USA mit allen Mitteln seine Vormachtstellung zu verteidigen und vorrangig den Aufstieg Chinas zu stoppen.[1] Die neue Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sieht ebendies auch als Voraussetzung für „ein Zusammenspiel von Dialog und Härte“.[2]
Beide Alternativen sind jedoch untauglich. Untätige Akteure werden früher oder später von den Problemen überrannt oder müssen sich dem anpassen, was andere bestimmen. Beispiele für die Konsequenzen solchen Verhaltens bieten etwa die 1930er Jahre, als Nachbarstaaten, aber auch die USA die Aggressivität des deutschen Faschismus lange Zeit unterschätzten.
Doch auch das Streben nach einer Fortsetzung der westlichen Hegemonie stellt einen Irrweg dar. In der jüngeren Vergangenheit haben wir, Stück für Stück, das Scheitern dieser Strategie erlebt. Der „unipolare Moment“ nach dem kampflosen Sieg des von den USA geprägten Modells des liberalen Kapitalismus über den Staatssozialismus unter bolschewistischer Kontrolle wurde dazu genutzt, um Kriege zu führen, auch wenn diese gegen vereinbartes internationales Recht verstießen – wie im Kosovo, im Irak und in Libyen. Und die Vorstellung vom „Ende der Geschichte“, wonach letztlich alle Menschen davon überzeugt seien, dass das westliche Modell alternativlos ist, hat sich nicht erst mit dem unrühmlichen Ende des westlichen militärischen Engagements in Afghanistan als fataler, friedensfeindlicher Fehlschluss erwiesen.[3] Das Festhalten an der Vorstellung, die USA müssten auf ewig die führende Weltmacht bleiben, erschwert den friedlichen Übergang in eine Welt, in der andere Staaten nicht nur ein Vielfaches der Bevölkerung stellen, sondern diese auch in Wirtschaftskraft ummünzen und eine angemessene Rolle in der Gestaltung der Weltordnung beanspruchen.
Die deutsche Sicherheitspolitik muss einen neuen Ort zwischen diesen zwei extremen Alternativen finden. Die Bindung an Staaten mit liberaler Wertorientierung bleibt dabei wichtig, auch mit Blick auf die militärische Komponente. Angesichts der derzeitigen russischen Politik liegt die Erhaltung der Nato als Militärbündnis in deutschem Interesse, denn eine europäische Alternative ist nicht absehbar.[4] Aber zugleich muss die Bereitschaft zunehmen, auch mit jenen Regierungen zusammenzuarbeiten, die weder demokratisch noch liberal sind. Denn in einer globalen Ordnung ohne Hegemon lassen sich vereinbarte Regeln nur kooperativ durchsetzen. Gleiches gilt für die Bearbeitung globaler Zukunftsprobleme. Sicherheitspolitik sollte dabei nicht zum Hemmschuh werden, indem sie Konfrontationen verschärft, sondern sie sollte – etwa durch Rüstungskontrolle – vielmehr Gemeinsamkeit befördern. Weitere Leitlinien zukunftsorientierter Sicherheitspolitik sollten Bescheidenheit und Zurückhaltung sein. Selbst in den Jahren US-amerikanischer Dominanz waren die Ziele begrenzt, die sich mit sicherheitspolitischem Instrumentarium von Militär bis Krisendiplomatie umsetzen ließen. Das gilt umso mehr für die Periode nach dem Ende der Unipolarität.
Die notwendige Neuausrichtung der deutschen Sicherheitspolitik
Auch im deutschen sicherheitspolitischen Diskurs der vergangenen drei Jahrzehnte dominierte die Vorstellung von der ideologischen Überlegenheit des westlichen Modells, mit den USA als dessen Hüter. Für dessen Sicherung war die deutsche Politik zunehmend bereit, „Verantwortung“ zu übernehmen, nicht zuletzt auch in den Auslandseinsätzen der Bundeswehr in Afghanistan, im Irak und in Mali. Gleichzeitig unterstützte sie die vor allem von Frankreich vorangetriebenen Versuche, neben der von den USA angeführten Nato auch innerhalb der EU eine europäische sicherheitspolitische Dimension aufzubauen, etwa durch die Vereinbarung einer Beistandspflicht im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats in Artikel 42(7) des EU-Vertrages oder die Schaffung eigenständiger militärischer Planungskapazitäten. Zugleich versuchte sie, gegenüber Russland eine konziliantere Politik zu fahren als die USA. Beides erfolgte allerdings, ohne die Führungsmacht der USA in Hinblick auf die hard security in Frage zu stellen.[5] Diese grob skizzierte Orientierung der deutschen Sicherheitspolitik wird allerdings durch Trends und Tendenzen in der US-amerikanischen Politik selbst in Frage gestellt. Das wurde besonders während der Präsidentschaft Donald Trumps deutlich, hat sich aber mit dem Amtsantritt Joe Bidens nicht grundlegend geändert.[6] Auch Biden macht deutlich, dass für die USA der pazifische Raum sicherheitspolitisch Vorrang hat. Stärker noch als Trump verknüpft seine Administration dies mit einem konfrontativen Vorgehen gegenüber China. Zwar betont der amtierende Präsident im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dass ihm die Nato wichtig sei. Das ändert aber nichts daran, dass für ihn die Eindämmung Chinas eine höhere Priorität hat. Was diese Prioritätensetzung konkret bedeuten kann, wurde mit dem von den USA, Großbritannien und Australien geschlossenen Sicherheitspakt „Aukus“ und der damit verbundenen diplomatischen wie ökonomischen Ausbootung Frankreichs deutlich.
Allein die laufende Umorientierung der USA erfordert eine Neujustierung der bisherigen deutschen Sicherheitspolitik. Eine Verschärfung der Konfrontation mit China liegt nicht im deutschen Interesse, nicht nur wegen der wirtschaftlichen Aspekte, sondern auch wegen der Gefahren, die in der Veränderung der globalen Machtarchitektur liegen. Eine weitere Verschlechterung des Verhältnisses zwischen den USA und China schwächt die (noch) funktionierenden Elemente der globalen regelbasierten Ordnung, erschwert ein gemeinsames Handeln bei globalen Problemen und birgt zudem die Gefahr eines verheerenden militärischen Konflikts.[7] Ein für den Westen wie China akzeptables Arrangement erfordert Zugeständnisse sowohl von der chinesischen als auch von der US-amerikanischen Führung. Aus westlicher Sicht sind Fragen der Akzeptanz global vereinbarter Regeln zu Menschenrechten und Minderheitenschutz sowie der Verzicht auf militärische Aggression in der Nachbarschaft vorrangig; für die chinesische Seite ist es wichtig, als gleichberechtigter Partner des Westens in der Weltpolitik anerkannt zu sein und dass die USA die provokativen Demonstrationen ihrer Militärmacht in der Region einstellen. Eine zukunftsorientierte deutsche Sicherheitspolitik sollte daher die eigenen Wertvorstellungen aktiv vertreten, zugleich aber der Eskalationsstrategie der USA gegenüber China entgegentreten. Insbesondere in der Frage, ob sich die Nato künftig strategisch gegen China ausrichtet, sollte sich Deutschland verweigern.
Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zum Interessensausgleich bilden auch zentrale Bestandteile eines tragfähigen Verhältnisses zu Russland. Zwar kann das nicht bedeuten, auf die Fähigkeit zur Verteidigung des Territoriums verbündeter Staaten zu verzichten. Aber die militärische Dimension der Sicherheitspolitik muss der politischen untergeordnet bleiben und letztere sollte auf Kooperation statt auf Konfrontation abzielen. Eine weitere militärische Eskalation stellt keine zukunftsorientierte Strategie dar. Schon jetzt avanciert die Bedrohung Russlands durch den Westen zunehmend zum zentralen Narrativ Präsident Putins.[8] Eine solche Entwicklung erschwert es, nach Möglichkeiten des Ausgleichs und der Zusammenarbeit mit Russland zu suchen. So mühselig solche Versuche sind, nicht zuletzt aufgrund der russischen Politik in der Ukraine, im eigenen Land und anderswo, so unvermeidbar sind sie für die Sicherheit in Europa.[9]
Die Zukunft der europäischen Sicherheitspolitik
Auch auf die partielle Abkehr der USA von der Nato, die sich bei einer neuerlichen Präsidentschaft Trumps durchaus in eine endgültige verwandeln könnte, muss die deutsche Sicherheitspolitik zukunftsorientiert reagieren. Insbesondere in Mittel- und Osteuropa wächst die Angst vor einer aggressiven Politik Russlands. Dies weckt zugleich Erwartungen nach einem Aufbau militärischer Stärke der Europäischen Union und insbesondere einem stärkeren militärischen Beitrag Deutschlands.
Die Zweifel an der langfristigen Verlässlichkeit der USA sind insbesondere in Frankreich durchaus dankbar angenommen worden. Präsident Emmanuel Macron schwebt – ganz im Sinne vieler seiner Amtsvorgänger – ein militärisch starkes Europa vor, das zwar den Schulterschluss mit den USA sucht, aber zugleich in wichtigen sicherheitspolitischen Fragen zu eigenständigem Handeln fähig ist.[10] Das Vorhaben hat infolge des Brexit-Schocks breiten Zuspruch in der EU gefunden, auch weil es als gemeinsames Projekt den Zentrifugalkräften in anderen Politikfeldern, etwa der Migrationspolitik oder der Rechtsstaatlichkeit, entgegenwirken könnte.
Die Idee eines militärisch starken und strategisch eigenständigen Europas auf Augenhöhe mit den USA und China ist allerdings eine Chimäre – aktuell wie auf absehbare Zeit.[11] Grundvoraussetzung dafür wäre ein gemeinsames Entscheidungszentrum, dem sich die Nationalstaaten unterordnen müssten. Zu den größten Gegnern einer solchen Entmachtung der Hauptstädte zählt Frankreich, das zugleich der entschiedenste Befürworter einer Weltmacht Europa ist.[12] Aufgelöst werden soll dieser Widerspruch letztendlich dadurch, dass sich die anderen Mitgliedstaaten der EU den französischen Zielvorstellungen für eine gemeinsame EU-europäische Friedens- und Sicherheitspolitik anschließen und, unter der Führung Frankreichs, des einzig verbliebenen Mitglieds der EU mit Vetorecht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, eine weitgehend eigenständige Rolle in der Weltpolitik anstreben.
Das aber ist für die anderen Mitgliedstaaten inakzeptabel, zum einen wegen der postkolonialen Ambitionen Frankreichs in Staaten Nord- und Zentralafrikas, die immer wieder in militärischen Interventionen münden, die die Staaten dort weiter destabilisieren, zum anderen wegen der vor allem in Ost- und Nordeuropa wachsenden Sorge, damit gänzlich die Bindung an die USA zu verlieren.
Auch in militärisch-operativer Hinsicht liegt ein einiges Europa in weiter Ferne. Das belegen etwa die Schwierigkeiten selbst kleinerer militärischer Verbände, sich im Rahmen der EU zu organisieren. So wurden die EU Battle Groups, die der Europäische Rat im Jahr 2004 ins Leben rief, noch nie eingesetzt. Und auch die bereits 1999 gegründete EU Rapid Operational Reaction Force erwies sich als ineffektiv, was 2012 zu ihrer Auflösung führte. Angesichts dieser Erfahrungen ist zweifelhaft, ob die nach dem Debakel des Afghanistan-Abzugs geplante Rapid Reaction Force eine Erfolgsgeschichte wird.
Eine zukunftsorientierte deutsche Sicherheitspolitik sollte darauf ausgerichtet sein, die Voraussetzungen für ein gemeinsames europäisches Handeln auch im militärischen Bereich Schritt für Schritt zu verbessern. Zugleich aber sollte sie sich von der Vorstellung verabschieden, dass damit eine Weltmachtrolle der EU verbunden sein könnte oder sollte. Das ist angesichts der unterschiedlichen Vorstellungen der EU-Mitgliedstaaten schlicht nicht möglich. Ein solches Konzept ist aber auch nicht sinnvoll, weil es mittlerweile aus der Zeit gefallen ist.
Frieden und Sicherheit in der Welt fördern
Eine zukunftsfähige Sicherheitspolitik muss daher zunächst zur Kenntnis nehmen, dass sich die klassischen Mittel der Sicherheitspolitik – allen voran das Militär – nur noch bedingt dazu eignen, Frieden und Sicherheit in der Welt zu fördern. Das bedeutet nicht, klassische Bedrohungen durch aggressive Staaten und militante Gruppen fortan zu ignorieren. Zugleich aber muss eine zukunftsfähige Sicherheitspolitik anerkennen, dass die Sicherheit von Menschen und Staaten im 21. Jahrhundert zunehmend durch Risiken bedroht wird, für die das Militär weitgehend irrelevant geworden ist. Die Sicherheit von Leib und Leben, das Überleben als solches ist für Menschen in vielen Regionen dieser Welt schon lange vor allem durch Armut und verschiedene andere Katastrophen bedroht. Der Klimawandel und aktuell die Corona-Pandemie verschärfen deren Probleme und drohen, Menschen in weiteren Regionen zu gefährden. Damit wird zunehmend auch die Stabilität von Staaten und in Extremfällen – wie im Falle kleiner Inselstaaten – sogar deren Existenz bedroht. Weder Armut noch Wirtschaftskrisen noch Klimawandel lassen sich mit Waffengewalt bekämpfen. Das Ziel zukunftsorientierter Sicherheitspolitik sollte es daher sein, einen Beitrag zur Bewältigung der globalen Probleme des 21. Jahrhunderts zu leisten, indem sie gemeinsames Handeln fördert – oder zumindest nicht behindert. Gemeinsamkeit aber lässt sich nicht durch militärische Überlegenheit erzeugen.
Die erfolgreiche Bewältigung von Risiken wie Klimawandel, Pandemien oder globaler Armut steht allerdings in zweifacher Konkurrenz zu einer machtorientierten Sicherheitspolitik. Zum einen in finanzieller Hinsicht: Geld, das für Militär ausgegeben wird, steht nicht länger für die Bewältigung globaler Probleme zur Verfügung. Zum anderen besteht das Kerngeschäft dieser Art von Sicherheitspolitik nicht in Zusammenarbeit, sondern in der Konfrontation. Schon während des Kalten Krieges waren die globalen Militärausgaben angesichts der bereits damals gewaltigen Probleme in der Welt „organisierter Wahnsinn“[13]. Heute sind sie weit höher als jemals während des Kalten Krieges.[14]
Mehr Zusammenarbeit wagen – auch mit problematischen Akteuren
Die wachsenden globalen Herausforderungen erfordern mehr Zusammenarbeit auch mit Akteuren, mit denen Kooperation schwerfällt. Die Menschenrechtslage ist in vielen Staaten weltweit katastrophal. China und Russland werden zunehmend autoritär regiert und provozieren mit aggressiven Aktivitäten in ihren Randzonen. Auch hier ist eine Ausbalancierung von berechtigter Kritik an den Verhältnissen und Aggressionen einerseits sowie Offenheit und Bescheidenheit andererseits gefordert. Die Grundprinzipien sicherheitspolitischen Handelns sollten sich daher an der Einhaltung vereinbarter Regeln wie auch an der Erkenntnis der eigenen begrenzten Möglichkeiten orientieren, mit sicherheitspolitischen Instrumenten Einfluss nehmen zu können. Das aber heißt: Wo vereinbarte Regelungen, beim Schutz von Menschenrechten oder des Gewaltverbots des Völkerrechts, gebrochen werden, muss dies klar benannt und müssen die dafür Verantwortlichen sanktioniert werden. Damit sollte aber weder übermäßige Hoffnung auf Verhaltensänderungen verbunden werden, noch sollte die Zusammenarbeit völlig eingestellt werden. Das gebietet nicht nur das überragende Interesse an Kooperation, sondern auch die Erkenntnis, selbst nicht vor Abweichungen von liberalen Postulaten gefeit zu sein, etwa in der europäischen Flüchtlingspolitik.
Bescheidenheit und Zurückhaltung empfehlen sich nicht nur im Umgang mit Großmächten, sondern auch bei anderen Aspekten zukunftsfähiger Sicherheitspolitik. So hat sich nicht nur in Afghanistan die Vorstellung, unter Einsatz militärischer Mittel große gesellschaftliche Umwälzungen in Richtung Demokratie und Menschenrechte bewirken zu können, als maßlose Überschätzung der eigenen Möglichkeiten erwiesen. Ein solcher Wandel muss vielmehr aus den jeweiligen Gesellschaften selbst kommen, wenn er denn gewollt ist. Wird er hingegen mit militärischen Mitteln abgesichert oder erzwungen, erweist er sich allzu oft als nicht nachhaltig und mit dem Abzug der intervenierenden Truppen als hinfällig. Militärische Auslandseinsätze sollten daher auch nur mandatiert werden, wenn deren Ziele bescheiden und begrenzt sind – insbesondere wenn es darum geht, vereinbarte Waffenstillstände oder Friedensabkommen abzusichern.
Die hier skizzierte Sicherheitspolitik ist keine grand strategy. Vielmehr erfordert sie ein ständiges Abwägen, im Grundsätzlichen wie auch im konkreten Krisenfall. Ein solches Abwägen fällt leichter, wenn Sicherheitspolitik nicht isoliert als vorwiegend militärisch geprägte Politik zur Einhegung drohender Gewalteskalation betrachtet wird, sondern als ein Element umfassender Risikovorsorge. „Dem Frieden in der Welt zu dienen“, erfordert im 21. Jahrhundert demnach vor allem zweierlei: Kooperationsbereitschaft und Zurückhaltung.
[1] Vgl. Richard Haass, Von Trump zu Biden: Die Ära des „America First“, in: „Blätter“, 11/2021, S. 64-76.
[2] Vgl. Designierte Außenministerin Baerbock: „Für Werte werben“, www.tageszeitung.de, 1.12.2021.
[3] Vgl. Bernd Greiner, „Nine Eleven“, Afghanistan, Irak: Das Ende des amerikanischen Jahrhunderts, in: „Blätter“, 9/2021, S. 43-52.
[4] Vgl. Michael Brzoska und Hans-Georg Ehrhart, Mythos: Die Nato ist der Kernpunkt deutscher Staatsraison, in: „Die Friedens-Warte“, 3-4/2021, S. 237- 247.
[5] Vgl. Dan Krause und Michael Staack, Die Entwicklung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik Deutschlands – Analyse im Spiegel der strategisch-konzeptionellen Grundlagendokumente 2014 bis 2018. In: Gunther Hauser (Hg.), Deutschland – Österreich – Schweiz. Sicherheitspolitische Zielsetzungen – militärpolitische Ausrichtungen, in: „Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie“, 7/2020, S. 11-65.
[7] Vgl. Peter Rudolf, The Sino-American World Conflict, in: „SWP Research Paper”, 3.2.2020.
[8] Vgl. dazu die Rede Wladimir Putins zur Lage der Nation vom 21.4.2021, in englischer Sprache zu finden unter http://en.kremlin.ru/events/president/news/65418 sowie Manfred Quiring, Putins Staatsräson: Der Feind steht im Westen, in: „Blätter“, 9/2021, S. 99-104.
[9] Vgl. dazu Wolfgang Zellner, Die EU als Lebensversicherung. Globale Aufrüstung und die Selbstbehauptung Europas, in: „Blätter“, 5/2018, S. 52-62.
[10] Vgl. Barbara Kunz, Die europäische Sicherheits- und Verteidigungsdebatte 2021: Die Rückkehr der großen Fragen, in: „Sicherheit und Frieden – Security and Peace“, 4/2021, S. 195-199.
[11] Vgl. Hans-Georg Ehrhart, Europäische Armee: Realitäten und Chimären, in: „Ethik und Militär“, 2/2018, S. 21-26.
[12] Vgl. die Rede Präsident Macrons an der Ecole de Guerre am 7.2.2020, auf Deutsch auf der Webseite von „Augen geradeaus!“, www.augengeradeaus.net, 8.2.2020.
[13] Ausführlich diskutiert von Willy Brandt in: Der organisierte Wahnsinn. Wettrüsten und Welthunger, Köln 1985.
[14] Vgl. Stockholm International Peace Research Institute, Trends in World Military Expenditure, 2020, „SIPRI Fact Sheet”, April 2021, www.sipri.org.